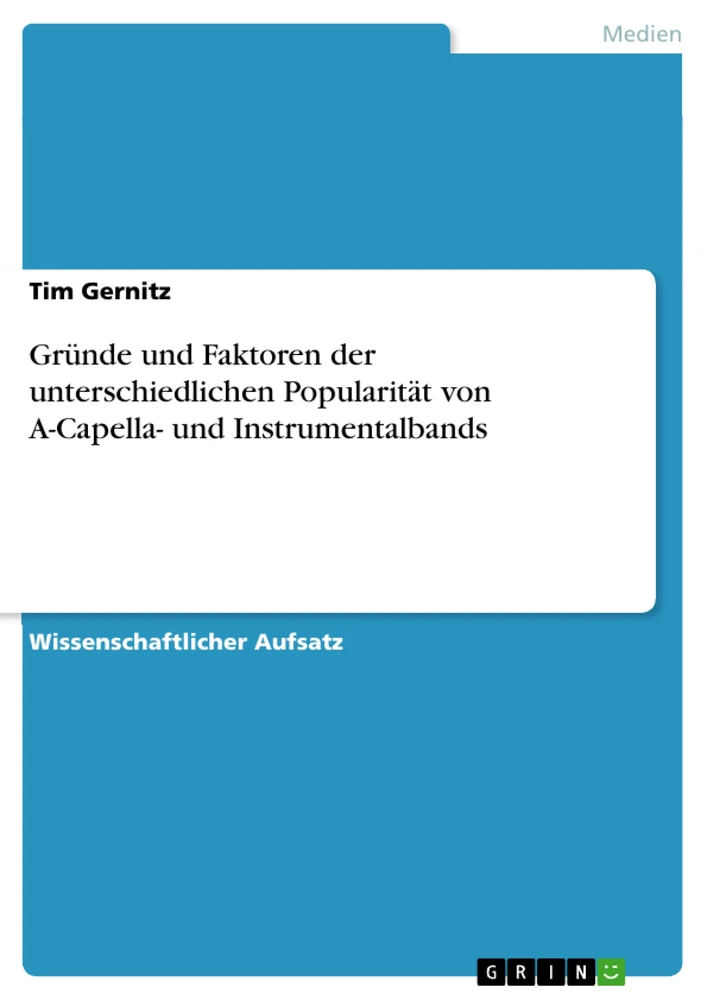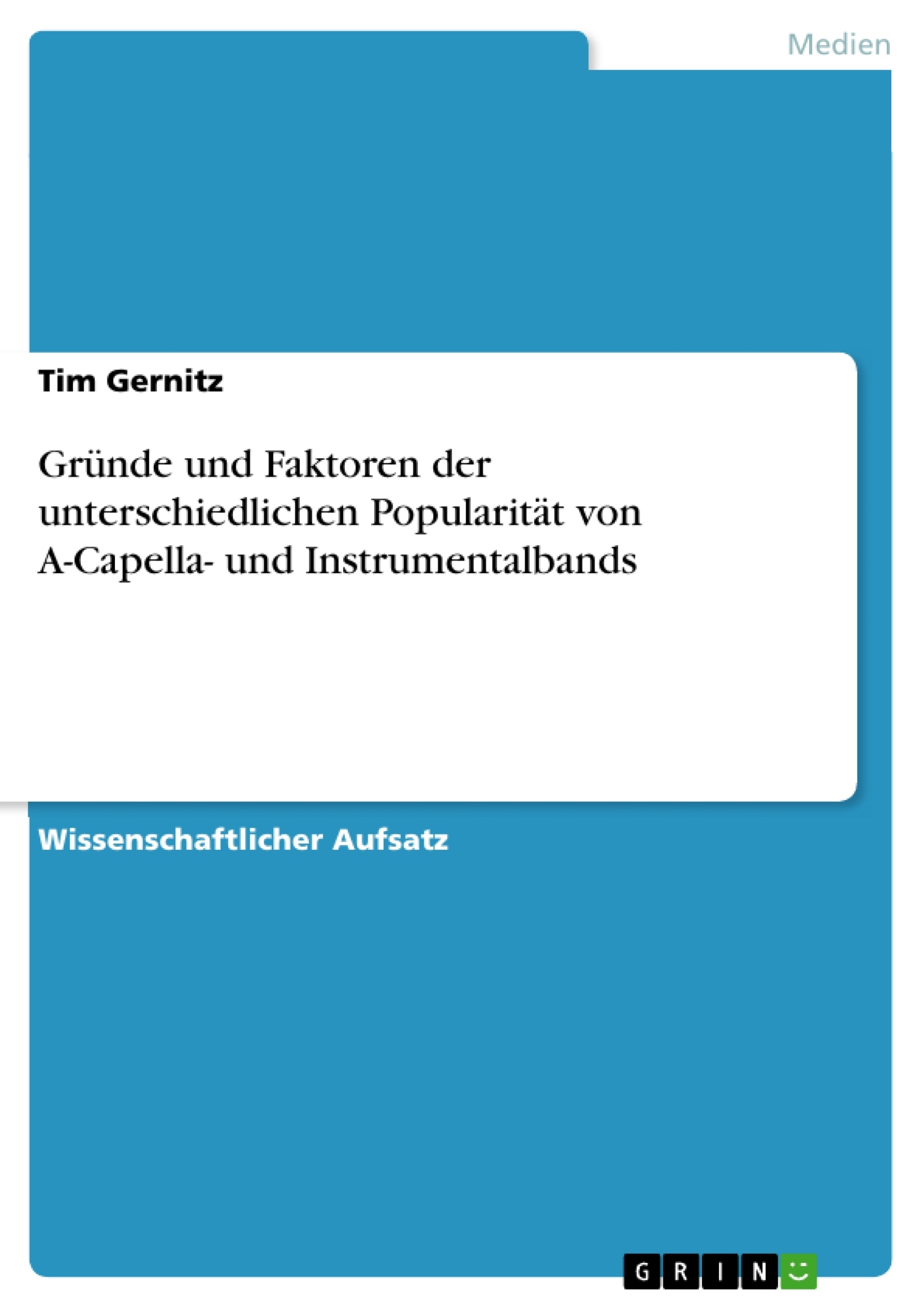„Wir sind die unbekannteste erfolgreiche Band Deutschlands.“ Diese Meinung äußerte Daniel Dickopf, der Frontmann und Liedschreiber der Kölner A-Capella-Band Wise Guys, in mehreren TV-Interviews 2011 sowie als Einleitungssatz auf der offiziellen Homepage der Wise Guys. Damit gibt er Einblick in einen Sachverhalt, welcher für die deutsche A-Capella-Szene präsenter ist als er scheint: der fehlende Sprung von populärer A-Capella-Musik hin zur Gleichberechtigung mit vergleichbaren bekannten Instrumental-Gruppen.
Dieser Text soll Einblicke in die Faktoren und Gründe der unterschiedlichen Popularität von A-Capella- und Instrumentalbands im deutschsprachigen Raum geben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vokalmusik.
Um verschiedene Prozesse nachvollziehen zu können, ist die Geschichte und Entwicklung der Musikgattung a capella zu beleuchten. Hinzu soll die erste erfolgreiche deutschsprachige A-Capella-Gruppe, die Comedian Harmonists, charakterisiert werden. Da Popularität heutzutage hauptsächlich von qualitativ hochwertigen Marketing- und Vertriebsformen abhängig ist, sollen anhand des Musikmediums Radio, Gründe für das Interesse des Publikums an bestimmter Musik durch Major- und Indie-Labels aufgezeigt werden.
Durch die Erläuterungen von musikalischen Prozessen und dem grundlegenden Aufbau von A-Capella-Bands wird auf gesellschaftliche Faktoren in Verbindung mit musikalischer Früherziehung und lokal unterschiedlichen Interessengemeinschaften eingegangen.
Um einen Vergleich zwischen Instrumental- und A-Capella-Musik zu ziehen, dient die auszugsweise Analyse des sowohl als Instrumental- als auch Vokalstück arrangierten Titels Fieber der Instrumentalband Tele. Hierbei soll die Imitation von Instrumenten, der Aufbau eines A-Capella-Arrangements und die damit verbundenen Interpretationsmöglichkeiten von vorheriger Instrumentalmusik, sowie die hohe Transparenz zwischen beiden Musikgattungen erkennbar werden.
Es handelt sich bei der Thematik dieser Arbeit um ein bisher wenig untersuchtes Feld mit gebündelten Informationen. Dennoch ist es möglich, einen Abriss über die Problematik mit einer Sensibilisierung der Musikgattung a-capella zu geben. Inwieweit eine Abhängigkeit zwischen dieser Art von Musik und deren erfolgreicher Vermarktung für eine größere Popularität besteht, ist zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A-Capella: Eine Begriffseingrenzung
- Die Geschichte und Entwicklung der Musikgattung A-Capella
- Der deutsche Musikmarkt als Popularitätsfaktor
- Die Präsenz von A-Capella-Musik
- Schlagzeugimitation mit dem Mund- Beatboxing
- Imitation von Instrumenten mit der menschlichen Stimme anhand des Notenbeispiels „Fieber“
- Vergleich zwischen populären A-Capella- und Instrumentalbands
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedliche Popularität von A-Capella- und Instrumentalbands im deutschsprachigen Raum, wobei der Fokus auf Vokalmusik liegt. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der A-Capella-Musik, analysiert den deutschen Musikmarkt und vergleicht A-Capella- mit Instrumentalbands. Ziel ist es, Faktoren und Gründe für die bestehenden Popularitätsunterschiede zu identifizieren.
- Die Geschichte und Entwicklung der A-Capella-Musik
- Der Einfluss des deutschen Musikmarktes auf die Popularität
- Der Vergleich von A-Capella- und Instrumentalbands
- Analyse der musikalischen Prozesse und des Aufbaus von A-Capella-Bands
- Gesellschaftliche Faktoren im Zusammenhang mit musikalischer Früherziehung und regionalen Interessengemeinschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass A-Capella-Musik im deutschsprachigen Raum im Vergleich zu Instrumentalmusik eine geringere Popularität genießt. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit, die Faktoren und Gründe für diese unterschiedliche Popularität zu untersuchen, und skizziert den methodischen Ansatz, der die Geschichte der A-Capella-Musik, den deutschen Musikmarkt und einen Vergleich zwischen A-Capella- und Instrumentalbands umfasst. Die Einleitung betont die Bedeutung der Vokalmusik und verweist auf die Arbeit als bisher wenig untersuchtes Gebiet.
A-Capella: Eine Begriffseingrenzung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „A-Capella“ und beleuchtet seine historische Entwicklung. Es beginnt mit der etymologischen Herleitung aus dem Italienischen und präsentiert verschiedene historische Definitionen des Begriffs. Das Kapitel diskutiert das Missverständnis, das sich im 19. Jahrhundert um den Begriff gebildet hat, und betont die Ursprünge des menschlichen Gesangs als natürlichen Klangkörper. Es berührt den Zusammenhang zwischen Gesang, Psyche und sozialer Harmonie, indem es auf Platon und die Bedeutung von Gesang für die menschliche Entwicklung eingeht, sowie auf die Entwicklung des A-Capella-Gesangs von der frühen Kirche bis zur Renaissance.
Der deutsche Musikmarkt als Popularitätsfaktor: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des deutschen Musikmarktes bei der Popularität von A-Capella-Musik. Es untersucht die Präsenz von A-Capella-Musik im deutschen Musikmarkt, die Bedeutung von Beatboxing als Schlagzeugimitation und die Möglichkeiten der Instrumentimitation durch die menschliche Stimme, illustriert am Beispiel des Liedes "Fieber". Der Fokus liegt auf den Mechanismen, die die Popularität bestimmter Musikgenres beeinflussen, unter Einbezug von Major- und Indie-Labels, sowie dem Einfluss von Radio als Musikmedium.
Vergleich zwischen populären A-Capella- und Instrumentalbands: Dieses Kapitel vergleicht A-Capella- und Instrumentalbands hinsichtlich ihrer Popularität. Es analysiert, wie Instrumente im A-Capella-Kontext nachgeahmt werden und wie dies die Interpretationsmöglichkeiten von Instrumentalmusik beeinflusst. Die hohe Transparenz zwischen beiden Musikgattungen wird hervorgehoben. Die Analyse basiert auf einem Vergleichsbeispiel, welches sowohl als Instrumental- als auch als Vokalstück arrangiert ist.
Schlüsselwörter
A-Capella-Musik, Instrumentalmusik, Popularität, Musikmarkt, Deutschland, Vokalmusik, Beatboxing, Instrumentimitation, Comedian Harmonists, Wise Guys, Marketing, Vertrieb, musikalische Früherziehung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: A-Capella vs. Instrumentalmusik im deutschsprachigen Raum
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die unterschiedliche Popularität von A-Capella- und Instrumentalbands im deutschsprachigen Raum. Der Fokus liegt dabei auf Vokalmusik und den Faktoren, die zu den Popularitätsunterschieden beitragen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der A-Capella-Musik, analysiert den deutschen Musikmarkt, vergleicht A-Capella- mit Instrumentalbands und untersucht den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren wie musikalische Früherziehung und regionale Interessengemeinschaften.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffseingrenzung von A-Capella, ein Kapitel zum deutschen Musikmarkt als Popularitätsfaktor, ein Kapitel zum Vergleich von A-Capella- und Instrumentalbands und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter A-Capella verstanden?
Das Kapitel „A-Capella: Eine Begriffseingrenzung“ definiert den Begriff „A-Capella“, beleuchtet seine historische Entwicklung von den Ursprüngen des menschlichen Gesangs bis zur Renaissance und diskutiert Missverständnisse, die sich im Laufe der Zeit um den Begriff gebildet haben.
Welche Rolle spielt der deutsche Musikmarkt?
Das Kapitel „Der deutsche Musikmarkt als Popularitätsfaktor“ analysiert die Präsenz von A-Capella-Musik im deutschen Musikmarkt, die Bedeutung von Beatboxing und die Möglichkeiten der Instrumentimitation durch die menschliche Stimme. Es untersucht die Mechanismen, die die Popularität von Musikgenres beeinflussen, unter Einbezug von Major- und Indie-Labels und dem Einfluss von Radio.
Wie werden A-Capella- und Instrumentalbands verglichen?
Das Kapitel „Vergleich zwischen populären A-Capella- und Instrumentalbands“ vergleicht beide Musikgenres hinsichtlich ihrer Popularität, analysiert die Nachahmung von Instrumenten im A-Capella-Kontext und basiert auf einem Vergleichsbeispiel, welches sowohl als Instrumental- als auch als Vokalstück arrangiert ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: A-Capella-Musik, Instrumentalmusik, Popularität, Musikmarkt, Deutschland, Vokalmusik, Beatboxing, Instrumentimitation, Comedian Harmonists, Wise Guys, Marketing, Vertrieb, musikalische Früherziehung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Faktoren und Gründe für die bestehenden Popularitätsunterschiede zwischen A-Capella- und Instrumentalmusik im deutschsprachigen Raum zu identifizieren.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die Geschichte der A-Capella-Musik, den deutschen Musikmarkt und einen Vergleich zwischen A-Capella- und Instrumentalbands umfasst.
- Quote paper
- Tim Gernitz (Author), 2014, Gründe und Faktoren der unterschiedlichen Popularität von A-Capella- und Instrumentalbands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288347