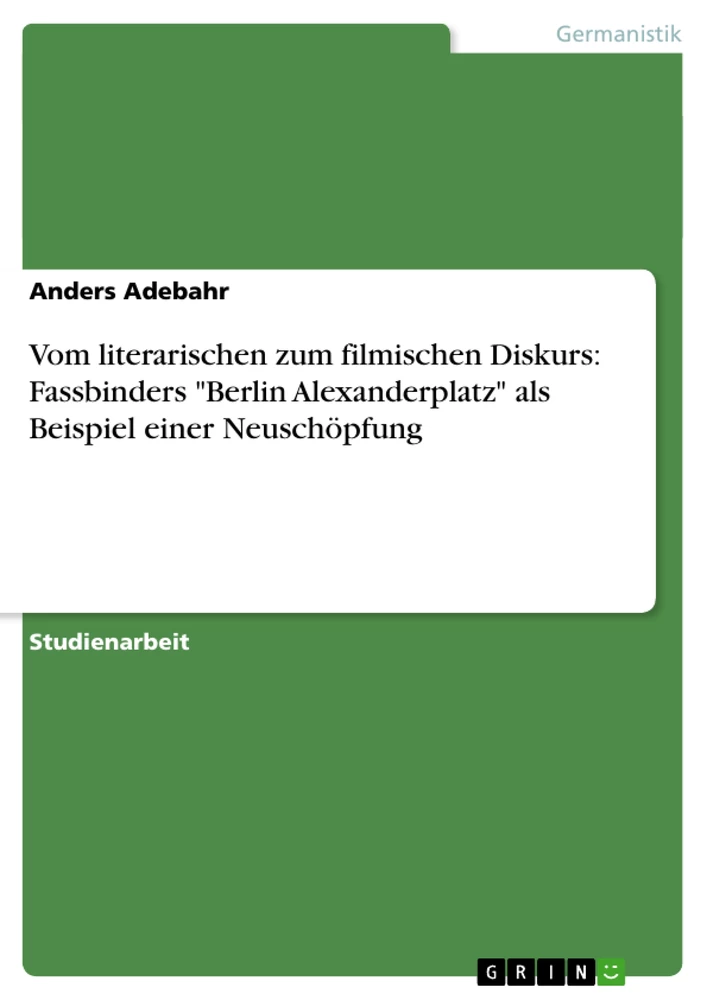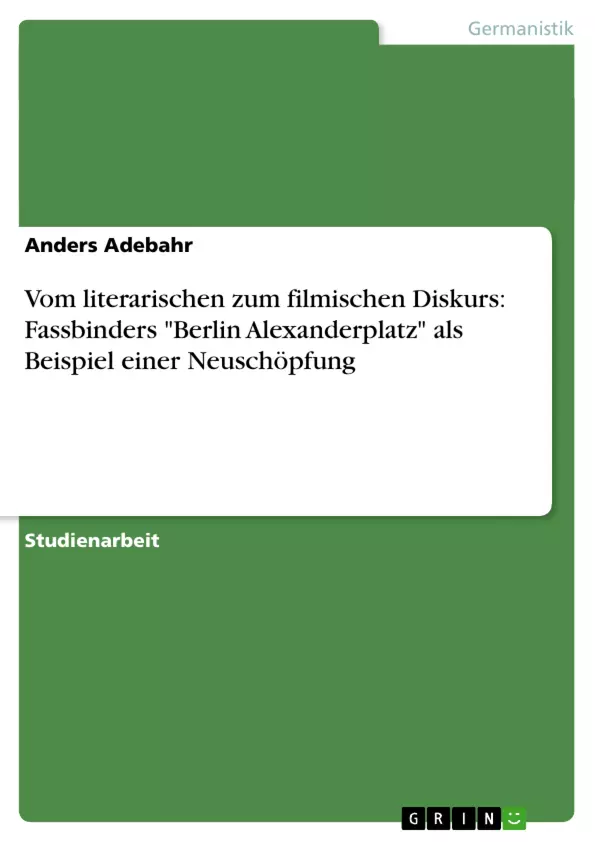Kino besteht nicht einfach darin, bloß auf andere Art dasjenige zu sagen,
was andere Künste schon haben sagen können, sondern mit seinen spezifischen
Mitteln auch etwas Anderes zu sagen. Eric Rohmer1
Die vorliegende Hausarbeit ist im Anschluss an die Einführung in das Studium der
neueren deutschen Literatur entstanden, in dessen Mittelpunkt sowohl der Roman
„Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin als auch dessen Transformation in eigenständige
akustische und visuelle Texte.
Am Beispiel der Fernsehserie „Berlin Alexanderplatz“ von Rainer Werner Fassbinder2
möchte ich exemplarisch den Übergang vom literarischen zum filmischen
Text darstellen, um in einem weiteren Schritt den Begriff „Literaturverfilmung“ zu
diskutieren.
Beginnend mit einem Einblick in die Entstehungsgeschichte der Fernsehserie und
der Arbeit Fassbinders soll dann kurz der Stand der Forschung dargestellt werden.
In diesem Zusammenhang soll der Transformationsprozess erklärt werden.
Die konkrete Umsetzung des vorher erläuterten stelle ich dann anhand der Entlassungsszene
aus Fassbinders Verfilmung in Form einer Szenenanalyse dar. Dabei
ist näher auf die einzelnen bedeutungstragenden und bedeutungsschaffenden
Ebenen einzugehen.
Die Hausarbeit endet dann mit dem Verzeichnis der verwendeten Literatur und
einem Szenenprotokoll des verwendeten Filmausschnitts.
1 Nach Rost, S. 318.
2 Im folgenden mit FBA abgekürzt.
Inhaltsverzeichnis
- (1) Einleitung
- (2) Die Entstehung von Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“
- (3) Von der literarischen Vorlage zur Verfilmung
- (3.1) Adaption
- (3.2) Transformation
- (3.3) Neuschöpfung
- (4) Szenenanalyse
- (5) Fazit
- (6) Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Transformation von Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ in Rainer Werner Fassbinders gleichnamiger Fernsehserie. Sie analysiert den Übergang vom literarischen zum filmischen Text und hinterfragt den Begriff „Literaturverfilmung“ anhand der spezifischen filmischen Gestaltung der Serie. Die Arbeit beschäftigt sich zudem mit der Entstehungsgeschichte der Serie und dem Transformationsprozess, der von der literarischen Vorlage zur Verfilmung führt.
- Transformationsprozess vom literarischen zum filmischen Text
- Untersuchung des Begriffs „Literaturverfilmung“
- Szenenanalyse der Entlassungsszene aus Fassbinders Verfilmung
- Die Bedeutung des Melodrams in Fassbinders Interpretation
- Analyse der spezifischen filmischen Mittel und ihrer Wirkung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beschreibt den theoretischen Rahmen. Im zweiten Kapitel wird die Entstehung von Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“ beleuchtet, indem die Karriere des Regisseurs und die Entstehung der Serie im Kontext des WDR erläutert werden. Das dritte Kapitel untersucht den Übergang von der literarischen Vorlage zur Verfilmung. Hierbei werden die Konzepte der Adaption, Transformation und Neuschöpfung diskutiert. Die Adaption wird im Kontext der subjektiven Sichtweise Fassbinders und seiner Interpretation von Döblins Roman als Melodram beleuchtet. Die Transformation behandelt die filmische Phantasie des Regisseurs und die Nutzung filmspezifischer Gestaltungsmöglichkeiten. Das vierte Kapitel widmet sich einer Szenenanalyse der Entlassungsszene aus Fassbinders Verfilmung, wobei die bedeutungstragenden und bedeutungsschaffenden Ebenen analysiert werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Konzepte von Literaturverfilmung, Adaption, Transformation und Neuschöpfung. Sie analysiert die spezifischen filmischen Mittel, die Fassbinder in seiner Verfilmung von Döblins „Berlin Alexanderplatz“ einsetzt, um eine eigene Interpretation des Romans zu schaffen. Zentrale Themen sind das Melodram, die subjektive Sichtweise des Regisseurs und die filmische Phantasie.
Häufig gestellte Fragen
Wie transformierte Fassbinder Döblins Roman "Berlin Alexanderplatz"?
Fassbinder nutzte spezifische filmische Mittel, um den literarischen Text in eine visuelle und akustische Neuschöpfung zu überführen, die seine eigene Handschrift trägt.
Was ist der Unterschied zwischen Adaption und Neuschöpfung?
Während Adaption oft die bloße Anpassung meint, beschreibt Neuschöpfung die Entstehung eines eigenständigen Kunstwerks, das über die Vorlage hinausgeht.
Welche Szene wird in der Hausarbeit detailliert analysiert?
Die Arbeit enthält eine ausführliche Szenenanalyse der Entlassungsszene von Franz Biberkopf aus der Verfilmung.
Welches Genre ordnet Fassbinder seiner Verfilmung zu?
Fassbinder interpretierte Döblins Stoff stark im Sinne eines Melodrams, was sich in der filmischen Gestaltung und Emotionalität widerspiegelt.
Wer produzierte die Fernsehserie "Berlin Alexanderplatz"?
Die Serie entstand unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder im Kontext der Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk (WDR).
- Citation du texte
- Anders Adebahr (Auteur), 2003, Vom literarischen zum filmischen Diskurs: Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" als Beispiel einer Neuschöpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28844