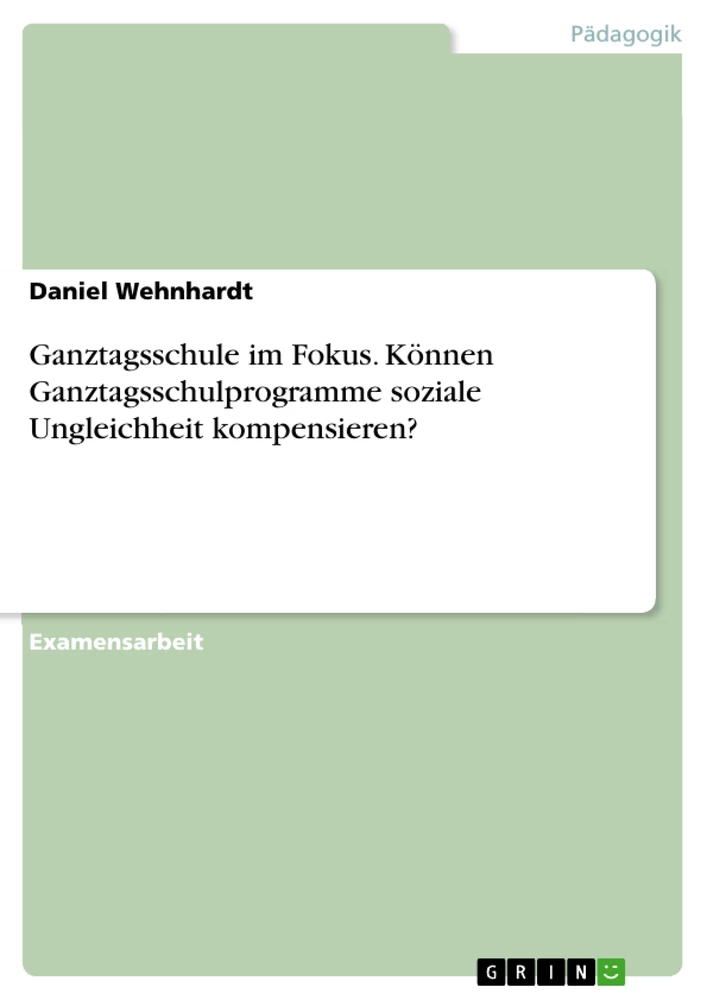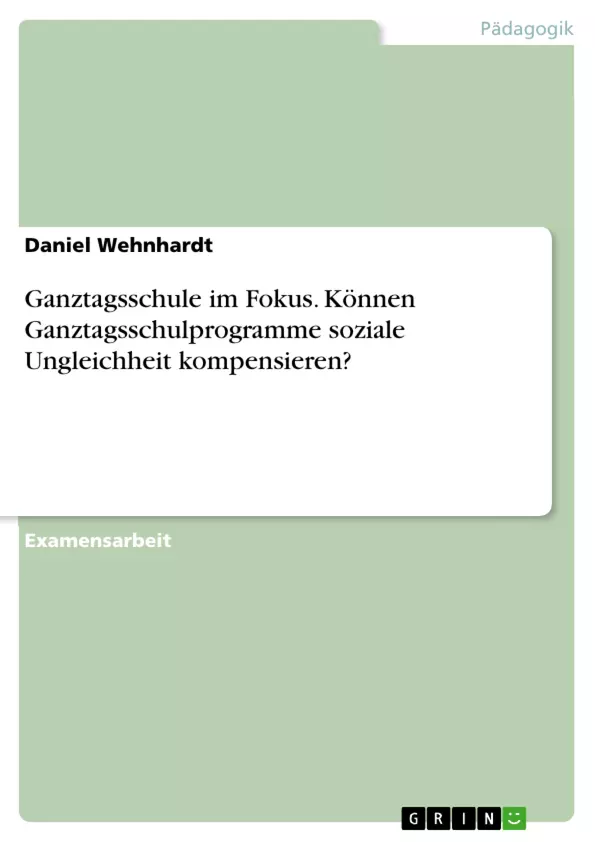Die Entfachung des aktuellen bildungspolitischen Diskurses rund um die Ganztagsschule datiert auf das Jahr 2000, in dem
die Ergebnisse der ersten Erhebungsphase der internationalen Vergleichsstudien "PISA" bekannt wurden. Diese attestierten nicht nur den deutschen Schülerinnen und Schülern erhebliche Kompetenzdefizite, sondern auch dem Schulsystem insgesamt eine manifeste soziale Ungleichheit: Trotz der Bildungsreformen der 1960/70er Jahre und der anschließenden
Bildungsexpansion besteht in der BRD nach wie vor ein starker Zusammenhang zwischen dem Bildungserfolg und der sozialen Herkunft. Diese Erkenntnis lieferte den Startschuss für eine seitdem herrschende Diskussion über notwendige Bildungsreformen und rief die Befürworter ganztäglicher Bildungs- und Betreuungsangebote zurück auf den Plan. Denn neben diversen pädagogisch und politisch motivierten Hoffnungen wird vor allem immer wieder die Behauptung aufgestellt, dass die Ganztagsschule zu einer Entkopplung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft beitragen könne.
Die vorliegende Arbeit möchte daher eine Antwort finden, ob, wie und in welchem Rahmen von der GTS tatsächlich eine kompensatorische Wirkung ausgeht. Aufgrund der Tatsache, dass der Bildungserfolg in der BRD besonders stark mit der sozialen Herkunft verknüpft ist, fokussiert sie auf diesen Aspekt. Dabei nimmt sie zunächst den Begriff der sozialen Ungleichheit in den Blick und versucht, eine tragfähige Arbeitsdefinition zu ermitteln, um schließlich einen Überblick über historische und zeitgenössische soziologische Theorien zu sozialer Ungleichheit zu geben. Im Anschluss sollen die gewonnen Erkenntnisse auf das Bildungssystem transferiert und herausgestellt werden, wie und wo soziale Ungleichheiten entstehen, um schließlich eine Situationsbeschreibung der aktuellen Lage im Bildungssystem der BRD zu liefern. Daraufhin rückt die Ganztagsschule in den Fokus: Zuerst werden definitorische Probleme diskutiert, dann ein historischer Abriss der Entwicklung der Ganztagsschule gegeben und ein Bild der aktuellen Lage in der BRD gezeichnet. Zuletzt widmet sich die vorliegende Arbeit schließlich ihrer zentralen Fragestellung, zu deren Beantwortung sie empirische Ergebnisse aus der deutschen und der US-amerikanischen Forschung heranzieht: Können Ganztagsschulprogramme soziale Ungleichheit kompensieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Ungleichheit
- Soziale Ungleichheit – eine definitorische Annäherung
- Gemeinsamkeiten
- Unnatürliche Ungleichheiten
- Bedeutsame Güter
- Ungleichverteilung
- Soziale Kollektive
- Persistenz
- Arbeitsdefinition
- Streitfrage: normativ oder nicht?
- Gemeinsamkeiten
- Theorien sozialer Ungleichheit
- Klassentheorien
- Schichtungstheorien
- Strukturfunktionalistische Schichtungstheorien
- Prestige- und Statusmodelle
- Nivellierte Mittelstandsgesellschaft
- Lebensstilmodelle
- Milieumodelle
- Zusammenfassung
- Soziale Ungleichheit – eine definitorische Annäherung
- Soziale Ungleichheit im Bildungssystem der Bundesrepublik
- Terminologie: Bildungsungleichheit
- Chancengleichheit
- Gerecht oder ungerecht? Meritokratie
- Entstehung von Bildungsungleichheit
- Bildungsübergänge
- Innerhalb von Bildungsinstitutionen
- Zwischen Bildungsinstitutionen
- Außerhalb des Bildungssystems
- Mittelschicht-Hypothese
- Bildungsungleichheit in der Bundesrepublik
- Bildungsexpansion
- Auswirkungen der Bildungsexpansion
- Manifeste Bildungsungleichheit
- Kritik des Sonderberichterstatters der 'Vereinten Nationen'
- Bildungsexpansion
- Zusammenfassung
- Terminologie: Bildungsungleichheit
- Die Ganztagsschule in Deutschland
- Ganztagsschule - Was ist das?
- Die Definition der Kultusministerkonferenz
- Vier Differenzierungsachsen
- Die historische Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland
- Ende des 19. Jahrhunderts und frühe Reformpädagogik
- Nationalsozialismus und Nachkriegszeit
- Bildungsexpansion
- Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts
- Aktueller Stand des Ganztagsschulausbaus
- Situation in den einzelnen Bundesländern
- Entwicklung 2002-2012
- Schularten und Trägerschaften
- Entwicklung 2002-2012
- Organisationsmodelle
- Entwicklung 2002-2012
- Schülerzahlen
- Gefälle zwischen alten und neuen Bundesländern
- Situation in den einzelnen Bundesländern
- Zusammenfassung
- Ganztagsschule - Was ist das?
- Die Ganztagsschule als soziales Heilversprechen
- Erwartungen an die Ganztagsschule
- Pädagogische Motive
- Politische Motive
- Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch
- Familienpolitisch
- Bildungs- und sozialpolitisch
- Genderpolitisch?
- Fokus: Ganztagsschule und Kompensation von Bildungsungleichheit
- Ausgangsfragen
- Empirische Belege zur individuellen Leistungsentwicklung
- Empirische Belege
- Deutschland
- Begleitforschungen zu einzelschulischen Modellversuchen
- Experimentalprogramm
- Gesamtschulforschung
- StEG
- GO!
- LAU
- Reanalysen
- Zusammenfassung der nationalen Befundlage
- US-amerikanische Forschung
- Out-of-School Time
- School-based Extracurricular Activities
- Zusammenfassung der US-amerikanischen Befundlage
- Deutschland
- Wirkung auf andere Entstehungsfaktoren
- Sekundäre Herkunftseffekte
- Übrige Faktoren
- Zusammenfassung
- Erwartungen an die Ganztagsschule
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob Ganztagsschulprogramme soziale Ungleichheit kompensieren können. Sie analysiert die Entstehung und die Auswirkungen sozialer Ungleichheit im Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland und beleuchtet die Rolle der Ganztagsschule in diesem Kontext. Die Arbeit untersucht die pädagogischen und politischen Erwartungen an die Ganztagsschule sowie die empirischen Befunde zur Wirksamkeit von Ganztagsschulprogrammen in Bezug auf die Kompensation von Bildungsungleichheit.
- Soziale Ungleichheit und ihre Entstehung im Bildungssystem
- Die Ganztagsschule als Instrument zur Kompensation von Bildungsungleichheit
- Empirische Befunde zur Wirksamkeit von Ganztagsschulprogrammen
- Die Rolle der Ganztagsschule in der Bildungslandschaft
- Herausforderungen und Chancen der Ganztagsschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Relevanz der Fragestellung. Sie definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Kompensationsfähigkeit von Ganztagsschulprogrammen in Bezug auf soziale Ungleichheit.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Konzept der sozialen Ungleichheit. Es werden verschiedene Theorien und Modelle zur Erklärung sozialer Ungleichheit vorgestellt, darunter Klassentheorien, Schichtungstheorien und Lebensstilmodelle. Das Kapitel analysiert die Ursachen und Folgen sozialer Ungleichheit und beleuchtet die Bedeutung von Bildung als Schlüsselfaktor für soziale Mobilität.
Kapitel 3 untersucht die Entstehung und die Auswirkungen von Bildungsungleichheit im Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Es werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die zu Bildungsungleichheit beitragen, wie z. B. die soziale Herkunft, die Bildungsübergänge und die Strukturen innerhalb von Bildungsinstitutionen. Das Kapitel analysiert die Entwicklung der Bildungsungleichheit in Deutschland und stellt die Herausforderungen für ein gerechtes Bildungssystem dar.
Kapitel 4 bietet einen Überblick über die Ganztagsschule in Deutschland. Es werden die Definition, die historische Entwicklung und der aktuelle Stand des Ganztagsschulausbaus in Deutschland dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Organisationsmodelle und die Situation in den einzelnen Bundesländern.
Kapitel 5 untersucht die Erwartungen an die Ganztagsschule und ihre Rolle in der Kompensation von Bildungsungleichheit. Es werden die pädagogischen und politischen Motive für die Einführung der Ganztagsschule sowie die empirischen Befunde zur Wirksamkeit von Ganztagsschulprogrammen in Bezug auf die Kompensation von Bildungsungleichheit analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Ganztagsschule, Kompensation, Bildungssystem, Bundesrepublik Deutschland, empirische Forschung, Wirksamkeit, pädagogische und politische Erwartungen.
- Quote paper
- Daniel Wehnhardt (Author), 2014, Ganztagsschule im Fokus. Können Ganztagsschulprogramme soziale Ungleichheit kompensieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288617