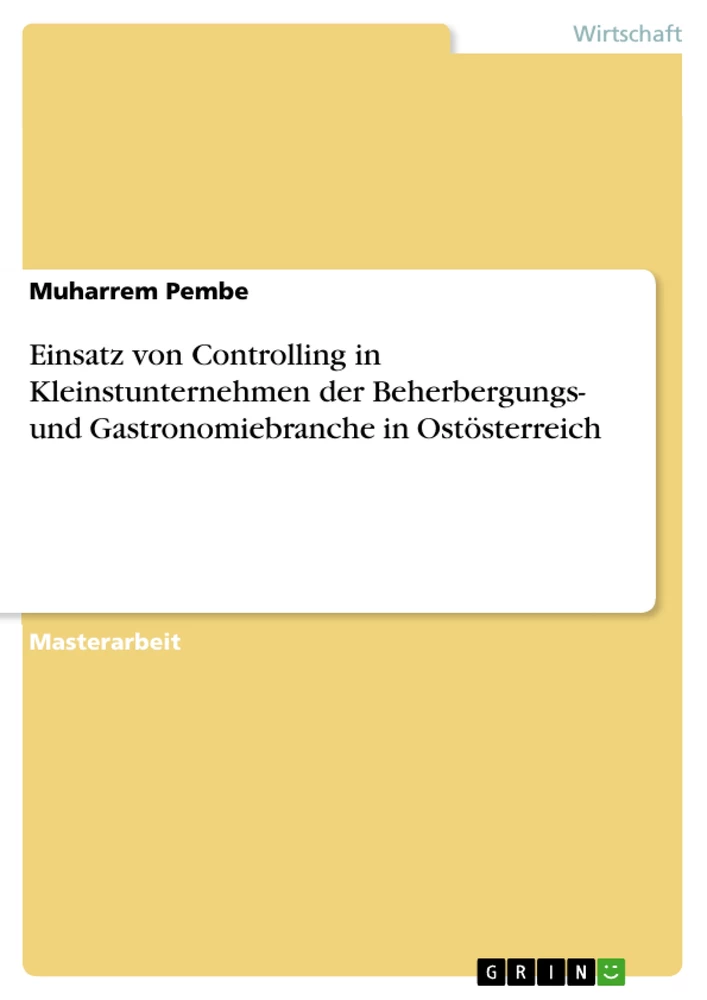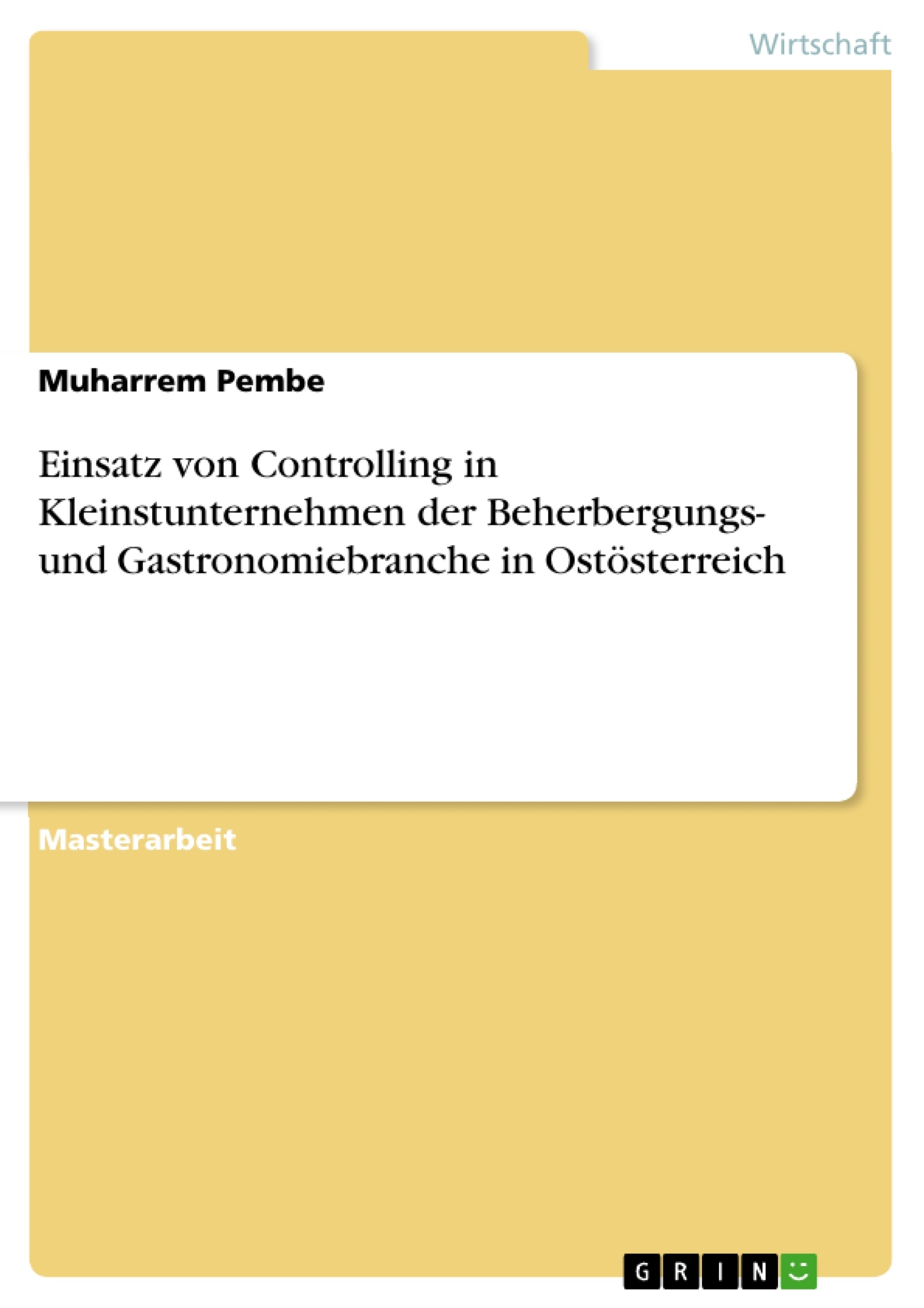Bei der Betrachtung der österreichischen Unternehmenslandschaft wird ersichtlich, dass zirka 99 % der Unternehmen in die Kategorie der Klein- und Mittelbetriebe, die auch die Kleinstbetriebe umfasst, eingeordnet werden können. Auf dieser Tatsache beruhend lässt sich somit feststellen, dass diese Betriebe zu der in Österreich am meist verbreiteten Unternehmensgrößenklasse zählen und daraus resultierend einen starken Einfluss auf die österreichische Wirtschaft haben. Dieser beachtliche Anteil an der Unternehmenskultur Österreichs ermöglicht eine weitere Differenzierung in sogenannte Kleinstbetriebe. Diese Kleinstbetriebe stellen die große Mehrheit aller österreichischen Betriebe im Jahr 2011 mit knapp 92 % (zirka 370.000 Unternehmen) dar. Laut der EU-Regelung beschäftigen Kleinstunternehmen nicht mehr als neun MitarbeiterInnen und die Jahresbilanz bzw. der jährliche Umsatz überschreiten nicht die zwei Mio. Euro-Grenze.
Sehr stark vertreten sind diese Kleinstunternehmnungen in der Beherbergungs- und Gastronomiebranche, wo Kleinstunternehmen zirka 88 % aller Betriebe ausmachen.
Diese Kleinstbetriebe sind zu Beginn ihrer Tätigkeit oft mit Hindernissen konfrontiert, die die Startup-Phase zusätzlich erschweren. Kleinstunternehmen haben es in der Anfangsphase schwer ein nachhaltiges Management und eine reibungslos funktionierende Organisation aufzubauen. Da diese Entscheidungen stark mit Kapital- und Humanressourcen verbunden sind und diese für Kleinstbetriebe eher eine Rarität darstellen, ist es hier sehr problematisch, eine optimale Lösung zu finden.
Diese Aussage manifestiert sich auch in der Anzahl der im Jahre 2009 eingetretenen Unternehmensschließungen. Mit einem Anteil der Unternehmensschließungen im besagten Jahr von rund 99 % weisen diese österreichischen Kleinstbetriebe die höchste Rate unter den zum Schließen gezwungenen Unternehmen auf.
Das Fehlen der zuvor genannten Ressourcen erschwert es, eine Prognose zu erstellen, wie sich das Geschäft in der kurz- bis mittelfristigen Zukunft entwickeln wird. Dieser bittere Beigeschmack der Ungewissheit begleitet das Management auf seinen tagtäglichen Entscheidungen. Des Weiteren stellt die Tatsache, dass nicht jede Kleinstunternehmerin bzw. jeder Kleinstunternehmer über genügend Controllingwissen verfügt, eine Hürde dar, weshalb häufig neben den simplen Kontrollen wie Soll-Ist-Vergleiche, keine weiteren Controllinginstrumente eingesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Abkürzungsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zentrale Fragestellungen
- 1.3 Methodik
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2 Besonderheiten von Kleinstunternehmen
- 2.1 Definition der Größenklassen für Unternehmen
- 2.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Klein- und Mittelbetriebe bzw. Kleinstbetriebe in der EU
- 2.3 Kleinstunternehmen in Österreich
- 2.3.1 Wirtschaftliche Bedeutung
- 2.3.2 Neugründungs- und Schließungsraten
- 2.3.3 Trends
- 3 Daten und Statistiken der Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche in Österreich
- 3.1 Definitionen
- 3.2 OECD-Vergleich Österreichs als Reisedestination
- 3.3 Strukturdaten der Beherbergungs- und Gastronomiebranche
- 3.3.1 Neugründungen und Beschäftigte
- 3.3.2 Schließungen und Beschäftigte
- 3.3.3 Umsatzerlöse
- 3.3.4 Bruttoinlandsprodukt
- 4 Controlling in Kleinstunternehmen
- 4.1 Definition und Begriffsabgrenzung
- 4.2 Controllingrelevante Charakteristika der Kleinstunternehmen
- 4.2.1 Personenbezogene Charakteristika
- 4.2.2 Organisationsbezogene Charakteristika
- 4.2.3 Kaufmännische Charakteristika
- 4.3 Aufgaben des Controllings in Kleinstunternehmen
- 4.3.1 Aufgaben des Controllings
- 4.3.1.1 Planung und Kontrolle
- 4.3.1.2 Information
- 4.3.1.3 Steuerung
- 4.3.2 Charakteristika und Ebenen des Controllings
- 4.3.1 Aufgaben des Controllings
- 4.4 Operative Controllinginstrumente für Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche
- 4.4.1 ABC-Analyse
- 4.4.2 XYZ-Analyse
- 4.4.3 Break-Even-Analyse
- 4.4.4 Budgetierung
- 4.4.5 Kennzahlen
- 4.4.5.1 Beherbergungskennzahlen
- 4.4.5.2 Gastronomiekennzahlen
- 4.4.6 Kennzahlensysteme
- 4.4.7 Deckungsbeitragsrechnung
- 4.4.8 Soll-Ist-Vergleich
- 4.4.9 Liquiditätsplan
- 5 Empirische Studie
- 5.1 Definition
- 5.2 Qualitative vs. Quantitative Forschung
- 5.3 Forschungsziel
- 5.4 Forschungsfragen
- 5.5 Forschungsdesign
- 5.5.1 Methodisches Vorgehen
- 5.5.2 Auswahl der Methoden
- 5.5.3 Auswahl der ExpertInnen
- 5.5.4 Erhebung der Daten
- 5.5.5 Auswertung der Daten
- 5.6 Ergebnisse und Interpretation
- 5.7 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Interviews
- 6 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Einsatz von Controlling in Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche in Ostösterreich. Ziel ist es, die aktuelle Praxis des Controllings in diesen Unternehmen zu analysieren und die Gründe für die (Nicht-)Anwendung von Controlling-Instrumenten zu erforschen. Darüber hinaus soll ein optimales Controlling-Konzept für diese Unternehmensgruppe entwickelt werden.
- Definition und Bedeutung von Controlling in Kleinstunternehmen
- Spezifische Herausforderungen und Chancen des Controllings in der Beherbergungs- und Gastronomiebranche
- Analyse der aktuellen Controlling-Praxis in Kleinstunternehmen der Branche in Ostösterreich
- Entwicklung eines optimalen Controlling-Konzepts für Kleinstunternehmen der Branche
- Empfehlungen für die Implementierung und Nutzung von Controlling-Instrumenten in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Sie erläutert die Methodik und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Besonderheiten von Kleinstunternehmen im Allgemeinen, insbesondere in Bezug auf ihre wirtschaftliche Bedeutung, Neugründungs- und Schließungsraten sowie Trends. Kapitel 3 präsentiert Daten und Statistiken zur Beherbergungs- und Gastronomiebranche in Österreich, einschließlich Neugründungen, Schließungen, Umsatzerlöse und Bruttoinlandsprodukt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Controlling in Kleinstunternehmen, wobei die Definition, Begriffsabgrenzung und die relevanten Charakteristika dieser Unternehmensgruppe im Fokus stehen. Es werden die Aufgaben des Controllings sowie operative Controllinginstrumente wie ABC-Analyse, XYZ-Analyse, Break-Even-Analyse, Budgetierung, Kennzahlen, Kennzahlensysteme, Deckungsbeitragsrechnung, Soll-Ist-Vergleich und Liquiditätsplan vorgestellt. Kapitel 5 beschreibt die empirische Studie, die zur Beantwortung der Forschungsfragen durchgeführt wurde. Es werden die Forschungsmethodik, die Auswahl der Methoden und der ExpertInnen, die Erhebung und Auswertung der Daten sowie die Ergebnisse und Interpretationen dargestellt. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt Empfehlungen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Controlling, Kleinstunternehmen, Beherbergungs- und Gastronomiebranche, Ostösterreich, empirische Forschung, qualitative Forschung, Interviews, Controlling-Konzept, Kennzahlen, Kennzahlensysteme, Budgetierung, Liquiditätsplan, Break-Even-Analyse, ABC-Analyse, XYZ-Analyse, Deckungsbeitragsrechnung, Soll-Ist-Vergleich, Unternehmensführung, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Effizienz, Erfolgsmessung, Entscheidungsfindung, Risikomanagement, Finanzplanung, Finanzkontrolle, Unternehmenserfolg, Branchenentwicklung, Unternehmensgröße, Unternehmensstruktur, Unternehmensstrategie, Unternehmensziele, Unternehmensentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kleinstunternehmen gibt es in der österreichischen Tourismusbranche?
In der Beherbergungs- und Gastronomiebranche machen Kleinstunternehmen zirka 88 % aller Betriebe aus.
Was definiert ein Kleinstunternehmen laut EU-Regelung?
Ein Kleinstunternehmen beschäftigt nicht mehr als neun Mitarbeiter und hat einen Jahresumsatz oder eine Bilanzsumme von höchstens zwei Millionen Euro.
Warum scheitern so viele Kleinstunternehmen in der Anfangsphase?
Häufige Gründe sind mangelndes Controllingwissen sowie knappe Kapital- und Humanressourcen, was den Aufbau eines nachhaltigen Managements erschwert.
Welche operativen Controllinginstrumente sind für diese Branche wichtig?
Zu den empfohlenen Instrumenten gehören die Break-Even-Analyse, die Deckungsbeitragsrechnung, Liquiditätspläne sowie spezifische Beherbergungs- und Gastronomiekennzahlen.
Was ist das Ziel der empirischen Studie in dieser Arbeit?
Die Studie analysiert die aktuelle Controlling-Praxis in Ostösterreich und erforscht die Gründe für die Anwendung oder Nicht-Anwendung bestimmter Instrumente.
Welche Rolle spielt der Soll-Ist-Vergleich?
Er ist oft das einzige eingesetzte Controllinginstrument in Kleinstbetrieben, um Abweichungen von der Planung frühzeitig zu erkennen.
- Quote paper
- Muharrem Pembe (Author), 2013, Einsatz von Controlling in Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche in Ostösterreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288637