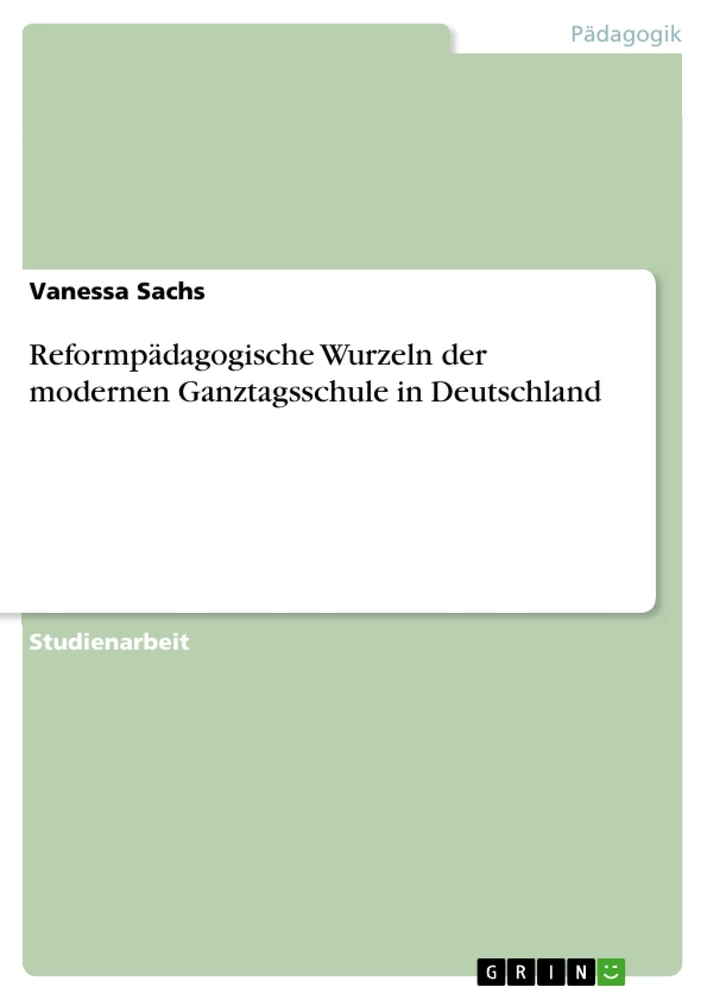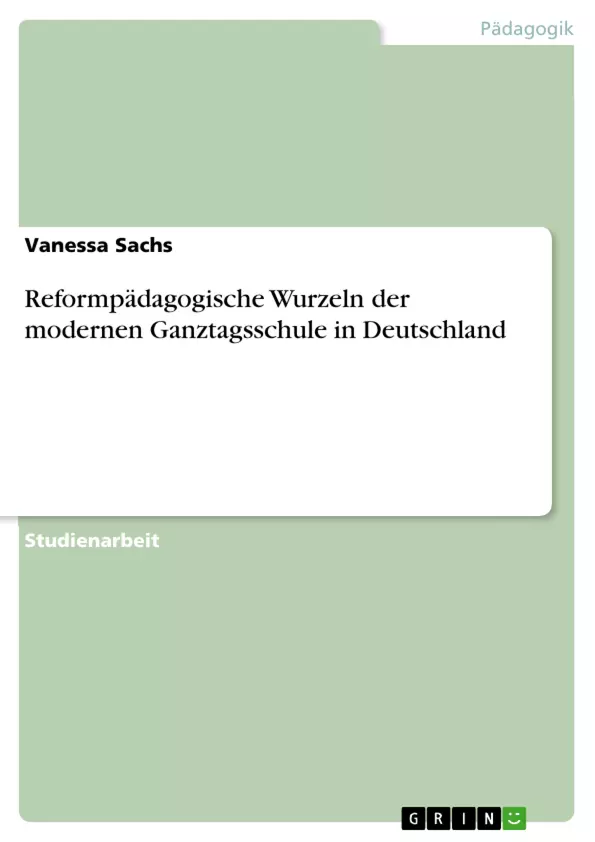Es lohnt sich einen Blick dorthin zu werfen, wo die Wurzeln der modernen Konzeption der heutigen Ganztagsschule liegen: und die reichen in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert zurück, erstrecken sich ab da von der klassischen Ganztagsschule, die noch weit entfernt vom Bestreben der heutigen Schulpädagogen zu sehen ist, über die deutsche Vormittagsschule bis zu den Reformschulen des 20. Jahrhunderts, die bereits richtungsweisend für die Entwicklung der modernen Ganztagschule waren.
Letztere sollen deshalb auch den inhaltlichen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden. Welchen Einfluss diese Reformschulen auf die aktuelle Diskussion um die moderne Ganztagsschule, wie wir sie im Schulpädagogik-Seminar in ihren Grundzügen mittlerweile kennengelernt haben, haben und inwiefern die Wurzeln dieser Einflüsse auch mit einem kritischen Auge zu sehen sind, soll im Folgenden erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Ein Blick auf heute
- Die historischen Ursprünge der Ganztagsschule
- Die klassische Ganztagsschule im 19. Jahrhundert
- Die Entwicklung zur Vormittagsschule
- Internationale Entwicklung
- Bestrebungen der deutschen Reformpädagogen
- Umriss der Reformpädagogik allgemein
- Deutsche Reformpädagogik
- Reformpädagogische Wurzeln der modernen Ganztagsschule
- Deutsche Landerziehungsheime
- LIETZ
- WYNEKEN
- PAUL GEHEEB
- Die kritische Seite der „neuen Erziehung"
- Einfluss auf die Konzeption der heutigen Ganztagsschule
- Folgen für die Reformpädagogik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den historischen Ursprüngen der modernen Ganztagsschule in Deutschland. Sie untersucht die Entwicklung der Ganztagsschule vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und beleuchtet dabei insbesondere den Einfluss der deutschen Reformpädagogik auf die Konzeption der heutigen Ganztagsschule. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Phasen der Schulentwicklung, die Rolle der Reformpädagogik und die kritischen Aspekte der „neuen Erziehung".
- Die historische Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland
- Der Einfluss der deutschen Reformpädagogik auf die Ganztagsschule
- Die kritische Seite der „neuen Erziehung" und ihre Auswirkungen
- Die Relevanz der historischen Wurzeln für die heutige Ganztagsschule
- Die Folgen der Reformpädagogik für die Schulentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der Ganztagsschule in Deutschland und beleuchtet die Hoffnungen und Erwartungen, die mit diesem Modell verbunden sind. Es werden die verschiedenen Faktoren, die den Erfolg der Ganztagsschule beeinflussen, wie z.B. die Rolle der Schüler, Lehrer und Familien, vorgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den historischen Ursprüngen der Ganztagsschule in Deutschland. Es wird die klassische Ganztagsschule des 19. Jahrhunderts, die sich durch eine geteilte Unterrichtszeit und eine starke Betonung der familiären Erziehung auszeichnete, vorgestellt. Anschließend wird die Entwicklung zur Vormittagsschule im späten 19. Jahrhundert beschrieben, die durch die veränderten sozialen Bedingungen und die wachsende Bedeutung der Kinderarbeit geprägt war.
Das dritte Kapitel widmet sich den Bestrebungen der deutschen Reformpädagogen. Es wird ein Überblick über die Reformpädagogik allgemein gegeben und die wichtigsten Vertreter der deutschen Reformpädagogik, wie z.B. Hermann Lietz, Gustav Wyneken und Paul Geheeb, vorgestellt.
Das vierte Kapitel untersucht die reformpädagogischen Wurzeln der modernen Ganztagsschule. Es werden die deutschen Landerziehungsheime, die als Vorbilder für die heutige Ganztagsschule gelten, näher betrachtet.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der kritischen Seite der „neuen Erziehung". Es werden die Missbrauchsvorwürfe gegen die Odenwaldschule und die damit verbundenen Fragen nach der Verantwortung der Reformpädagogik diskutiert.
Das sechste Kapitel analysiert den Einfluss der Reformpädagogik auf die Konzeption der heutigen Ganztagsschule. Es werden die wichtigsten Elemente der Reformpädagogik, die in der modernen Ganztagsschule wiederzufinden sind, wie z.B. die Betonung der Ganzheitlichkeit, die Förderung der Selbstständigkeit und die Bedeutung der Gemeinschaft, vorgestellt.
Das siebte Kapitel beleuchtet die Folgen der Reformpädagogik für die Schulentwicklung. Es werden die Herausforderungen und Chancen der modernen Ganztagsschule im Kontext der Reformpädagogik diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ganztagsschule, die historische Entwicklung der Schule, die deutsche Reformpädagogik, die Landerziehungsheime, die kritische Seite der „neuen Erziehung" und die Folgen der Reformpädagogik für die Schulentwicklung. Der Text beleuchtet die Wurzeln der modernen Ganztagsschule in Deutschland und analysiert den Einfluss der Reformpädagogik auf die Konzeption der heutigen Ganztagsschule.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegen die historischen Wurzeln der deutschen Ganztagsschule?
Die Wurzeln reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, über die klassische Ganztagsschule und die Vormittagsschule bis hin zu den Reformschulen des 20. Jahrhunderts.
Welchen Einfluss hatte die Reformpädagogik auf die moderne Ganztagsschule?
Die Reformpädagogik betonte Ganzheitlichkeit, Selbstständigkeit und Gemeinschaft – Elemente, die heute zentrale Bestandteile moderner Ganztagskonzepte sind.
Wer waren wichtige Vertreter der deutschen Reformpädagogik?
Zu den bedeutendsten Vertretern gehörten Hermann Lietz, Gustav Wyneken und Paul Geheeb, die unter anderem die Landerziehungsheime gründeten.
Was waren die „Landerziehungsheime“?
Dies waren reformpädagogische Internatsschulen, die als Vorbilder für die heutige Ganztagsschule gelten, da sie Leben und Lernen räumlich und zeitlich verbanden.
Welche kritischen Aspekte der Reformpädagogik werden erwähnt?
Die Arbeit thematisiert unter anderem die Missbrauchsvorwürfe gegen die Odenwaldschule und hinterfragt die Verantwortung der „neuen Erziehung“.
Warum entwickelte sich die Schule im 19. Jahrhundert zur Vormittagsschule?
Diese Entwicklung war durch veränderte soziale Bedingungen und die wachsende Bedeutung der Kinderarbeit im Zuge der Industrialisierung geprägt.
- Quote paper
- Vanessa Sachs (Author), 2014, Reformpädagogische Wurzeln der modernen Ganztagsschule in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288890