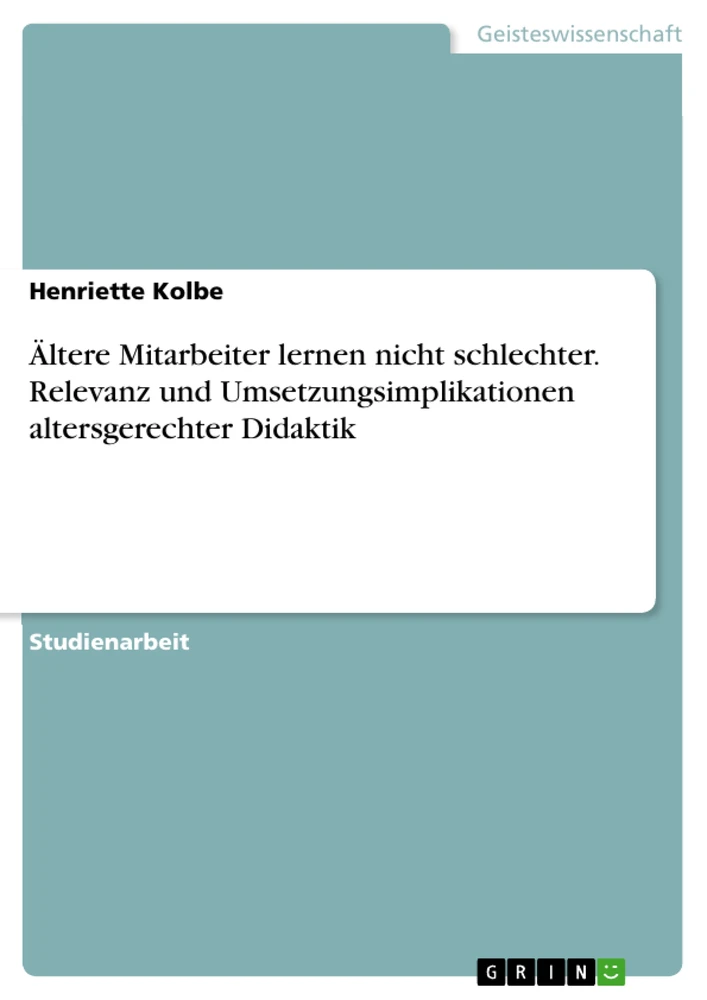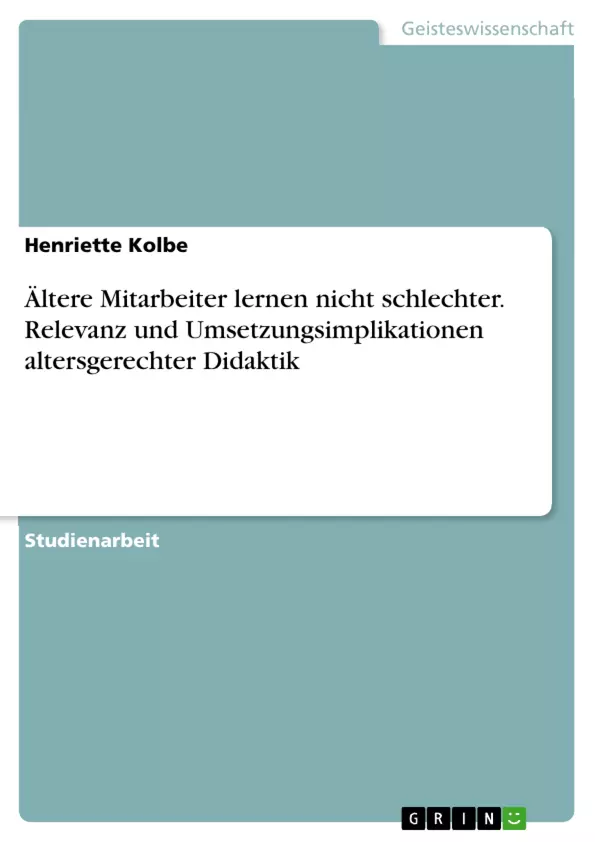Der Paragraph 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hat das Ziel, dass „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“ [Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz] sind.
Da eine Gleichbehandlung auch eine Diskriminierung beinhalten kann, werden unter §10 Ausnahmen wie besondere Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen in Anlehnung an die Berufserfahrung und Alter bestimmt, die betriebliche Vorteile mit sich bringen. Den Unternehmen kommt in Angesicht des Antidiskriminierungsgesetzes und der alternden Gesellschaft eine besondere Verantwortung zu. Sie müssen laut des Paragraphen für „besondere Bedingungen […] zur beruflichen Bildung“ sorgen. In Form von beispielsweise Weiterbildungen für ältere Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer müssen diese demnach auch altersgerecht aufgebaut sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangspunkt
- Wandel der gesellschaftlichen Altersstruktur
- Erwerbsbeteiligung
- Veränderungen im Alter
- Begriffsbestimmung ältere Arbeitnehmer
- Körperliche Leistungsfähigkeit
- Kognitive Leistungsfähigkeit
- Berufliche Leistungsfähigkeit
- Zusammenfassung
- Altersgerechte Didaktik
- Lernen im Alter
- Didaktische Prinzipien für Ältere
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Relevanz und Umsetzung von altersgerechter Didaktik im Kontext der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden Veränderungen in der Arbeitswelt. Ziel ist es, die Bedeutung des Alters für die Erwerbstätigkeit aufzuzeigen und die Notwendigkeit altersgerechter Weiterbildungsmaßnahmen zu beleuchten.
- Wandel der Altersstruktur in der Gesellschaft
- Einfluss der Altersstruktur auf die Erwerbsbeteiligung
- Veränderungen der körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit im Alter
- Anforderungen an altersgerechte Didaktik
- Bedeutung von Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel thematisiert den Wandel der gesellschaftlichen Altersstruktur und dessen Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung. Die zunehmende Überalterung der Gesellschaft durch den Anstieg der Lebenserwartung und den Rückgang der Geburtenrate führt zu einer veränderten Altersverteilung, in der ältere Menschen eine immer größere Rolle spielen.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Aspekte von Veränderungen im Alter erläutert, die für die Erwerbstätigkeit relevant sind. Hierzu zählen körperliche Leistungsfähigkeit, kognitive Leistungsfähigkeit und berufliche Leistungsfähigkeit. Es wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit im Alter nicht zwangsläufig abnimmt, sondern individuelle Unterschiede und Anpassungsfähigkeiten eine wichtige Rolle spielen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Bedeutung von altersgerechter Didaktik. Es werden die Besonderheiten des Lernens im Alter beleuchtet und didaktische Prinzipien vorgestellt, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Lernender zugeschnitten sind. Altersgerechte Didaktik sollte auf die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen älterer Arbeitnehmer Rücksicht nehmen und deren Lerneffizienz optimieren.
Schlüsselwörter
Altersgerechte Didaktik, Demografischer Wandel, Erwerbstätigkeit, Weiterbildung, Ältere Arbeitnehmer, Körperliche Leistungsfähigkeit, Kognitive Leistungsfähigkeit, Berufliche Leistungsfähigkeit, Lernmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Lernen ältere Mitarbeiter wirklich schlechter?
Nein, die Arbeit stellt klar, dass ältere Mitarbeiter nicht schlechter lernen, sondern dass sich lediglich die Art des Lernens und die Bedürfnisse an die Didaktik verändern.
Welche Rolle spielt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)?
Das AGG verbietet Diskriminierung aufgrund des Alters und verpflichtet Unternehmen, auch für ältere Arbeitnehmer angemessene Bedingungen zur beruflichen Bildung zu schaffen.
Was versteht man unter altersgerechter Didaktik?
Altersgerechte Didaktik passt Lernmethoden an die kognitive und berufliche Leistungsfähigkeit älterer Lerner an, indem sie z.B. stärker auf vorhandenes Erfahrungswissen aufbaut.
Wie verändert sich die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter?
Während die fluide Intelligenz (Verarbeitungsgeschwindigkeit) abnehmen kann, bleibt die kristalline Intelligenz (Erfahrungswissen, Wortschatz) oft stabil oder nimmt sogar zu.
Warum ist Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer heute so wichtig?
Aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels müssen Unternehmen das Potenzial ihrer alternden Belegschaft durch kontinuierliche Qualifizierung erhalten.
Welche didaktischen Prinzipien sollten für Ältere beachtet werden?
Wichtige Prinzipien sind Praxisnähe, die Möglichkeit zum selbstgesteuerten Lernen, eine angemessene Zeitstruktur und die Wertschätzung der bisherigen Berufserfahrung.
- Citation du texte
- Henriette Kolbe (Auteur), 2015, Ältere Mitarbeiter lernen nicht schlechter. Relevanz und Umsetzungsimplikationen altersgerechter Didaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288967