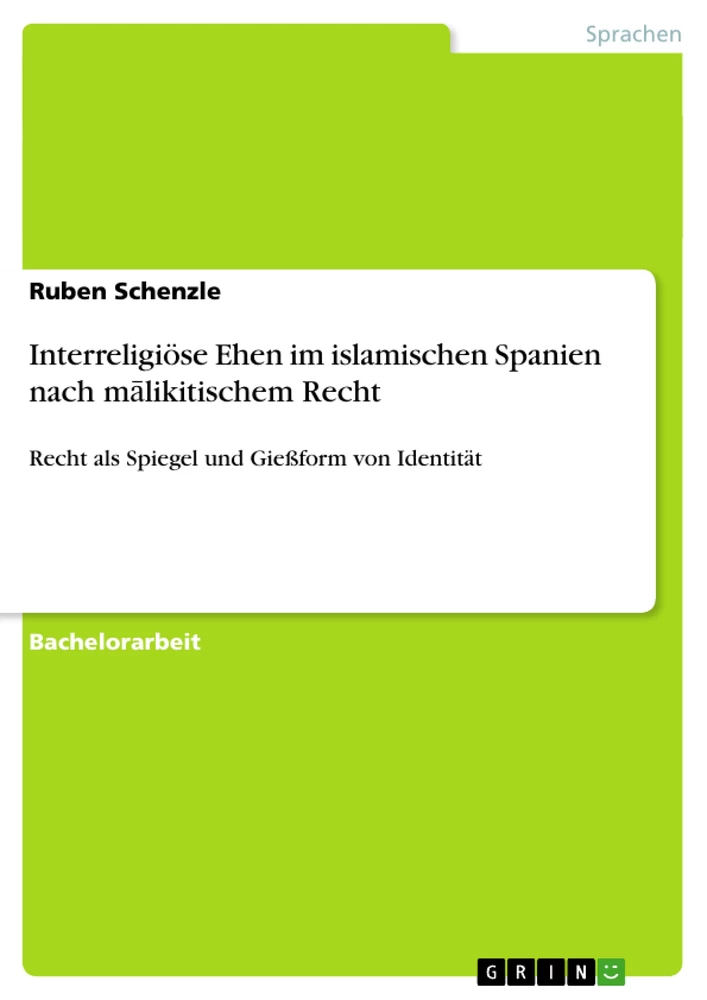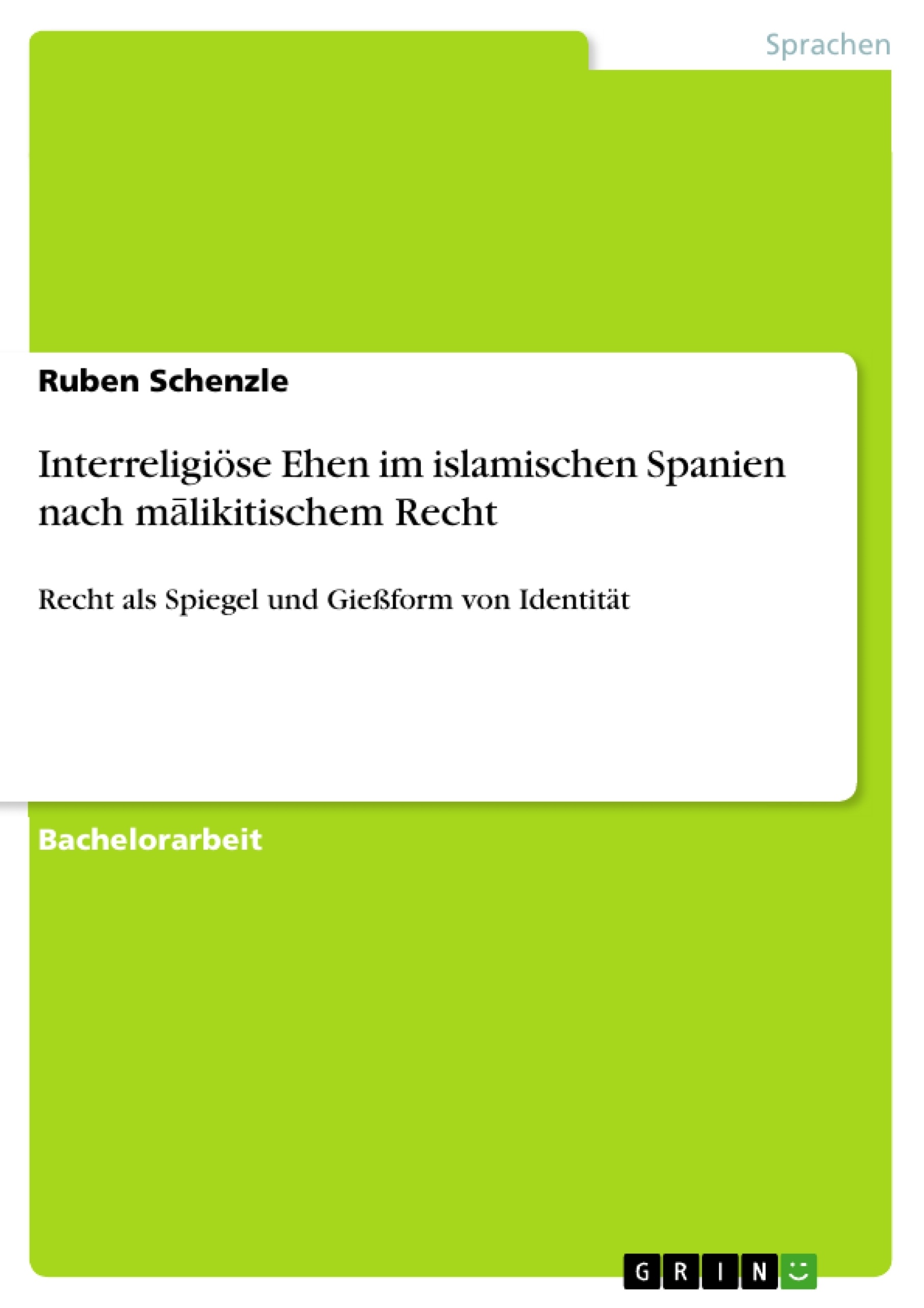Begibt man sich auf die Spurensuche nach dem viel zitierten Mythos des „goldenen Zeitalters der convivencia“ der muslimisch beherrschten heterogenen Gesellschaft von al-Andalus im 9.-11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, kommt der Rechtspraxis eine Schlüsselrolle zu. Dabei geht jedes Rechtssystem von einer Idealtypisierung der ihm unterstellten Individuen aus. In einer heterogenen Gesellschaft wie der andalusischen musste zwangsweise auch die dominierende islamische Jurisprudenz diese Vielfalt berücksichtigen und klar kategorisieren. In einem solchen Prozess bildet sich Identität als feststehendes Zugehörigkeitsattribut im Wechselspiel von Selbstreflexion und externer Kategorisierung aus. Ein Prozess, dem in dieser Arbeit auf den Grund gegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Identität als Begriff: Historisch fassbar?
- Muslime in al-Andalus
- Christen in al-Andalus
- Juden in al-Andalus
- III. Recht als Spiegel und Gießform von Identität.
- IV. Die Mālikīya: Rechtsschule von al-Andalus
- Interreligiöse Ehen in der mālikitischen Rechtstheorie
- Interreligiöse Ehen in der andalusischen Jurisprudenz
- Status der Ehe
- Die Brautgabe-ṣadāq
- Kinder und Nachkommen
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich das islamische Recht im mittelalterlichen Spanien (al-Andalus) auf die Identität der verschiedenen dort lebenden Religionsgruppen auswirkte, insbesondere im Kontext interreligiöser Ehen. Der Fokus liegt dabei auf der mālikitischen Rechtsschule, die in al-Andalus dominierte.
- Die Rekonstruktion des Alltags in al-Andalus anhand von rechtlichen Normen
- Die Rolle des Rechts als Spiegel und Gießform von Identität
- Die Auswirkung interreligiöser Ehen auf die Lebenswirklichkeit der Menschen in al-Andalus
- Die Rezeption und Anwendung des mālikitischen Rechts in al-Andalus
- Die Darstellung des Lebens der Muslime, Christen und Juden in al-Andalus und die Herausforderungen des Zusammenlebens
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einführung: Die Arbeit skizziert den historischen Kontext al-Andalus und beleuchtet die wissenschaftliche Debatte um den Begriff der Toleranz und die Bedeutung der multikulturellen Gesellschaft. Sie stellt die Forschungsfrage in den Mittelpunkt: Wie beeinflusste das islamische Recht die Identität der verschiedenen Religionsgruppen in al-Andalus?
- II. Identität als Begriff: Historisch fassbar?: Das Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und der historischen Entwicklung des Begriffs der Identität. Es werden die unterschiedlichen Lebenswelten der Muslime, Christen und Juden in al-Andalus beschrieben und die Frage nach der Bedeutung religiöser und kultureller Zugehörigkeit für die individuelle Identität aufgeworfen.
- III. Recht als Spiegel und Gießform von Identität: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Rechts in der Konstruktion von Identität. Es wird die Frage nach der Interaktion zwischen Recht und Gesellschaft erörtert und das Spannungsverhältnis zwischen individueller Selbstbestimmung und normativen Vorgaben beleuchtet.
- IV. Die Mālikīya: Rechtsschule von al-Andalus: Der Fokus liegt auf der mālikitischen Rechtsschule, die in al-Andalus dominierte. Es wird untersucht, wie interreligiöse Ehen in der mālikitischen Rechtstheorie und der andalusischen Jurisprudenz geregelt wurden. Die Themen Status der Ehe, Brautgabe und Kindererziehung werden behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern interreligiöse Ehen, Identität, mālikitisches Recht, al-Andalus, Islamisches Spanien, Kulturgeschichte, Geschichte der arabischen Halbinsel, Toleranz, Convivencia und multikulturelle Gesellschaft. Die zentralen Konzepte der Arbeit sind die Rezeption und Anwendung des islamischen Rechts im Kontext einer multikulturellen Gesellschaft, sowie die Frage nach dem Einfluss von Recht auf die Konstruktion von Identität.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "Convivencia" in al-Andalus?
Der Begriff beschreibt das Zusammenleben von Muslimen, Christen und Juden im mittelalterlichen islamischen Spanien, das oft als Zeitalter der Toleranz und kulturellen Vielfalt zitiert wird.
Welche Rolle spielte das mālikitische Recht in al-Andalus?
Die mālikitische Rechtsschule war die dominierende Jurisprudenz in al-Andalus. Sie kategorisierte die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und regelte deren rechtlichen Status sowie das soziale Miteinander.
Waren interreligiöse Ehen im islamischen Spanien erlaubt?
Ja, das islamische Recht erlaubte unter bestimmten Bedingungen Ehen zwischen muslimischen Männern und Frauen der "Buchreligionen" (Christen und Juden), wobei rechtliche Details wie die Brautgabe (ṣadāq) genau geregelt waren.
Wie beeinflusste das Recht die Identität der Menschen?
Das Recht fungierte als "Spiegel und Gießform" der Identität, indem es Zugehörigkeiten festschrieb und klare Regeln für den Status von Ehepartnern und Nachkommen in heterogenen Familien setzte.
Welchen Status hatten Kinder aus interreligiösen Ehen?
Nach islamischem Recht folgten Kinder aus Ehen eines muslimischen Vaters und einer christlichen oder jüdischen Mutter automatisch der Religion des Vaters, was die religiöse Identität der nächsten Generation festlegte.
Was ist die Bedeutung der Brautgabe (ṣadāq)?
Die ṣadāq war ein wesentlicher Bestandteil des Ehevertrags und diente der finanziellen Absicherung der Frau. Sie war auch in interreligiösen Verbindungen ein zentrales rechtliches Element.
- Arbeit zitieren
- Ruben Schenzle (Autor:in), 2012, Interreligiöse Ehen im islamischen Spanien nach mālikitischem Recht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288973