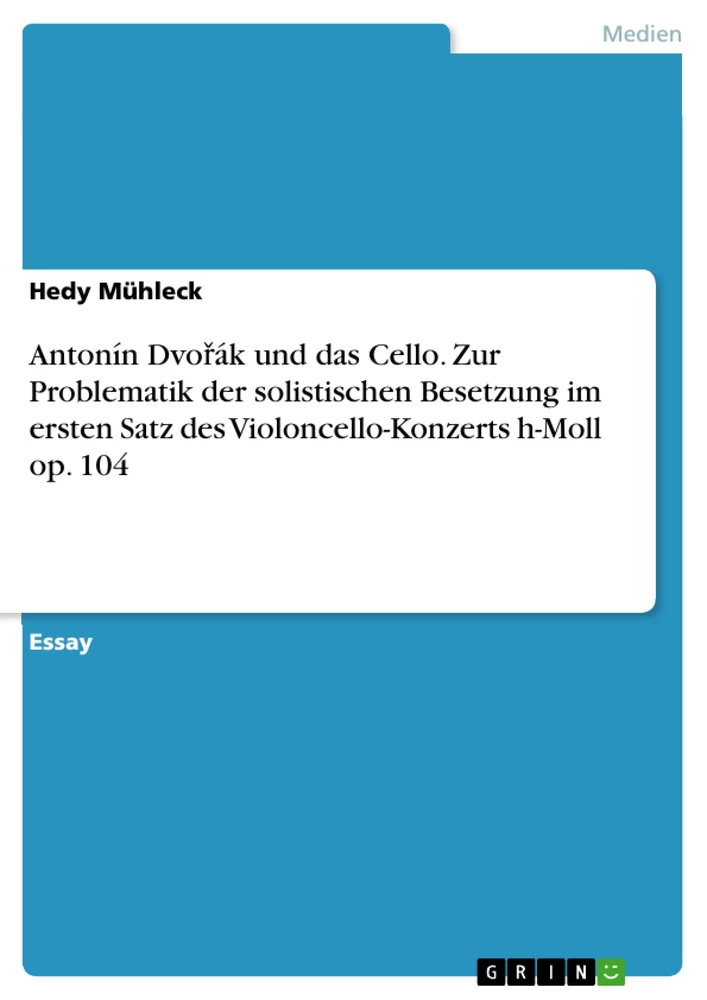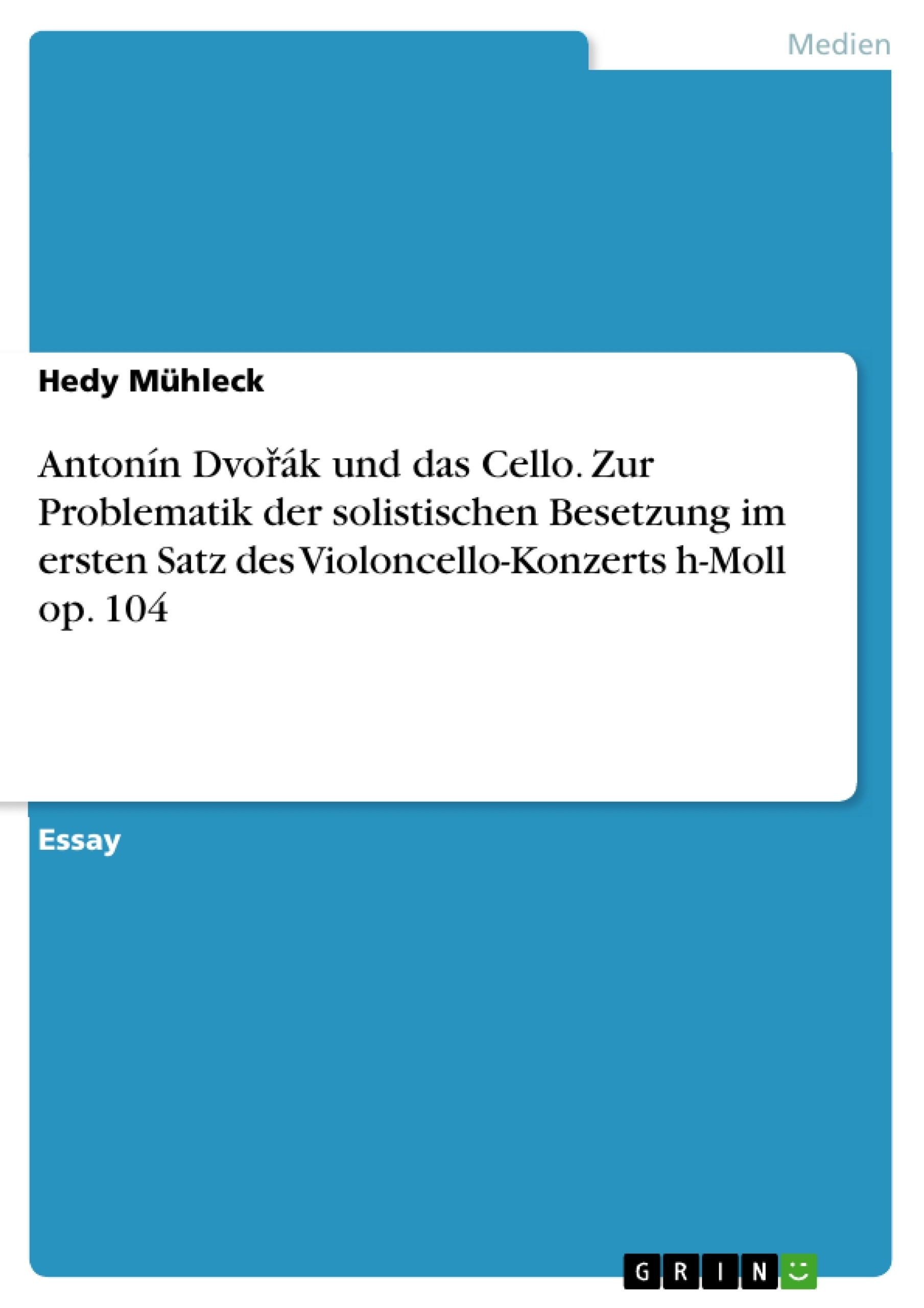Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Problematik der solistischen Besetzung im ersten Satz des Violoncello-Konzerts h-Moll op. 104 von Antonín Dvořák. Ziel ist es, anhand einer exemplarischen Analyse des ersten Satzes zu untersuchen, ob sich Dvořáks Äußerung über die klanglichen Mängel des Cellos als Soloinstrument durch die Komposition bestätigen lässt.
- Die Rolle des Cellos als Soloinstrument in Dvořáks Konzert
- Die klanglichen Eigenschaften des Cellos in der Komposition
- Dvořáks kompositorische Entscheidungen im Hinblick auf die Besetzung
- Die Bedeutung des Dialogs zwischen Soloinstrument und Orchester
- Die Virtuosität des Cellos im Konzert