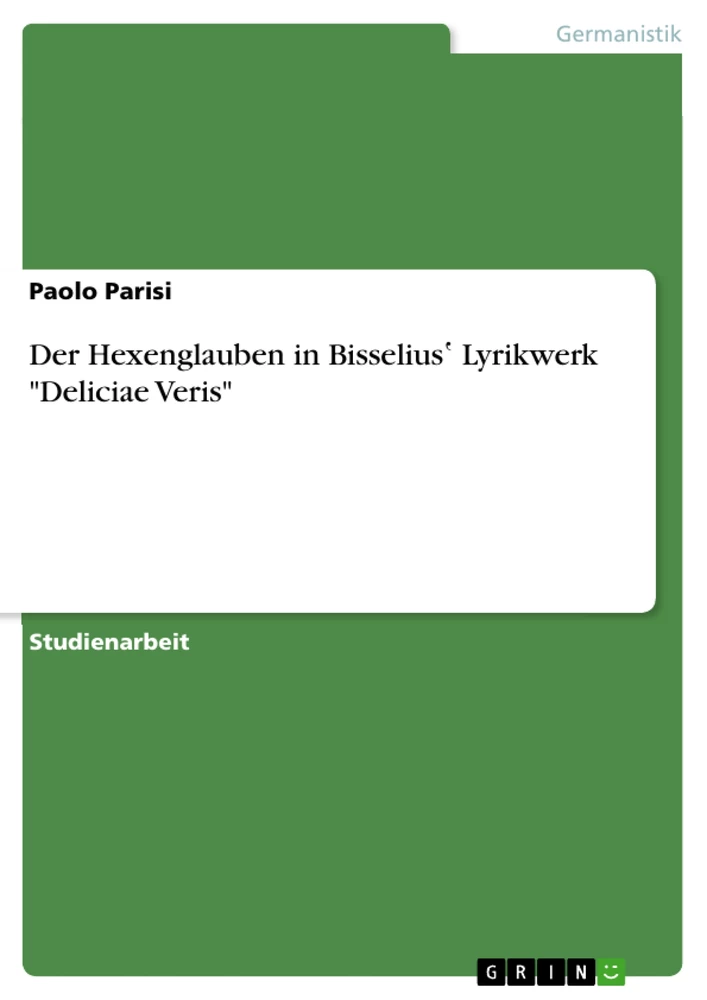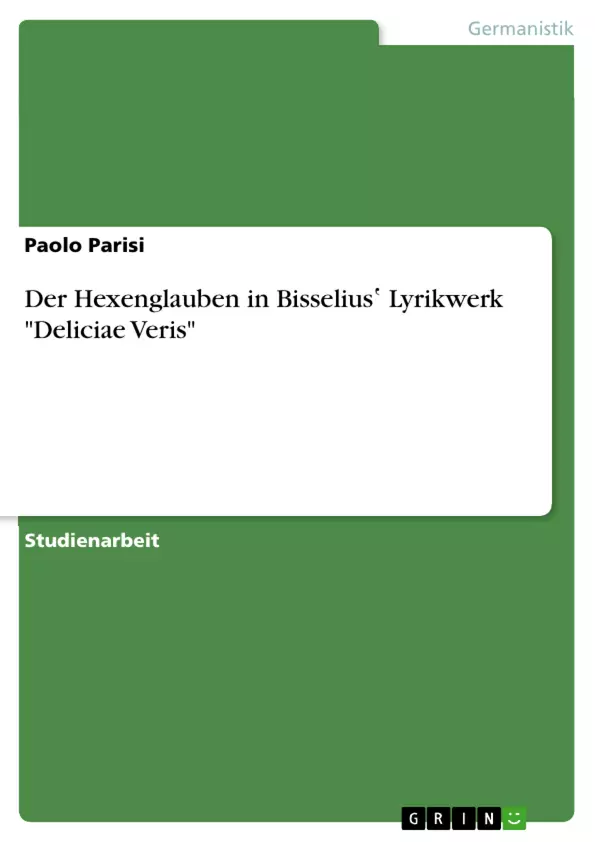Das lateinisch verfasste Lyrikwerk "Deliciae Veris" (1638, 1640), auf Deutsch ʼFrühlingsfreudenʽ, des oberschwäbischen Jesuiten Johannes Bisselius (1601-1682) ist thematisch, kompilatorisch und ästhetisch betrachtet als ein herausragender Elegien-Zyklus der deutschen neulateinischen Lyrik anzusehen, der gerade auch kulturhistorisch bedeutende Einblicke gewährt.
In der bisherigen Forschung zur bayerisch-schwäbischen Jesuitenkultur fand das Werk von Bisselius bisher nur beiläufig Erwähnung. So erschien erst im Jahre 2013 eine zufriedenstellend übersetzte und kommentierte Edition der "Deliciae Veris", die von Claren, Eickmeyer, Kühlmann und Wiegand herausgegeben wurde.
Die kompilatorische Eigenheit der "Deliciae Veris" besteht einerseits darin, dass die verschiedensten Themen wie Meteorologisches, Lokales, Flora und Fauna, Maria und Christus, Legenden und biblische Themen, Feiertage und Kirchengeschichte, Anekdoten und Schwankhaftes, und auch Persönliches, ja dies alles in einer Darstellung aufgenommen wurde, andererseits auch darin, dass einer Kompositionsstruktur nachgegangen wurde, die die gruppenbildenden Thematiken intratextuell miteinander in Beziehung bringt, die wiederum in ein großes Weltgedicht eingeflochten sind, das dennoch chronologisch fortschreitend wahrgenommen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Fragestellung
- Rezeption des Hexenwesens in der frühneuzeitlichen Literatur
- Hexenglauben in Bisselius' Deliciae Veris
- Elegie III,9 (Ein unheilvoller Spaziergang, der in Donnerschlägen und verzaubertem Hagel endete.)
- Realität und arkadische Fiktionalität
- Authentizitätsbekenntnis
- Volksnahe Vorstellungen und Aberglauben
- Legitimierte Bestrafung
- Elegie III, 10 (Historischen Charakters. Der Bäcker im Mehl.)
- Zur Hexensalbe und zum Hexenflug
- Die Hexenfahrt als Traum?
- Interpretationsansätze zum Hexenflug in Elegie III,10
- Zwischen Intertextualität zu Apuleius' Metamorphosen und mündlicher Tradition
- Elegie III,9 (Ein unheilvoller Spaziergang, der in Donnerschlägen und verzaubertem Hagel endete.)
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Hexenglauben in zwei Elegien (III,9 und III,10) des Werks "Deliciae Veris" von Johannes Bisselius. Ziel ist es, die in den Elegien dargestellten Vorstellungen zum Hexenglauben mit volksnahen Vorstellungen der damaligen Zeit zu vergleichen und die Zusammenhänge zwischen theologischen Konzepten und populären Aberglauben aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet, inwiefern die in den Elegien beschriebenen Elemente tatsächlich aus dem Volksglauben stammen oder durch theologische Traktate und Hexenverfolgungen geprägt wurden.
- Rezeption des Hexenglaubens in der frühneuzeitlichen Literatur
- Vergleich von theologischen Konzepten und Volksglauben zum Hexenwesen
- Analyse der Darstellung von Hexenglauben in Bisselius' Elegien
- Untersuchung der Intertextualität und der mündlichen Tradition im Kontext des Hexenglaubens
- Die Rolle der Hexenverfolgungen bei der Verbreitung von Aberglauben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Werk "Deliciae Veris" von Johannes Bisselius vor und hebt dessen kulturhistorische Bedeutung hervor. Sie betont die bisherige Forschungslücke bezüglich des Werks und die erst kürzlich erschienene kommentierte Edition. Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Elegien, die den damaligen Hexenglauben widerspiegeln, und kündigt die Untersuchung der Kohärenzen zwischen den dargestellten Vorstellungen und dem Volksglauben an. Die Einleitung definiert den Volksglauben als Bestandteil dieser Vorstellungen und betont den Einfluss der Theologie und der Hexenverfolgungen auf die Verbreitung des Aberglaubens.
Thematische Fragestellung: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage: Inwiefern können die in den Elegien dargestellten Vorstellungen als tatsächlich populär betrachtet werden, oder wurden sie durch die Hexenverfolgungen geprägt und verbreitet? Es wird die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen authentisch volkstümlichen Vorstellungen und theologisch beeinflussten Konzepten diskutiert. Beispiele wie Schadenzauber und Hexenflug werden als potenziell volkstümlich angesehen, während Teufelspakt und Teufelsbuhlschaft einen stärkeren theologischen Einfluss vermuten lassen. Die Kapitel erwähnt die Problematik dieser Unterscheidung und verweist auf relevante Forschungsliteratur.
Rezeption des Hexenwesens in der frühneuzeitlichen Literatur: Dieser Abschnitt befasst sich mit der literarischen Verarbeitung von Hexenglauben in dämonologischen Werken der frühen Neuzeit. Es wird argumentiert, dass diese Werke, die sowohl Faszination als auch Grauen hervorriefen, bestimmte literarische Stilmittel zur lehrreichen Unterhaltung einsetzten. Alliterationen, Sprachrhythmik, Satzschlangen und Übertreibungen werden als charakteristische Merkmale genannt. Das Beispiel von Nicolas Rémi wird herangezogen, um die Verbindung zwischen persönlicher Erfahrung, Volksglauben und der theologischen Interpretation zu illustrieren. Die Kapitel diskutiert den Synkretismus zwischen volkstümlichen und theologisch begründeten Vorstellungen und liefert Beispiele aus anderen Hexentraktaten.
Hexenglauben in Bisselius' Deliciae Veris: Dieser Abschnitt analysiert die Darstellung des Hexenglaubens in den Elegien III,9 und III,10. Die Analyse betrachtet die verschiedenen Aspekte des Hexenglaubens, wie sie in den Elegien gezeigt werden, und setzt sie in Beziehung zu den Ergebnissen der vorherigen Kapitel. Die detaillierte Untersuchung von Eleie III,9 und III,10 erfolgt im Unterkapitel, ohne hier den Inhalt explizit vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Hexenglaube, Volksglaube, frühneuzeitliche Literatur, Johannes Bisselius, Deliciae Veris, Elegien, Theologie, Dämonologie, Hexenverfolgungen, Volksnahe Vorstellungen, Aberglaube, Intertextualität, Mündliche Tradition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Deliciae Veris" von Johannes Bisselius
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung des Hexenglaubens in zwei Elegien (III,9 und III,10) des Werkes "Deliciae Veris" von Johannes Bisselius. Sie untersucht, inwieweit die in den Elegien dargestellten Vorstellungen authentisch volkstümlich sind oder durch theologische Konzepte und Hexenverfolgungen geprägt wurden.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern können die in den Elegien dargestellten Vorstellungen zum Hexenglauben als tatsächlich populär betrachtet werden, oder wurden sie durch die Hexenverfolgungen geprägt und verbreitet? Die Arbeit befasst sich auch mit der Schwierigkeit, authentisch volkstümliche Vorstellungen von theologisch beeinflussten Konzepten zu unterscheiden.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Rezeption des Hexenglaubens in der frühneuzeitlichen Literatur, Vergleich von theologischen Konzepten und Volksglauben zum Hexenwesen, Analyse der Darstellung von Hexenglauben in Bisselius' Elegien, Untersuchung der Intertextualität und mündlichen Tradition im Kontext des Hexenglaubens sowie die Rolle der Hexenverfolgungen bei der Verbreitung von Aberglauben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur thematischen Fragestellung, ein Kapitel zur Rezeption des Hexenwesens in der frühneuzeitlichen Literatur, ein Kapitel zum Hexenglauben in Bisselius' "Deliciae Veris" (mit Unterkapiteln zu den Elegien III,9 und III,10), einen Schluss und ein Literaturverzeichnis. Es gibt zudem eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Welche Aspekte des Hexenglaubens werden in den Elegien untersucht?
Die Analyse der Elegien III,9 und III,10 betrachtet verschiedene Aspekte des Hexenglaubens, darunter Realität und arkadische Fiktionalität, Authentizitätsbekenntnisse, volksnahe Vorstellungen und Aberglauben, legitimierte Bestrafung, Hexensalbe, Hexenflug, die Hexenfahrt als Traum und die Intertextualität zu Apuleius' Metamorphosen und mündlicher Tradition.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse der Elegien von Johannes Bisselius, sowie auf relevante Forschungsliteratur zur frühneuzeitlichen Literatur, Dämonologie, Hexenverfolgungen und dem Volksglauben der damaligen Zeit. Es wird auf die Problematik der Unterscheidung zwischen authentisch volkstümlichen Vorstellungen und theologisch beeinflussten Konzepten eingegangen und entsprechende Literatur zitiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen werden im Schluss der Arbeit dargelegt und sind in dieser FAQ-Zusammenfassung nicht explizit genannt.) Die Arbeit zielt darauf ab, die Zusammenhänge zwischen den in den Elegien dargestellten Vorstellungen zum Hexenglauben und dem damaligen Volksglauben aufzuzeigen und den Einfluss theologischer Konzepte und der Hexenverfolgungen zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hexenglaube, Volksglaube, frühneuzeitliche Literatur, Johannes Bisselius, Deliciae Veris, Elegien, Theologie, Dämonologie, Hexenverfolgungen, Volksnahe Vorstellungen, Aberglaube, Intertextualität, Mündliche Tradition.
- Quote paper
- Paolo Parisi (Author), 2014, Der Hexenglauben in Bisseliusʽ Lyrikwerk "Deliciae Veris", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288996