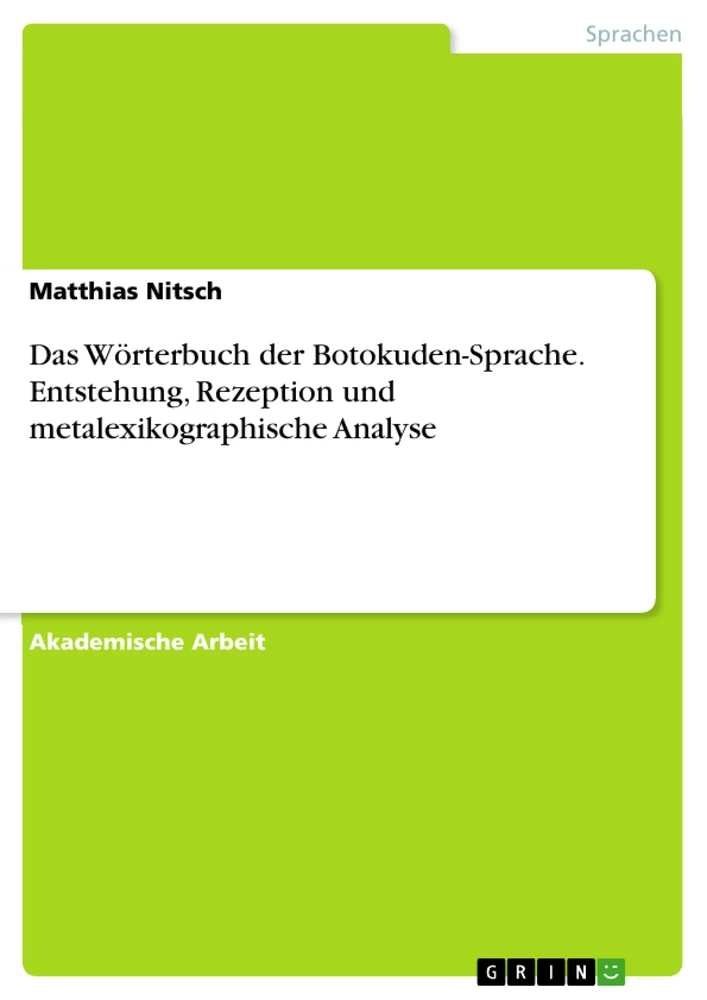Das Wörterbuch der Botokudensprache ist die umfassendste und in seiner Form außergewöhnlichste Quelle der Sprache einer indigenen Ethnie Südostbrasiliens. Es wurde von dem deutschen Apotheker und Brasilienauswanderer Bruno Rudolph an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verfasst, als die Botokuden bereits auszusterben drohten. Die einzigen Indigenen dieser Ethnie, die die europäische Kolonisation überlebt haben, gehören zur Botokuden-Subgruppe der Krenák, die heute nur noch über wenige hundert Angehörige und nicht mehr als eine Handvoll Sprecher verfügt. Ihnen konnten in einer feierlichen Zeremonie im Mai 2011 auch die sterblichen Überreste des Botokuden Quäck übergeben werden, den Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied vor fast 200 Jahren von seiner Brasilienreise mit nach Deutschland gebracht hatte (Melo/Pelli 2011; Pelli 2011).
Die Sprache der Botokuden wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts von einer Reihe von Forschern, meist europäischen Reisenden und Naturalisten, in Form von einfachen und knappen Wortlisten dokumentiert. Diese Wortlisten, von denen heute etwa 60 bekannt sind, teilen mit dem Wörterbuch das Schicksal, dass sie die Sprache der schriftlosen Kultur nur ungenau abbilden und deswegen nicht unmittelbar für weitere sprachwissenschaftliche Forschungen oder gar zur Revitalisierung der Botokudensprache eingesetzt werden können. Dies liegt daran, dass die ersten Erforscher der Botokudensprache weder ausgebildete Linguisten waren, noch auf eine hinreichend entwickelte Sprachwissenschaft zurückgreifen konnten. Erst die moderne Sprachwissenschaft stellt passende Instrumente und Methoden bereit, um etwa die Sprache exakt zu transkribieren und in ihrer Struktur adäquat zu analysieren.
In dieser Arbeit werden zunächst das Leben des Autors und der Entstehungskontext seines Werkes dargestellt. Dies geschieht unter der besonderen Berücksichtigung neu erschlossener Quellen. Dann wird untersucht, wie das Wörterbuch in der deutschen und brasilianischen Litera-tur rezipiert wurde. Es folgt eine metalexikographische Analyse mit speziellem Augenmerk auf den Umfang und die Struktur des Wörterverzeichnisses. Schließlich wird auf die Defizite des Wörterbuchs eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Neue Forschungsergebnisse zum Autor und Entstehungskontext
- 2.1 Der Autor Bruno Rudolph
- 2.2 Der Entstehungskontext
- 3 Die Rezeption des Wörterbuchs
- 4 Die metalexikographische Analyse des Wörterbuchs
- 5 Defizite des Wörterbuchs der Botokudensprache
- 5.1 Graphie und Transkription
- 5.2 Morphologie und Segmentierung
- 5.3 Semantik und Übersetzung
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
- Anhang
- Anhang 1 Karten
- Anhang 1.1 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Nimuendajú)
- Anhang 1.2 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Loukotka)
- Anhang 1.3 Die Kolonien am Mucuri
- Anhang 2 Fotografien der Botokuden
- Anhang 3 Bildmaterial zum Wörterbuch der Botokudensprache
- Anhang 3.1 Titelblatt des Wörterbuchs und Todesanzeige von Bruno Rudolph
- Anhang 3.2 Signatur von Bruno Rudolph
- Anhang 3.3 Ausschnitt aus dem Wörterbuch der Botokudensprache
- Anhang 4 Listen zu Sachgebieten im Wörterbuch der Botokudensprache
- Anhang 4.1 Einige Bezeichnungen der Botokuden im Wörterbuch
- Anhang 4.2 Hydronyme im Wörterbuch der Botokudensprache
- Anhang 4.3 Sprachvergleiche im Wörterbuch der Botokudensprache
- Anhang 1 Karten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wörterbuch der Botokudensprache, das von Bruno Rudolph im späten 19. Jahrhundert verfasst wurde. Ziel ist es, die Entstehung, Rezeption und metalexikographische Analyse des Wörterbuchs zu untersuchen. Dabei werden die Defizite des Wörterbuchs im Hinblick auf Graphie, Morphologie, Segmentierung und Semantik beleuchtet.
- Entstehung und Kontext des Wörterbuchs
- Rezeption des Wörterbuchs in der Forschung
- Metalexikographische Analyse des Wörterbuchs
- Defizite des Wörterbuchs in Bezug auf Graphie, Morphologie, Segmentierung und Semantik
- Bedeutung des Wörterbuchs für die Erforschung der Botokudensprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Wörterbuch der Botokudensprache als eine einzigartige Quelle für die Erforschung der Sprache dieser indigenen Ethnie vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Wörterbuchs im Kontext des Aussterbens der Botokudensprache und der unzureichenden Dokumentation der Sprache durch frühere Forscher. Das Kapitel 2 widmet sich der Biografie des Autors Bruno Rudolph und dem Entstehungskontext des Wörterbuchs. Es beleuchtet die Lebensumstände Rudolphs, seine Motivation zur Erstellung des Wörterbuchs und die Herausforderungen, denen er sich im Kontext der europäischen Kolonisation und des Aussterbens der Botokuden gegenüber sah. Kapitel 3 analysiert die Rezeption des Wörterbuchs in der Forschung. Es untersucht, wie das Wörterbuch von Linguisten und Ethnologen genutzt wurde und welche Kritikpunkte an ihm geäußert wurden. Kapitel 4 befasst sich mit der metalexikographischen Analyse des Wörterbuchs. Es untersucht die Struktur, Organisation und den Aufbau des Wörterbuchs und analysiert die verwendeten Methoden und Prinzipien. Kapitel 5 beleuchtet die Defizite des Wörterbuchs der Botokudensprache. Es analysiert die Schwächen des Wörterbuchs in Bezug auf Graphie, Morphologie, Segmentierung und Semantik und diskutiert die Auswirkungen dieser Defizite auf die sprachwissenschaftliche Forschung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Wörterbuch der Botokudensprache, Bruno Rudolph, Botokuden, indigene Sprache, Sprachdokumentation, metalexikographie, Defizite, Graphie, Morphologie, Segmentierung, Semantik, Sprachwissenschaft, Brasilien, Geschichte, Ethnologie, Kultur, Aussterben.
Häufig gestellte Fragen
Wer verfasste das Wörterbuch der Botokuden-Sprache?
Das Wörterbuch wurde von dem deutschen Apotheker und Auswanderer Bruno Rudolph an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verfasst.
Wer waren die Botokuden?
Die Botokuden waren eine indigene Ethnie in Südostbrasilien. Heute existieren nur noch wenige Angehörige der Subgruppe Krenák.
Warum ist dieses Wörterbuch wissenschaftlich so bedeutend?
Es ist die umfassendste Quelle einer heute fast ausgestorbenen Sprache, die zuvor nur in knappen Wortlisten von Reisenden dokumentiert wurde.
Welche Defizite weist das Wörterbuch auf?
Da Rudolph kein Linguist war, gibt es Mängel in der Graphie (Rechtschreibung), der Morphologie (Wortaufbau) und der exakten semantischen Übersetzung.
Kann das Wörterbuch zur Revitalisierung der Sprache genutzt werden?
Nur bedingt. Aufgrund der ungenauen Transkription muss es erst mit modernen sprachwissenschaftlichen Methoden analysiert und aufbereitet werden.
Was bedeutet Metalexikographie in diesem Zusammenhang?
Metalexikographie ist die wissenschaftliche Untersuchung von Wörterbüchern selbst – also die Analyse ihres Aufbaus, ihrer Struktur und ihrer Entstehungsgeschichte.
- Quote paper
- Matthias Nitsch (Author), 2013, Das Wörterbuch der Botokuden-Sprache. Entstehung, Rezeption und metalexikographische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289064