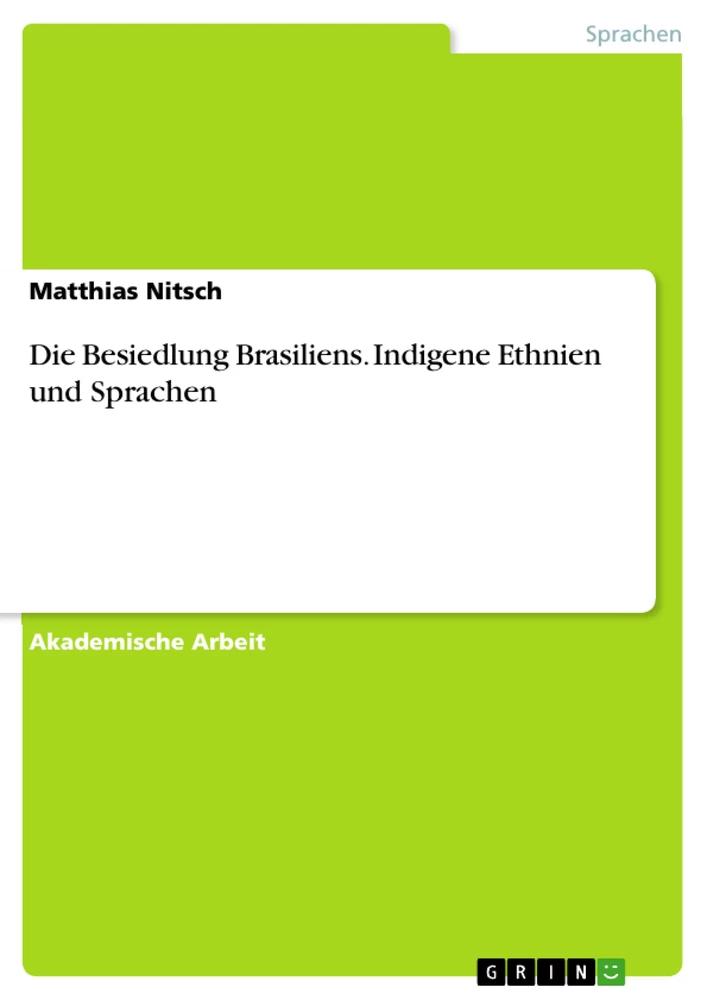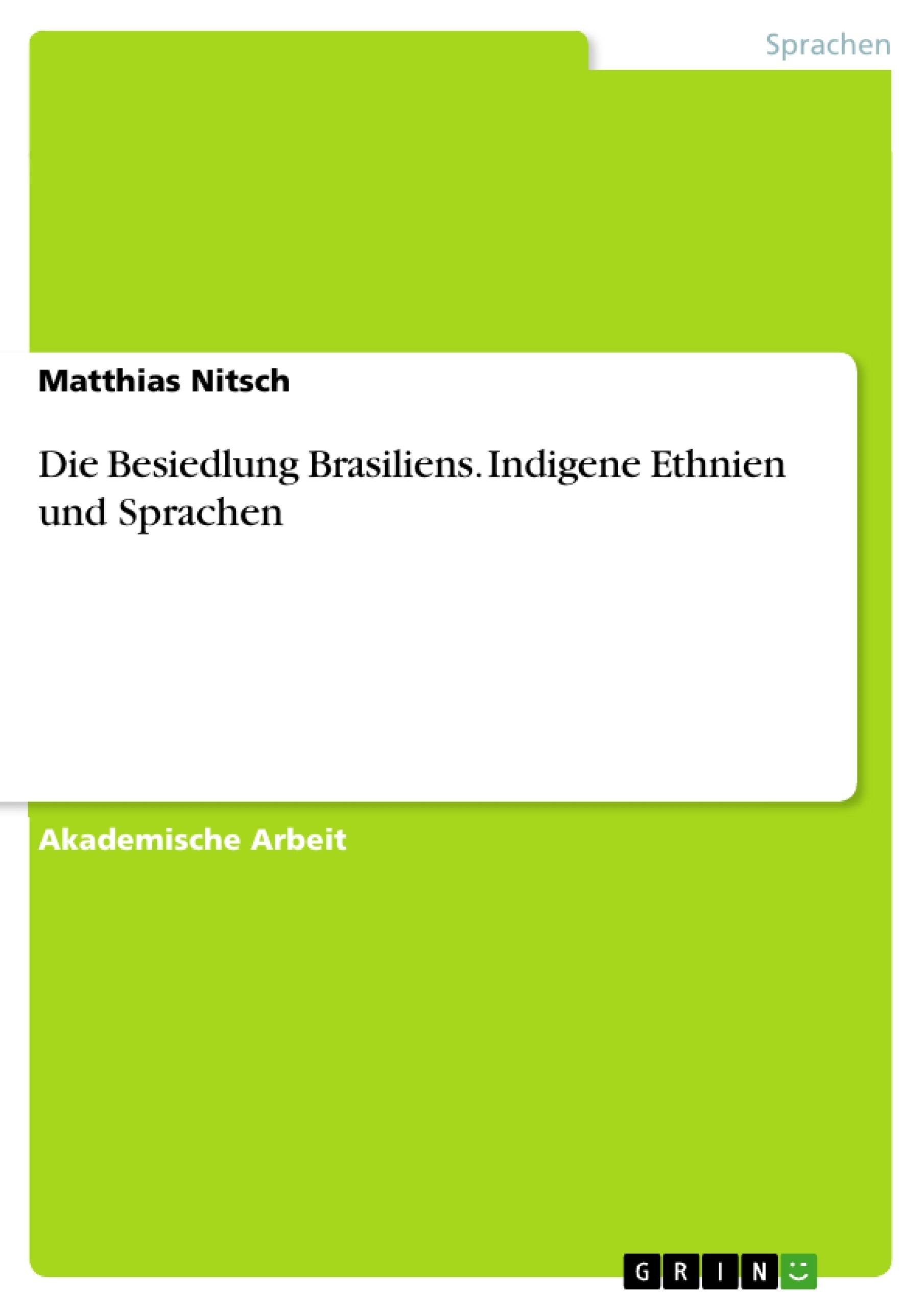Bei der Ankunft der Europäer in Brasilien im Jahre 1500 war der Kontinent nicht leer, sondern seit tausenden von Jahren vollständig besiedelt. Wann genau wie viele Völker über welche Route Amerika erreichten, ist seit langem umstritten. Angesichts neuer Erkenntnisse muss die aus den 1950er Jahren stammende Annahme, wonach nur eine Gruppe von Siedlern erst vor 12 000 Jahren über den Beringia-Landweg kam und die Clovis-Kultur begründete, überdacht werden. Vieles spricht indes dafür, dass bereits vor 70 000 Jahren mindestens zwei Völker auf unterschiedlichen Wegen einwanderten. Archäologische Funde aus Südamerika, insbesondere Brasilien, scheinen dies zu belegen. Sie deuten auf eine 60 000 Jahre alte menschliche Präsenz im Bundesstaat Piauí hin. Eine Besiedelung des südlichen Minas Gerais erfolgte vor ca. 30 000 Jahren.
In dieser Arbeit wird ein genereller Überblick zu den indigenen Ethnien und Sprachen in Brasilien gegeben. Ausgangspunkt bildet die Besiedlung Südamerikas und die damit verbundenen Besonderheiten bei der Herausbildung indigener Sprachen. Anschließend wird deren Erforschung und weitgehende Vernichtung thematisiert und schließlich ihre heutige Situation beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ursprünge der Besiedelung und Sprachentwicklung
- 2 Die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen
- 3 Die Vernichtung und heutige Situation indigener brasilianischer Sprachen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Besiedlung Brasiliens und die Entwicklung sowie den derzeitigen Zustand der indigenen Sprachen. Es werden die Ursprünge der Besiedlung, die Herausforderungen der sprachwissenschaftlichen Forschung und die Bedrohung der indigenen Sprachen beleuchtet.
- Ursprünge der Besiedlung Brasiliens und die damit verbundene Sprachentwicklung
- Die Geschichte der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen
- Die Herausforderungen der Klassifizierung indigener Sprachen
- Der aktuelle Zustand und die Gefährdung indigener Sprachen Brasiliens
- Die Rolle der Botokudensprache im Kontext der sprachlichen Vielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
1 Ursprünge der Besiedelung und Sprachentwicklung: Das Kapitel behandelt die frühe Besiedlung Brasiliens, widerlegt die bis in die 1950er Jahre gängige Theorie einer einzigen Migrationswelle über Beringia vor 12.000 Jahren und präsentiert archäologische Funde, die auf eine deutlich frühere Besiedlung hinweisen, sogar bis vor 70.000 Jahren. Die Entdeckung des "Luzia"-Skeletts spielt eine wichtige Rolle, da sie eine australo-melanesische Schädelmorphologie aufweist und die Annahme einer Besiedlung durch mindestens zwei verschiedene Völkergruppen unterstützt. Die Verbindung zwischen Luzia und den Botokuden wird hergestellt, und der Einfluss der geographischen Isolation Südamerikas auf die Sprachentwicklung und -vielfalt wird hervorgehoben. Die einzigartige typologische und genetische Vielfalt indigener brasilianischer Sprachen, einschließlich der Botokudensprache mit ihren seltenen stimmlosen Nasalkonsonanten, wird detailliert beschrieben. Die Eingliederung der Botokudensprache in den Macro-Jê Sprachstamm wird ebenfalls thematisiert.
2 Die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen: Dieses Kapitel gliedert die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen in fünf Phasen. Es beginnt mit den Bemühungen europäischer Missionare ab Mitte des 16. Jahrhunderts, die durch eine Reihe von Problemen gekennzeichnet waren, inklusive der Verallgemeinerungen und Fehlinterpretationen aufgrund der Fokussierung auf die Tupí-Guaraní-Sprachen an der Küste. Die "Hypervalorisation des Tupí" und die daraus resultierende Vernachlässigung anderer Sprachen werden kritisiert. Trotz der methodischen Schwächen wird die Bedeutung der frühen Missionare für die Dokumentation indigener Sprachen hervorgehoben, mit Beispielen wie den Grammatiken von Anchieta, Figueira und Mamiani. Die spätere Fortsetzung dieser Forschung durch brasilianische Gelehrte wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Indigene Sprachen Brasiliens, Besiedlung Brasiliens, Sprachentwicklung, Sprachfamilien, Tupí, Macro-Jê, Botokudensprache, Sprachforschung, Kolonialismus, Ethnologie, Archäologie, Luzia.
Häufig gestellte Fragen zu: Ursprünge der Besiedelung Brasiliens und die Entwicklung indigener Sprachen
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Besiedlung Brasiliens und die Entwicklung sowie den aktuellen Zustand der indigenen Sprachen Brasiliens. Er behandelt die Ursprünge der Besiedlung, die Herausforderungen der sprachwissenschaftlichen Forschung und die Bedrohung der indigenen Sprachen. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Ursprünge der Besiedlung Brasiliens und die damit verbundene Sprachentwicklung, die Geschichte der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen, die Herausforderungen der Klassifizierung dieser Sprachen, der aktuelle Zustand und die Gefährdung indigener Sprachen Brasiliens sowie die Rolle der Botokudensprache im Kontext der sprachlichen Vielfalt.
Wie wird die frühe Besiedlung Brasiliens dargestellt?
Das erste Kapitel widerlegt die bis in die 1950er Jahre gängige Theorie einer einzigen Migrationswelle über Beringia vor 12.000 Jahren. Archäologische Funde, die auf eine deutlich frühere Besiedlung hindeuten (bis vor 70.000 Jahren), werden präsentiert. Die Entdeckung des "Luzia"-Skeletts mit seiner australo-melanesischen Schädelmorphologie unterstützt die Annahme einer Besiedlung durch mindestens zwei verschiedene Völkergruppen. Die Verbindung zwischen Luzia und den Botokuden wird hergestellt, und der Einfluss der geographischen Isolation Südamerikas auf die Sprachentwicklung und -vielfalt wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Botokudensprache?
Die Botokudensprache wird als Beispiel für die einzigartige typologische und genetische Vielfalt indigener brasilianischer Sprachen hervorgehoben. Ihre seltenen stimmlosen Nasalkonsonanten werden detailliert beschrieben, ebenso wie ihre Eingliederung in den Macro-Jê Sprachstamm. Sie dient als Fallstudie für die sprachliche Vielfalt Brasiliens.
Wie wird die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen beschrieben?
Die Erforschung wird in fünf Phasen gegliedert, beginnend mit den Bemühungen europäischer Missionare ab Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Schwierigkeiten dieser frühen Forschung, einschließlich der Verallgemeinerungen und Fehlinterpretationen aufgrund der Fokussierung auf die Tupí-Guaraní-Sprachen, werden kritisiert. Die Bedeutung der frühen Missionare für die Dokumentation indigener Sprachen wird dennoch hervorgehoben, ebenso wie die spätere Fortsetzung dieser Forschung durch brasilianische Gelehrte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Indigene Sprachen Brasiliens, Besiedlung Brasiliens, Sprachentwicklung, Sprachfamilien, Tupí, Macro-Jê, Botokudensprache, Sprachforschung, Kolonialismus, Ethnologie, Archäologie, Luzia.
Welche Sprachen werden im Text erwähnt?
Der Text konzentriert sich auf indigene Sprachen Brasiliens, wobei besonders die Tupí-Guaraní-Sprachen und die Botokudensprache im Detail behandelt werden. Der Macro-Jê Sprachstamm wird ebenfalls erwähnt.
Welche Herausforderungen werden in Bezug auf die indigenen Sprachen Brasiliens genannt?
Der Text hebt die Herausforderungen der Klassifizierung indigener Sprachen hervor und betont den aktuellen Zustand und die Gefährdung dieser Sprachen durch Kolonialismus und andere Faktoren.
- Citar trabajo
- Matthias Nitsch (Autor), 2013, Die Besiedlung Brasiliens. Indigene Ethnien und Sprachen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289066