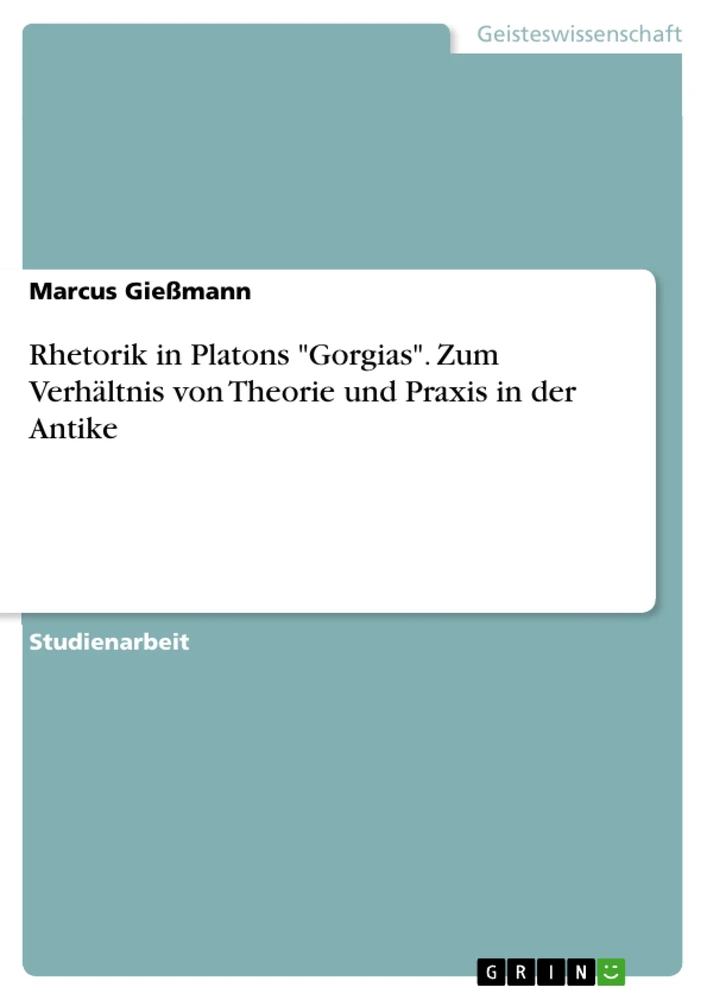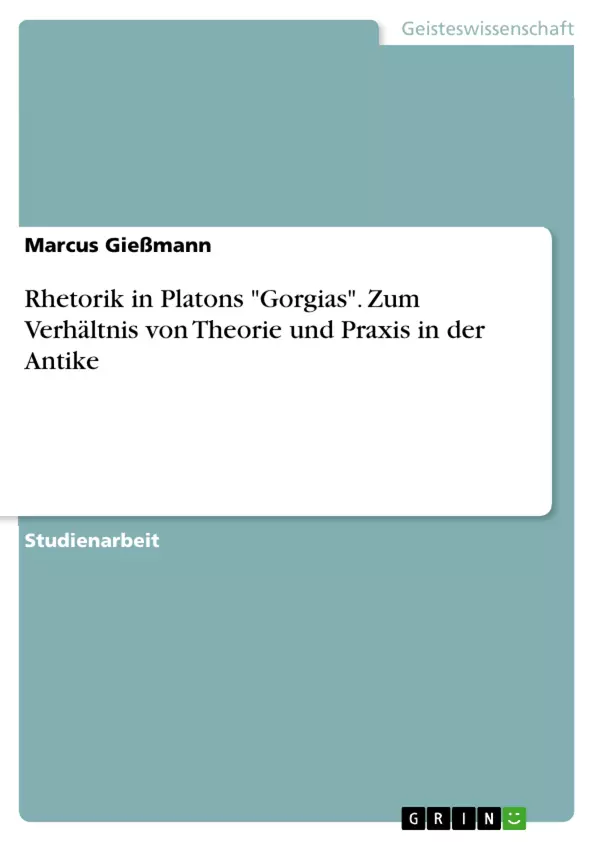500 v. Chr. bildeten sich in Indien, China und Griechenland erstmals Disziplinen aus, die wir als Philosophien bezeichnen. Wo sich in Indien das Denken innerhalb dieser Disziplin mehr um theoretische Sachverhalte drehte, wie z.B. die „Rätselhaftigkeit des Lebens und der Seele“, da war das Denken in China mehr von einem praktischen Interesse geprägt, z.B. wie Menschen am besten miteinander leben können.
Die Griechen nahmen von Beginn an sowohl theoretische als auch praktische Elemente in ihre Philosophie auf.
Möchte man das Verhältnis von Theorie und Praxis untersuchen, so ist es sinnvoll, sich mit griechischer Philosophie zu beschäftigen.
Auf den ersten Blick scheint es sich bei Theorie und Praxis um zwei disparate Bereiche zu handeln, deren Gegenstandsbereich klar voneinander abgegrenzt ist. Betrachtet man die Begrifflichkeiten von Theorie und Praxis jedoch etwas genauer, so wird schnell ersichtlich, dass sich eine strikte Trennung der beiden entweder als problematisch erweist oder letztlich gar nicht durchzuhalten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Traditionelle Rhetorik
- Philosophische Rhetorik
- Platons Theoriebegriff: epistéme
- Platons Praxisbegriff: Handeln
- techne
- Erster Schritt in der Begründung von These (A): Warum ist philosophische Rhetorik eine techne?
- Zweiter Schritt in der Begründung von These (A): Scham als mittelbarer Übergang von Theorie zur Praxis
- Begründung von These (B): Philosophische Rhetorik kann Theorie und Praxis zugleich sein
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Theorie und Praxis in der Antike anhand des Begriffs der Rhetorik in Platons Gorgias. Das Ziel ist es, zu zeigen, dass eine strikte Trennung von Theorie und Praxis nicht durchzuhalten ist und dass philosophische Rhetorik als techne sowohl Theorie als auch Praxis zugleich sein kann.
- Platons Theoriebegriff und Praxisbegriff im Kontext der antiken Philosophie
- Begriffsbestimmung der traditionellen und philosophischen Rhetorik
- Der Begriff der techne in Platons Gorgias und seine Bedeutung für das Verhältnis von Theorie und Praxis
- Scham als mittelbarer Übergang von Theorie zur Praxis
- Philosophische Rhetorik als Wissensinhalt, der zugleich auch Handlungsgrund ist
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Verhältnis von Theorie und Praxis in der antiken Philosophie dar und führt die zentrale These der Arbeit ein: Philosophische Rhetorik kann Theorie und Praxis zugleich sein.
- Das Kapitel „Begriffsbestimmung“ definiert die traditionelle und philosophische Rhetorik, beleuchtet Platons Theorie- und Praxisbegriff sowie den Begriff der techne.
- Das Kapitel „Erster Schritt in der Begründung von These (A): Warum ist philosophische Rhetorik eine techne?“ zeigt, dass es einen Mittelbegriff zwischen Theorie und Praxis gibt, der sowohl Anteil am Bereich der Theorie als auch Anteil am Bereich der Praxis hat.
- Das Kapitel „Zweiter Schritt in der Begründung von These (A): Scham als mittelbarer Übergang von Theorie zur Praxis“ erläutert, wie theoretische Gründe zu praktischen Gründen führen und dass praktische Überlegungen in einer Handlung resultieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der antiken Philosophie wie Theorie, Praxis, Rhetorik, techne, epistéme und Scham. Der Fokus liegt auf Platons Gorgias, einem Dialog, der sich mit der Frage nach dem richtigen Leben und der Rolle der Rhetorik in diesem Kontext auseinandersetzt.
Häufig gestellte Fragen
Welches Verhältnis von Theorie und Praxis wird in Platons „Gorgias“ untersucht?
Die Arbeit untersucht, ob Rhetorik eine bloße Fertigkeit (Praxis) oder ein auf Wissen basierendes System (Theorie) ist und wie diese Bereiche in der philosophischen Rhetorik verschmelzen.
Was bedeutet der Begriff „techne“ bei Platon?
Techne bezeichnet eine planvolle, auf Wissen (epistéme) beruhende Tätigkeit, die über bloße Erfahrung hinausgeht und ein Ziel (Ereignis) verfolgt.
Kann philosophische Rhetorik Theorie und Praxis zugleich sein?
Ja, die zentrale These der Arbeit lautet, dass philosophische Rhetorik ein Wissensinhalt ist, der gleichzeitig als unmittelbarer Handlungsgrund dient, wodurch die strikte Trennung aufgehoben wird.
Welche Rolle spielt die Scham im Gorgias-Dialog?
Scham wird als psychologischer Mechanismus analysiert, der den Übergang von der theoretischen Einsicht zur praktischen Handlung vermittelt.
Was ist der Unterschied zwischen traditioneller und philosophischer Rhetorik?
Traditionelle Rhetorik zielt auf Überredung und Schmeichelei ab, während philosophische Rhetorik auf der Erkenntnis des Gerechten und Guten basiert.
Warum ist die griechische Philosophie für dieses Thema so bedeutend?
Im Gegensatz zu rein theoretischen indischen oder rein praktischen chinesischen Denktraditionen versuchten die Griechen von Beginn an, beide Elemente in ihr Denken zu integrieren.
- Quote paper
- Marcus Gießmann (Author), 2014, Rhetorik in Platons "Gorgias". Zum Verhältnis von Theorie und Praxis in der Antike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289165