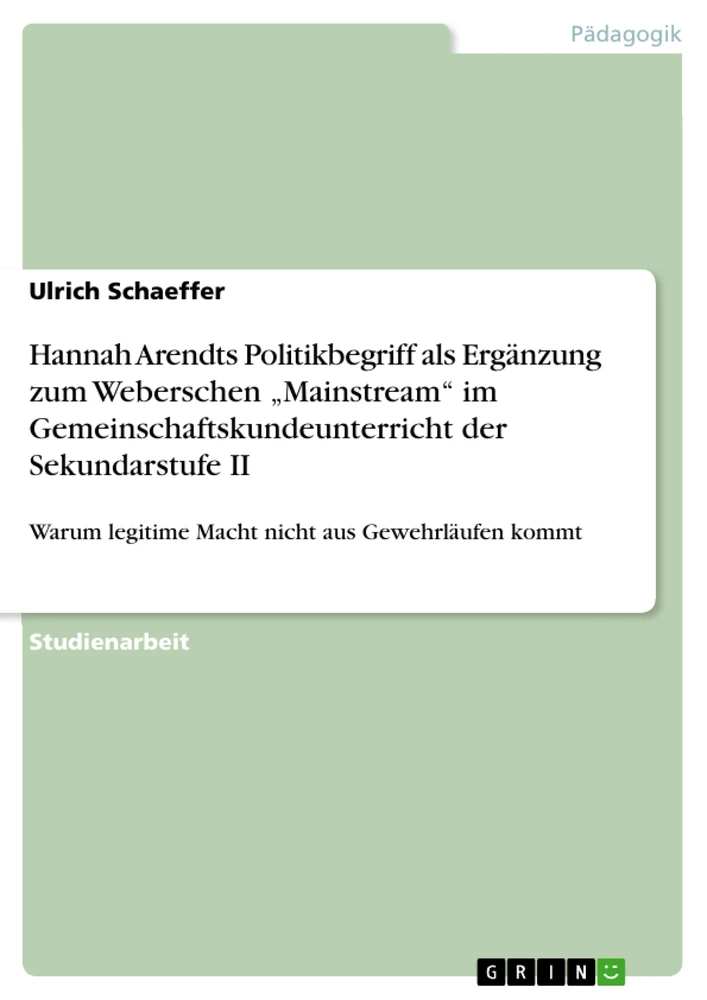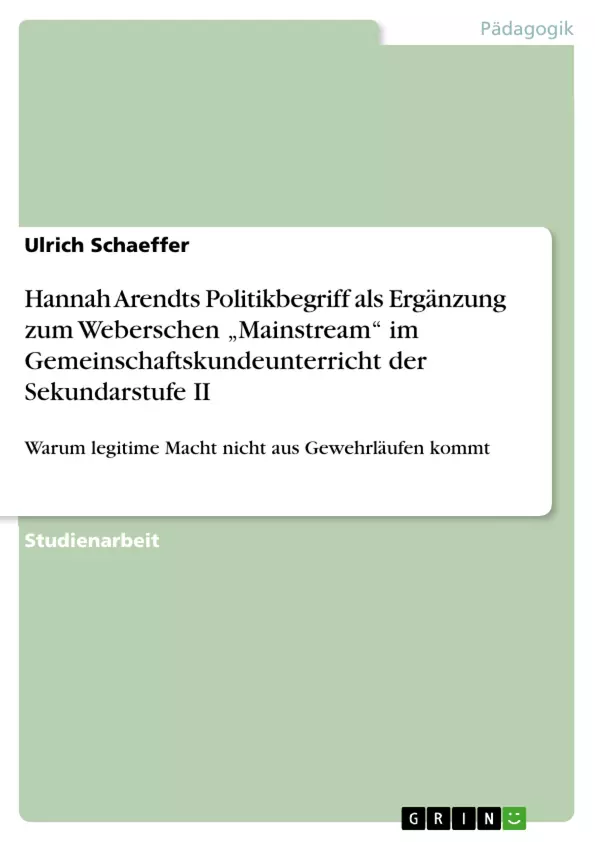Hannah Arendt geht von einem völlig unterschiedlichen Politik- und Machtbegriff aus, als das bei Max Weber der Fall ist. Leider wird dieser Tatsache im Politikunterricht an Gymnasien kaum Beachtung geschenkt, was potenziell problematisch ist, denn einerseits ist gemäß des Beutelsbacher Konsenses in Wissenschaft und Gesellschaft Kontroverses auch so im Politikunterricht abzubilden und andererseits bietet sich der Webersche Mainstream für die kategoriale Anwendung nicht in allen politisch-historischen Kontexten an.
Der vorliegende Text diskutiert zunächst die beiden divergierenden Macht- und Politikverständnisse Webers und Arendts, um anschließend die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf das praxistaugliche Beispiel der "Friedlichen Revolution" von 1989 anzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Warum die ausschließliche Thematisierung des Weberschen Politikbegriffs dem Anspruch des Gemeinschaftskundeunterrichts nicht gerecht wird.
- Der Webersche Politikbegriff im Vergleich zum Politikverständnis Hannah Arendts
- Die Hintergründe der „,Friedlichen Revolution“ 1989
- Über die Anwendbarkeit der beiden Politikkonzepte auf die „Friedliche Revolution“.
- Schlussbetrachtung: Über die moralische Botschaft Hannah Arendts im Sinne demokratischer Beteiligung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Relevanz des Politikverständnisses von Hannah Arendt im Kontext des Gemeinschaftskundeunterrichts, insbesondere im Vergleich zum etablierten Weberschen Politikbegriff. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern die ausschließliche Fokussierung auf Weber die Anforderungen des Gemeinschaftskundeunterrichts, insbesondere die Förderung mündiger Staatsbürger, nicht ausreichend erfüllt.
- Der Webersche und Arendtsche Politikbegriff: Kontrastierung der Kernpunkte
- Die „Friedliche Revolution“ 1989 als Fallbeispiel für die Anwendbarkeit beider Politikkonzepte
- Die Bedeutung des Arendtschen Politikverständnisses für die Förderung demokratischer Beteiligung
- Kritik an der Dominanz des Weberschen Politikbegriffs im Gemeinschaftskundeunterricht
- Der Anspruch des Gemeinschaftskundeunterrichts auf die Herausbildung mündiger Staatsbürger
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit argumentiert, dass die ausschließliche Nutzung des Weberschen Politikbegriffs im Gemeinschaftskundeunterricht nicht den Anspruch des Unterrichts erfüllt, mündige Staatsbürger zu fördern. Die Autorin erläutert die Notwendigkeit, politische Urteilskompetenz zu entwickeln, und argumentiert, dass der Webersche Politikbegriff nicht ausreichend ist, um die Komplexität politischer Phänomene zu erfassen.
- Der Webersche Politikbegriff im Vergleich zum Politikverständnis Hannah Arendts: Dieses Kapitel präsentiert die zentralen Unterschiede zwischen den beiden Politikbegriffen, insbesondere in Bezug auf Macht und Herrschaft. Webers Machtbegriff basiert auf Zwang und Asymmetrie, während Arendts Machtbegriff auf gemeinsames Handeln und Freiwilligkeit beruht.
- Die Hintergründe der „,Friedlichen Revolution“ 1989: Die „Friedliche Revolution“ wird als Beispiel dafür angeführt, dass der Webersche Politikbegriff bestimmte Phänomene nicht ausreichend erklären kann. Die Autorin legt die historischen Hintergründe der Revolution dar.
- Über die Anwendbarkeit der beiden Politikkonzepte auf die „Friedliche Revolution“.: Dieses Kapitel beleuchtet die Anwendbarkeit der beiden Politikkonzepte auf die „Friedliche Revolution“, wobei die Autorin argumentiert, dass Arendts Politikverständnis die Ereignisse besser erklärt als Webers.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der politischen Theorie und der Didaktik des Gemeinschaftskundeunterrichts. Im Mittelpunkt stehen die Politikbegriffe von Max Weber und Hannah Arendt, insbesondere ihre unterschiedlichen Konzepte von Macht und Herrschaft. Die „Friedliche Revolution“ 1989 dient als Fallbeispiel, um die Anwendbarkeit beider Politikkonzepte zu illustrieren. Weitere wichtige Themen sind die Förderung mündiger Staatsbürger, die Notwendigkeit politischer Urteilskompetenz und der Anspruch des Gemeinschaftskundeunterrichts auf die Auseinandersetzung mit kontroversen Sachverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich der Politikbegriff von Hannah Arendt von dem Max Webers?
Während Weber Macht oft als Zwang und Herrschaft definiert, basiert Arendts Begriff auf gemeinsamem, freiwilligem Handeln und demokratischer Beteiligung.
Warum sollte Arendts Konzept im Gemeinschaftskundeunterricht behandelt werden?
Die ausschließliche Fokussierung auf Weber wird dem Ziel nicht gerecht, mündige Staatsbürger zu fördern, die zur politischen Urteilskompetenz fähig sind.
Wie wird das Beispiel der „Friedlichen Revolution“ 1989 in der Arbeit genutzt?
Die Arbeit zeigt, dass die Ereignisse von 1989 besser durch Arendts Konzept des gemeinsamen Handelns als durch Webers Fokus auf staatliche Machtstrukturen erklärt werden können.
Was besagt der Beutelsbacher Konsens in diesem Zusammenhang?
Er fordert, dass kontrovers diskutierte Themen in Wissenschaft und Gesellschaft auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden müssen.
Welche moralische Botschaft vermittelt Hannah Arendt?
Arendt betont die Bedeutung der individuellen Freiheit und der aktiven Teilnahme am politischen Geschehen als Kern einer funktionierenden Demokratie.
- Citation du texte
- Ulrich Schaeffer (Auteur), 2013, Hannah Arendts Politikbegriff als Ergänzung zum Weberschen „Mainstream“ im Gemeinschaftskundeunterricht der Sekundarstufe II, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289349