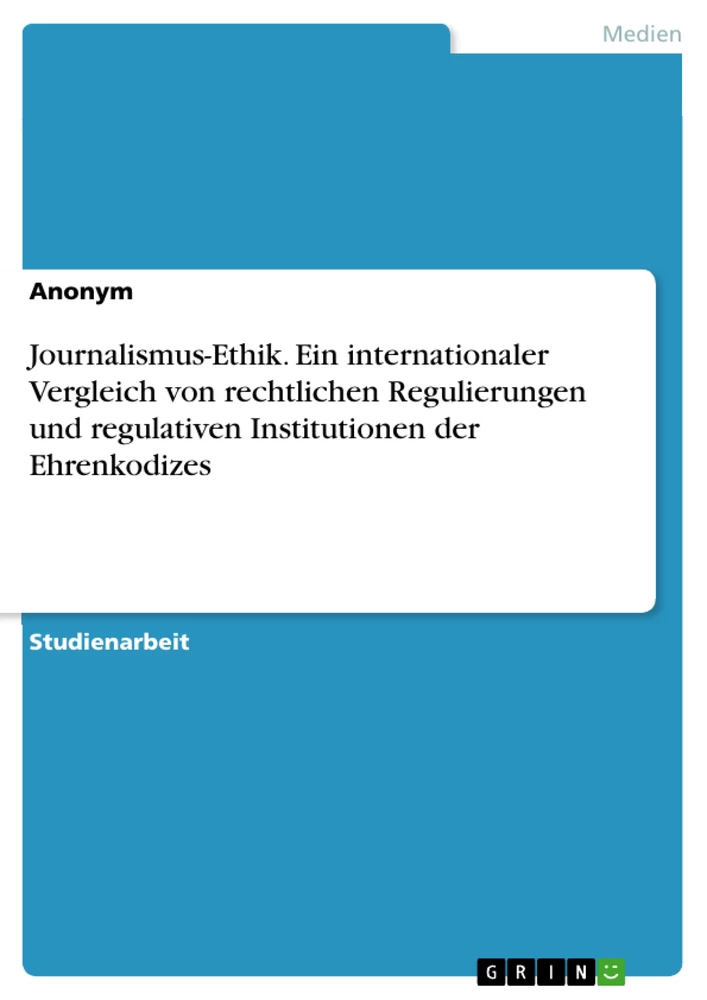Es gab sie in der Vergangenheit und wird sie wahrscheinlich auch in Zukunft noch geben: heftig umstrittene Grenzfälle journalistischer Berichterstattung wie beispielsweise im Zuge der „Barschel-Affäre“ oder während des Geiseldramas von Gladbeck und Bremen, beides Exempel für ein Überschreiten ethischer Grundsätze durch Journalisten. Man könnte eine lange Liste von Versäumnissen und Fehlleistungen - keineswegs nur in Deutschland - aufzählen, und häufig entzünden solcherlei Vorfälle aufgeregte Debatten um die journalistische Ethik.
Ein Trugschluss wäre es jedoch, hierbei die alleinige Verantwortung für Verfehlungen dem einzelnen Journalisten und somit den individualethischen Maximen zuzuschreiben. Sicherlich ist das persönliche Gewissen ein wichtiger Faktor, wenn vor Ort gehandelt und eine Entscheidung getroffen wird, wie zum Beispiel ob man in ein verschlossenes Hotelzimmer eindringt und einen Menschen fotografiert, bevor man Erste Hilfe leistet oder ob man in den Verlauf einer Geiselnahme eingreift.
Allerdings ist das individuelle Handeln eingebettet in ein Netz aus professionsethischen Maßstäben und Normen wie z.B. dem deutschen Pressekodex sowie institutionellen und systemischen Rahmenbedingungen durch Gesetzgeber und Medienunternehmern. Das Zusammenspiel zwischen gesetzlichen Vorgaben und journalistischer Ethik beschreibt Rüdiger Funiok (2002) folgendermaßen: „Ethik ist eine 'innere Steuerungsressource'. Das Recht stellt mit seinem Zwangscharakter demgegenüber eine äußere Steuerungsmöglichkeit dar. Es wäre um die Moral im Medienbereich sicher noch schlechter bestellt, wenn es die Sanktionsmöglichkeit des Rechts nicht gäbe und alles der Freiwilligkeit überlassen bliebe. Es braucht beide Steuerungen, soll ein gesellschaftlich so bedeutsamer Sektor wie der Medienbereich nicht aus dem Ruder laufen.“ (Funiok, 2002)
In der vorliegenden Arbeit, die im Rahmen des Seminars „Rationalität und Ethik im Journalismus“ am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg Universität Mainz entstanden ist, wird die Rolle von Ethikkodizes im internationalen Vergleich von Deutschland, Frankreich und Großbritannien analysiert. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einbettung der Ethikkodizes in den Bezugsrahmen gesetzlicher Bestimmungen und (Selbst-)Kontrollinstanzen gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Basis: Was ist Journalistische Ethik
- Ansätze der Journalismus-Ethik
- Historische Entwicklung Journalistischer Ethik
- Relevanz Journalistischer Ethik
- Die Rolle der Ethikkodizes
- Forschungsfragen
- Länderspezifische Umsetzung Journalistischer Ethik
- Journalistische Ethik in Deutschland
- Rechtliche Regulierung
- Regulative Institutionen
- Ethikkodizes
- Journalistische Ethik in Frankreich
- Rechtliche Regulierung
- Regulative Institutionen
- Ethikkodizes
- Journalistische Ethik in Großbritannien
- Rechtliche Regulierung
- Regulative Institutionen
- Ethikkodizes
- Ländervergleich
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Rolle von Ethikkodizes im internationalen Vergleich von Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Sie untersucht die Einbettung der Ethikkodizes in den Bezugsrahmen gesetzlicher Bestimmungen und (Selbst-)Kontrollinstanzen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Ethikkodizes für die journalistische Praxis zu beleuchten und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Umsetzung journalistischer Ethik in den drei Ländern aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Ethikkodizes für die journalistische Praxis
- Die Einbettung von Ethikkodizes in den Bezugsrahmen gesetzlicher Bestimmungen
- Die Rolle von (Selbst-)Kontrollinstanzen in der journalistischen Ethik
- Der Vergleich der journalistischen Ethik in Deutschland, Frankreich und Großbritannien
- Die Herausforderungen und Chancen der journalistischen Ethik im internationalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Journalismus-Ethik anhand von Beispielen aus der Vergangenheit dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Kapitel 2 definiert den Begriff der Journalismus-Ethik und beleuchtet verschiedene Ansätze, die sich mit der Frage nach den Prinzipien guten journalistischen Handelns beschäftigen. Es wird zudem die historische Entwicklung der Journalismus-Ethik und die Bedeutung von Ethikkodizes für die journalistische Praxis erläutert. Kapitel 3 definiert die Forschungsfragen der Arbeit, die sich auf die länderspezifische Umsetzung journalistischer Ethik in Deutschland, Frankreich und Großbritannien konzentrieren. Kapitel 4 analysiert die journalistische Ethik in den drei Ländern, indem es die rechtliche Regulierung, die regulativen Institutionen und die Ethikkodizes in jedem Land beleuchtet. Kapitel 5 vergleicht die Ethikstrukturen der drei Länder und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Das Fazit fasst die Ergebnisse des Ländervergleichs zusammen und ordnet die Arbeit im Kontext der Journalismus-Ethik ein.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Journalismus-Ethik, Ethikkodizes, rechtliche Regulierung, regulative Institutionen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, internationaler Vergleich, Medienethik, Professionsethik, Individualethik, System-/Institutionsethik, Publikumsethik, Medienberichterstattung, Qualitätssicherung, Medienunternehmen, Medienkonsumenten, journalistische Praxis, moralische Grundsätze, Verhaltensrichtlinien, Spannungsfeld, ökonomische Zwänge, normative Ansprüche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe von Ethikkodizes im Journalismus?
Ethikkodizes dienen als freiwillige Selbstverpflichtung der Presse, um moralische Standards (wie Wahrheitspflicht und Persönlichkeitsschutz) zu wahren und die Qualität der Berichterstattung zu sichern.
Wie unterscheiden sich die Presseräte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien?
Die Arbeit vergleicht die unterschiedlichen Grade der staatlichen Einbindung und die Machtbefugnisse der jeweiligen Kontrollinstanzen, wie zum Beispiel den Deutschen Presserat.
Warum reicht das Gesetz allein zur Steuerung der Medien nicht aus?
Gesetze bieten nur eine „äußere Steuerung“. Ethik fungiert als „innere Ressource“, die Journalisten hilft, in komplexen Grenzsituationen (z. B. Geiseldramen) verantwortungsvoll zu entscheiden.
Was versteht man unter "Individualethik" im Journalismus?
Individualethik bezieht sich auf das persönliche Gewissen und die moralische Verantwortung des einzelnen Journalisten bei seiner täglichen Arbeit vor Ort.
Welche Rolle spielen ökonomische Zwänge für die journalistische Ethik?
Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit von Profitabilität in Medienunternehmen und dem normativen Anspruch an eine ethisch saubere Berichterstattung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Journalismus-Ethik. Ein internationaler Vergleich von rechtlichen Regulierungen und regulativen Institutionen der Ehrenkodizes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289350