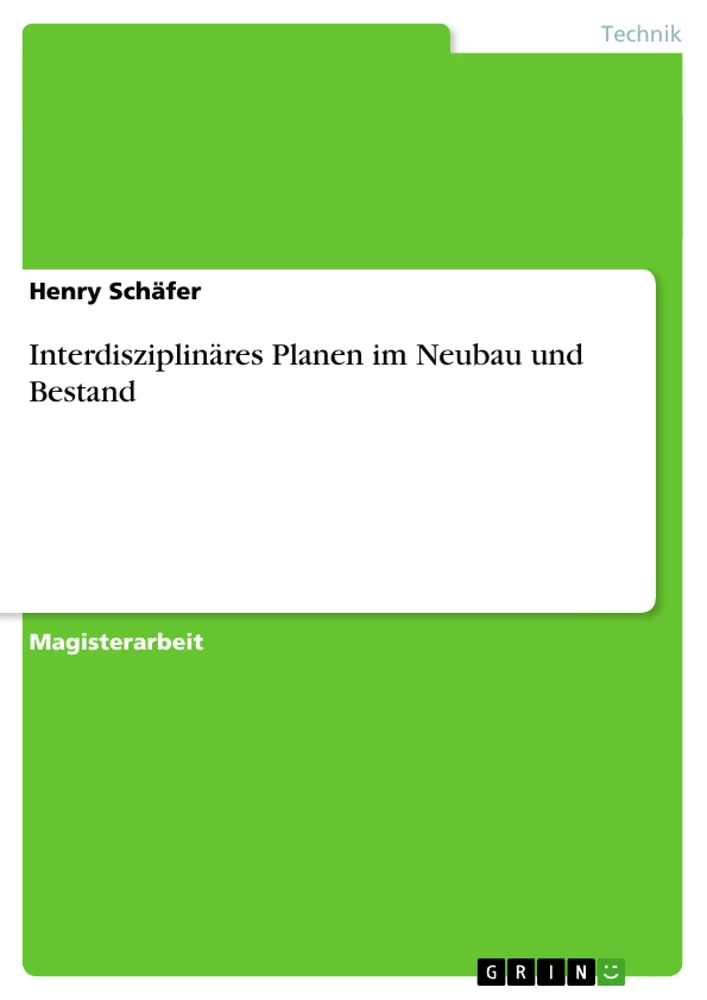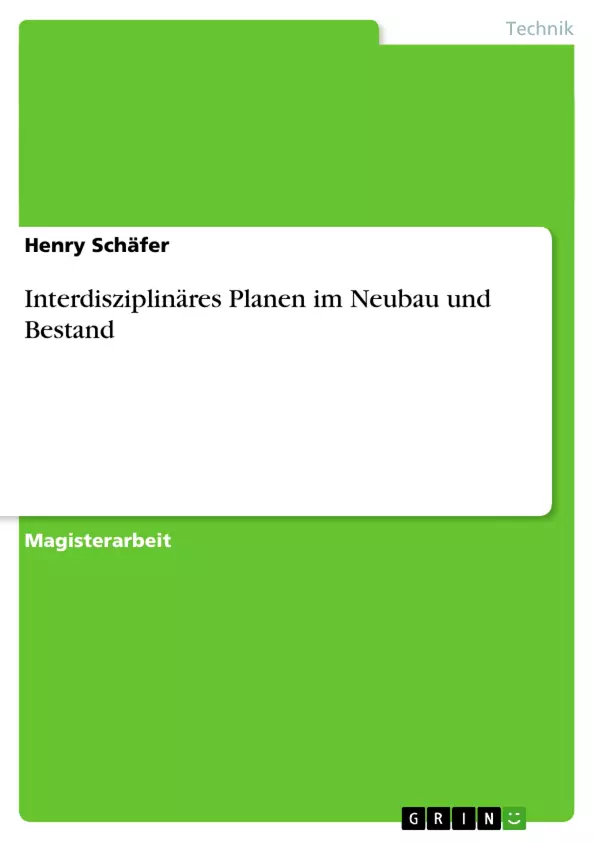Einleitung
Ein bisher bei der Planung von Gebäuden im Neubau und Bestand etwas vernachlässigter Aspekt gewinnt immer mehr an Bedeutung: Die Berücksichtigung des Energieverbrauches während der Herstellung und vor allem während der Nutzung des Gebäudes. Den größten Energiebedarf bei einem Gebäude verursacht derzeit die Heizenergiebereitstellung, die Strom- und Warmwasserbereitung folgen.
Bei neueren Wohngebäuden wird durch die geltende Energieeinsparverordnung der Heizenergiebedarf bereits drastisch gesenkt, technisch sind im Neubau mittlerweile Gebäude ohne Heizwärmebedarf herstellbar.
Der Neubau stellt aber nur einen geringen Bestandteil der in Deutschland befindlichen Gebäude dar. Eine Analyse des Gebäudebestandes im Jahr 2000 führte zu folgender zeitlicher Aufteilung:
11% der Gebäude in Deutschland sind jünger als 13 Jahre
11% der Wohnungen wurden von 1979-87 gebaut
78 % der Gebäude wurden vor 1979 errichtet
In Deutschland sind über 2/3 aller Wohnungen Altbauwohnungen. Man kann sich schon anhand der zu den entsprechenden Zeitabschnitten gültigen Energiesparverordnungen und sonstiger gesetzlicher Regelungen ausrechnen, welchen Energieverbrauch und welche Betriebskosten diese Gebäude haben.
Dies zeigt die Notwendigkeit vor allem bei älteren Gebäuden Maßnahmen zur Energieeinsparung zu ergreifen. Eine Sanierung sollte aber die vorhandene Bauweise berücksichtigen, um Bauschäden sicher zu vermeiden. Die entstehenden Investitionskosten sollen sich durch einen geringeren Verbrauch an Heizenergie amortisieren und nicht wegen Abschreibemodellen und Steuervergünstigungen auf sich genommen werden.
Wie schon erwähnt, beim Gebäudebestand handelt es sich, betrachtet man die heutigen technischen Möglichkeiten, um energetische Museen (Altbau 150-220 kWh/m a, da- 2 gegen Passivhausneubau 15 kWh/m a). Das bedeutet aber nicht, dass dieser Altbau- 2 bestand wertlos ist. Die gigantische graue Energie und die Bauleistungen unserer Eltern und Großeltern müssen wir nutzen.
Dabei sollten wir aber nicht deren Baufehler archivieren und erhalten. Die Vorteile der Altbausubstanz liegen in der sehr großen Energiespeichermasse des Gebäudes, die richtig genutzt werden muß. Ebenfalls kann der Baukörper als Rohbau genutzt werden, damit er nicht erneut errichtet werden muß. Dies würde wiederum Herstellungsenergie für Baustoffe und vor allem Transportaufwand bedeuten, denn auch der Abbruch müßte erst transportiert werden.
...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Ökologische und ökonomische Notwendigkeit des Energiesparens
- 2.1.1 Energieverbrauch und Ressourcen
- 2.1.2 Der Treibhauseffekt
- 2.1.3 Reduzierung der CO -Emissionen
- 2.2 Wärmeschutz von Gebäuden
- 2.2.1 Begriffe und Definitionen
- 2.2.1.1 Kenngrößen zur Berechnung der bauphysikalischen Eigenschaften von Bauteilen
- 2.2.1.2 Wärmetransport
- 2.2.1.3 Wärmebrücken
- 2.2.1.4 Wärmegewinne
- 2.2.1.5 Wärmeverluste
- 2.2.1.6 Luftdichtheit
- 2.2.1.7 Energiekennwerte
- 2.2.1.8 Bauteilkenngrößen stationärer und instationärer Wärmebewegungen
- 2.2.2 Aktuelle Vorschriften zum Wärmeschutz von Gebäuden
- 2.2.2.1 Energieeinsparverordnung (EnEV)
- 2.2.2.2 DIN 4108
- 2.2.3 Gebäudestandards mit niedrigem Heizwärmebedarf
- 2.2.3.1 Das Niedrigenergiehaus (NEH)
- 2.2.3.2 Das 3-Liter-Haus
- 2.2.3.3 Das Passivhaus
- 2.2.3.4 Das Plusenergiehaus
- 2.2.3.5 Tabellarische Übersicht der Kennwerte der Gebäudestandards
- 2.3 Wärmeabhängiger Feuchteschutz von Gebäuden
- 2.3.1 Begriffe und Definitionen
- 2.3.1.1 Luftfeuchte
- 2.3.1.2 Wasserdampfdiffussion
- 2.3.1.3 Tauwasserbildung
- 2.3.1.4 Kapillare Wasseraufnahme
- 2.3.1.5 Tauwasserfreiheit
- 2.3.2 Aktuelle Vorschrift zum bauphysikalischen Feuchteschutz - DIN 4108-3
- 2.4 Der Baustoff Holz
- 2.4.1 Eigenschaften
- 2.4.2 Vorteile
- 2.4.3 Holzschutz
- 2.4.4 Holzbauweisen
- 2.4.4.1 Der Blockbau
- 2.4.4.2 Der Fachwerkbau
- 2.4.4.3 Die Skelettbauweise
- 2.4.4.4 Der Holzrahmenbau
- 2.4.4.5 Holztafelbau
- 2.4.4.6 Mischbauweisen
- 2.4.4.7 Zusammenfassung
- 2.5 Die Passivhausbauweise
- 2.5.1 Definition
- 2.5.2 Verschiedene Passivhausbauweisen
- 2.5.2.1 Massivbau
- 2.5.2.2 Holzbau
- 2.5.3 System Naumann und Stahr
- 2.6 Statische Nachweise nach Grenzzuständen
- 2.6.1 Erläuterungen zum semiprobabilistischen Bemessungskonzept
- 2.6.2 Erläuterungen zur Bemessung nach E DIN 1052:2000-05
- 2.6.2.1 Einwirkungen
- 2.6.2.2 Tragwiderstand
- 2.6.2.3 Grenzzustände der Tragfähigkeit
- 2.6.2.4 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
- 2.6.2.5 Nutzungsklassen
- 2.6.2.6 Klassen der Lasteinwirkungsdauer
- 2.6.3 Erläuterungen zur DIN 1045:2001-07
- 2.6.3.1 Bemessungswert des Tragwiderstandes
- 2.6.3.2 Grenzzustände der Tragfähigkeit
- 2.6.3.3 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
- 3 Altbausanierung
- 3.1 Istanalyse Altbaubestand
- 3.1.1 Wärme- und Feuchteschutz
- 3.1.2 Schallschutz
- 3.1.3 Brandschutz
- 3.1.4 Statik
- 3.1.5 Zusammenfassung (Problembenennung)
- 3.2 Zielstellung
- 3.2.1 Wärme- und Feuchteschutz
- 3.2.2 Schallschutz
- 3.2.3 Brandschutz
- 3.2.4 Statik
- 3.2.5 Haustechnik
- 3.3 Lösungsansätze
- 3.3.1 Wärmeschutz unter Beachtung des Feuchteschutzes
- 3.3.1.1 Dach
- 3.3.1.2 Wände
- 3.3.1.3 Fenster
- 3.3.1.4 Decken
- 3.3.1.4.1 Decke gegen unbeheizte Dachgeschosse
- 3.3.1.4.2 Kellerdecken
- 3.3.1.4.3 Fußböden gegen Erdreich
- 3.3.1.5 Haustüren
- 3.3.1.6 Reduzierung von Wärmebrücken
- 3.3.2 Schallschutz
- 3.3.2.1 Dach
- 3.3.2.2 Außenwände
- 3.3.2.3 Wohnungstrennwände
- 3.3.2.4 Fenster
- 3.3.2.5 Decken
- 3.3.2.5.1 Massivdecken
- 3.3.2.5.2 Holzbalkendecken
- 3.3.2.6 Treppen
- 3.3.2.7 Türen
- 3.3.3 Brandschutz
- 3.3.4 Statik
- 4 Stahlbetongebäude aus 3-Schicht-Platten
- 4.1 System 3-Schicht-Platte
- 4.2 Istanalyse
- 4.2.1 Wärme- und Feuchteschutz
- 4.2.2 Schallschutz
- 4.2.3 Brandschutz
- 4.2.4 Statik
- 4.2.5 Zusammenfassung
- 4.3 Zielstellung
- 4.4 Lösungsansätze
- 4.4.1 Wärmeschutz unter Beachtung des Feuchteschutzes
- 4.4.1.1 Dach
- 4.4.1.2 Außenwände
- 4.4.1.3 Fenster
- 4.4.1.4 Decken
- 4.4.1.5 Haustüren
- 4.4.2 Schallschutz
- 4.4.2.1 Dach
- 4.4.2.2 Wände
- 4.4.2.3 Decken
- 4.4.3 Brandschutz
- 4.4.4 Statik
- 5 Neuentwicklungen von Passivhauskomponenten
- 5.1 Weiterentwicklung eines Passivhaus- bzw. Nullheizenergiehaus tauglichen Kastenfensters
- 5.1.1 Passivhausgeeignete Fenster
- 5.1.2 Weiterentwicklung des Kastenfensters von Naumann & Stahr
- 5.2 Entwicklung einer Solarfassade
- 7.1 Analyse des Gebäudebestandes
- 7.1.1 Bauzustandsbericht
- 7.1.2 Haustechnische Ausstattung
- 7.1.3 Problemstellung
- 7.2 Darstellungen und Berechnungen zum Wärmeschutz des bestehenden Gebäudes
- 7.2.1 Beschreibung und Berechnung bauphysikalischer Kennwerte der Hüllbauteile
- 7.2.1.1 Dach
- 7.2.1.2 Außenwände
- 7.2.1.2.1 Außenwand Straße EG
- 7.2.1.2.2 Außenwand Straße 1.OG
- 7.2.1.2.3 Außenwand Straße 2. und 3.OG
- 7.2.1.2.4 Außenwand Treppenhaus EG
- 7.2.1.2.5 Außenwand Treppenhaus 1. bis 3.OG
- 7.2.1.2.6 Außenwand Hof EG und 1.OG
- 7.2.1.2.7 Außenwand Hof 2. und 3.OG
- 7.2.1.3 Fenster
- 7.2.1.3.1 Kastenfenster Bestand
- 7.2.1.3.2 Isolierglasfenster Holz Bestand
- 7.2.1.3.3 Kunststofffenster mit Isolierverglasung
- 7.2.1.3.4 Treppenhausfenster
- 7.2.1.3.5 Dachfenster Standard
- 7.2.1.3.6 Dachfenster 5-Star
- 7.2.1.4 Kellerdecke
- 7.2.1.5 Haustüren
- 7.2.2 Berechnung des Jahresheizwärmebedarfs
- 7.2.2.1 Berechnung nach EnEV
- 7.2.2.2 Berechnung nach PHPP
- 7.2.3 Einstufung des Wärmeschutzes nach Energiekennzahl für das bestehende Gebäude und für den Zustand nach der Sanierung
- 7.2.4 Berechnung ausgewählter Wärmebrücken
- 7.2.4.1 Holzbalkenköpfe
- 7.2.4.2 Trennwände
- 7.3 Beschreibung und Berechnung der verbesserten Hüllbauteile mit Nachweis der Tauwasserfreiheit
- 7.3.1 Dach
- 7.3.2 Außenwände
- 7.3.2.1 Außenwand Straße EG
- 7.3.2.2 Außenwand Straße 1. OG
- 7.3.2.3 Außenwand Straße 2. und 3. OG
- 7.3.2.4 Außenwand Treppenhaus Erdgeschoss
- 7.3.2.5 Außenwand Treppenhaus 1. bis 3. Obergeschoss
- 7.3.2.6 Außenwand West
- 7.3.3 Fenster
- 7.3.4 Kellerdecke
- 7.3.5 Haustüren
- 7.4 Nachweis des erreichten Passivhausstandards
- 7.5 Brandschutz
- 7.5.1 Brandschutznachweis der Bauteile des Anbaues
- 7.5.1.1 Außenwand
- 7.5.1.2 Brandwand
- 7.5.1.3 Dach
- 7.5.1.4 Geschossdecken
- 7.5.1.5 Zusammenfassung
- 7.5.2 Brandschutznachweis der Bauteile des Bestandsgebäudes
- 7.5.2.1 Außenwand
- 7.5.2.2 Gebäudetrennwände
- 7.5.2.3 Trennwände
- 7.5.2.3.1 Wohnungstrennwand Dachgeschoss
- 7.5.2.3.2 Wohnungstrennwand in übrigen Geschossen
- 7.5.2.3.3 Wand zum Treppenraum
- 7.5.2.4 Dach
- 7.5.2.5 Geschossdecken
- 7.5.2.5.1 Wohnungstrenndecken
- 7.5.2.5.2 Kellerdecke
- 7.5.2.5.3 Decke Treppenraum
- 7.5.2.6 Treppe
- 7.5.2.7 Zusammenfassung
- 7.5.3 Weitere Anforderungen zum baurechtlichen Brandschutz
- 7.5.3.1 Treppenraum
- 7.5.3.2 Rettungswege
- 7.5.3.3 Rauchmeldung / -ausbreitung
- 7.5.3.4 Brandschutzkonzept
- 7.6 Schallschutznachweise
- 7.6.1 Nachweise der Bauteile des Anbaues
- 7.6.1.1 Dach
- 7.6.1.2 Decken
- 7.6.1.3 Wände
- 7.6.1.4 Fenster
- 7.6.1.5 Zusammenstellung
- 7.6.2 Nachweise der Bauteile des Bestandsgebäudes
- 7.6.2.1 Dach
- 7.6.2.2 Decken
- 7.6.2.2.1 Geschossdecken
- 7.6.2.2.2 Kellerdecke
- 7.6.2.3 Wände
- 7.6.2.3.1 Außenwände
- 7.6.2.3.2 Gebäudetrennwände
- 7.6.2.3.3 Wohnungstrennwände
- 7.6.2.3.4 Treppenraumwand
- 7.6.2.4 Fenster
- 7.6.2.5 Zusammenstellung
- 7.7 Statische Nachweise
- 7.7.1 Lastannahmen
- 7.7.1.1 vorwiegend ruhende Beanspruchungen (Eigen- und Nutzlasten)
- 7.7.1.1.1 Eigenlasten
- 7.7.1.1.2 Nutzlasten
- 7.7.1.2 vorwiegend nicht-ruhende Beanspruchungen
- 7.7.1.2.1 Außergewöhnliche Einwirkungen
- 7.7.1.2.2 Schneelast (DIN 1055-5)
- 7.7.1.2.3 Eislast
- 7.7.1.2.4 Windlasten (DIN 1055-4)
- 7.7.2 Zulässige Schnittgrößen der Tragprofile
- 7.7.2.1 Allgemeines
- 7.7.2.2 Geometrische Abmessungen
- 7.7.2.3 Berechnungsformeln
- 7.7.2.4 Rechnerisch zulässige Schnittreaktionen
- 7.7.2.4.1 Biegemoment
- 7.7.2.4.2 Querkraft
- 7.7.2.4.3 Normalkraft
- 7.7.3 Dachdecke Anbau
- 7.7.3.1 Nachweis OSB-Platte
- 7.7.3.2 Nachweis der Querlattung
- 7.7.3.3 Nachweis der Dachträger
- 7.7.3.4 Nachweis OSB-Platte zwischen Trägergurten
- 7.7.3.5 Nachweis der Brandschutzplatte
- 7.7.3.6 Nachweis der unteren Querlattung
- 7.7.4 Geschossdecke Anbau
- 7.7.4.1 Nachweis OSB-Platte
- 7.7.4.2 Nachweis der Deckenträger
- 7.7.5 Holzbalkendecke Bestandsgebäude
- 7.7.5.1 Holzbalkendecke im Bestand
- 7.7.5.1.1 Nachweis Deckenbalken
- 7.7.5.2 Holzbalkendecke saniert
- 7.7.5.2.1 Nachweis OSB-Platte
- 7.7.5.2.2 Nachweis Deckenbalken
- 7.7.5.2.3 Nachweis der unteren Schalung
- 7.7.6 Kellerdecke Bestandsgebäude
- 7.7.6.1 Kellerdecke im Bestand
- 7.7.6.2 Kellerdecke saniert
- 7.7.7 Bodenplatte Anbau
- 7.7.8 Außenwände Anbau
- 7.7.8.1 Außenwand Bereich Wintergarten
- 7.7.8.2 Außenwände im Bereich des Treppenhauses
- 7.7.8.2.1 Nachweis der Wandbekleidungen
- 7.7.8.2.2 Nachweis der Querlattung
- 7.7.8.2.3 Nachweis der Tragprofile
- 7.7.8.3 Kellerwand
- 7.7.9 Bundwände des Bestandsgebäudes
- 7.8 Ökologische Bewertung der Baustoffe
- 7.9 Haustechnikkonzept
- 7.9.1 Heizwärmeversorgung
- 7.9.2 Warmwasserversorgung
- 7.9.3 Lüftung
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die energetische Sanierung des Altbaubestands so wichtig?
Über 2/3 aller Wohnungen in Deutschland sind Altbauten (vor 1979 errichtet). Diese verursachen durch mangelnde Dämmung den größten Teil des Heizenergiebedarfs im Gebäudesektor.
Was versteht man unter "grauer Energie" bei Gebäuden?
Graue Energie ist die Energie, die bereits für Herstellung, Transport und Bau der vorhandenen Bausubstanz aufgewendet wurde. Ihr Erhalt schont Ressourcen im Vergleich zum Abriss und Neubau.
Was ist der Unterschied zwischen einem Niedrigenergiehaus und einem Passivhaus?
Ein Passivhaus hat einen extrem niedrigen Heizwärmebedarf (max. 15 kWh/m²a) und benötigt oft kein klassisches Heizsystem mehr, während ein Niedrigenergiehaus lediglich die gesetzlichen Mindeststandards deutlich unterschreitet.
Welche Rolle spielt der Feuchteschutz bei der Wärmedämmung?
Eine Sanierung muss bauphysikalisch korrekt geplant werden, um Tauwasserbildung und Schimmel zu vermeiden, besonders bei der Nachrüstung von Dämmung an Außenwänden.
Welche Vorteile bietet der Baustoff Holz im modernen Bauen?
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit guten Dämmeigenschaften, geringem Eigengewicht und ermöglicht durch Vorfertigung (Holzrahmenbau) kurze Bauzeiten.
Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Schwachstellen in der Gebäudehülle (z.B. Balkonanschlüsse), an denen Wärme schneller nach außen abfließt, was zu Energieverlusten und Schimmelgefahr führt.
- Citation du texte
- Henry Schäfer (Auteur), 2004, Interdisziplinäres Planen im Neubau und Bestand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28938