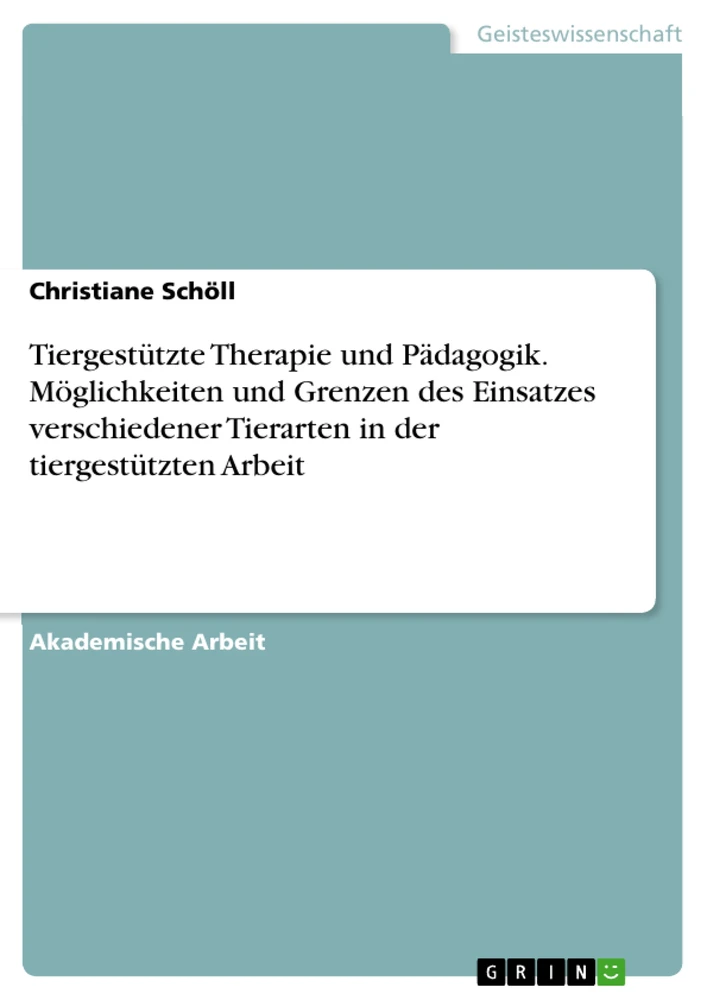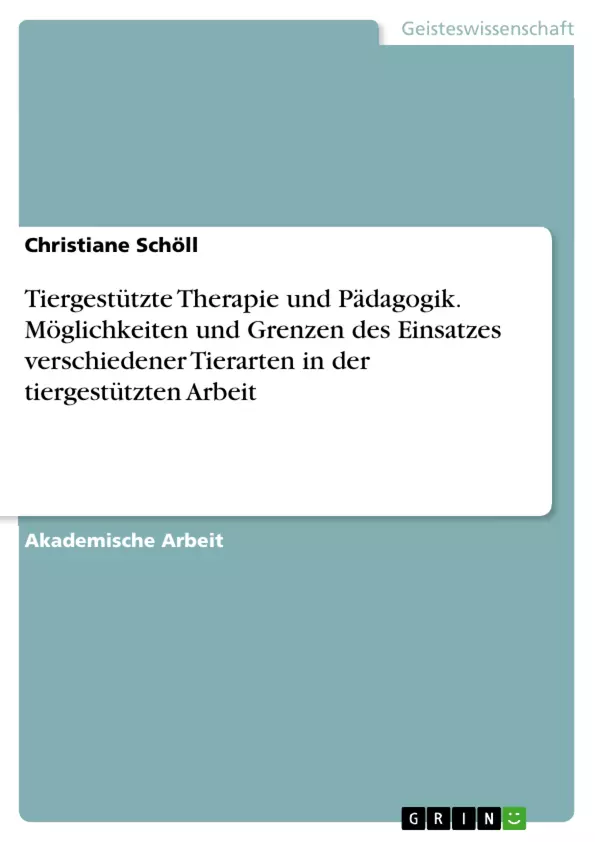Die tiergestützte Therapie und Pädagogik setzt auf die Integration von bewussten und unbewussten Prozessen. Doch was bewirkt sie wirklich? Diese Arbeit will überprüfen, ob sich ihre Erfolge belegen lassen und erläutert die Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Tierarten.
Dazu werde ich im Folgenden zuerst auf die Historie der tiergestützten Arbeit eingehen und danach die Begriffe der tiergestützten Aktivitäten, Pädagogik und Therapie definieren. Des Weiteren werde ich die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener Tierarten erläutern und zuletzt die physiologische, psychologische und soziale Wirkung von Tieren auf den Menschen anhand unterschiedlicher Studien belegen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Die Historie der tiergestützten Arbeit
- Erklärung verschiedener Begriffe der tiergestützten Arbeit
- Tiergestützte Aktivitäten (AAA, Animal-Assisted-Activities)
- Tiergestützte Erziehung/Pädagogik (AAE, Animal-Assisted-Education/AAP, Animal-Assisted-Pedagogy)
- Tiergestützte Therapie (AAT, Animal-Assisted-Therapy)
- Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener Spezies in der tiergestützten Arbeit
- Allgemeine Auswahlkriterien der Tiere
- Hunde
- Katzen
- Nagetiere
- Vögel und Fische
- Pferdeartige
- Nutztiere
- Kameliden
- Delfine
- (Aus-)Wirkungen der tiergestützten Arbeit
- Physische Auswirkungen
- Psychische Auswirkungen
- Soziale Auswirkungen
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die tiergestützte Therapie und Pädagogik, beleuchtet deren historische Entwicklung und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener Tierarten. Ziel ist es, den Wirkungsgrad dieser Methode zu überprüfen und die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Tierarten zu erläutern.
- Historische Entwicklung der tiergestützten Arbeit
- Definition verschiedener Begriffe (Tiergestützte Aktivitäten, Pädagogik, Therapie)
- Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener Tierarten
- Auswirkungen der tiergestützten Arbeit (physisch, psychisch, sozial)
- Wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Historie der tiergestützten Arbeit: Der Text beleuchtet die lange Geschichte der Mensch-Tier-Beziehung im therapeutischen Kontext, beginnend mit frühen Berichten über hilfreiche Tierkontakte im 8. Jahrhundert bis hin zur systematischen Erforschung und Verbreitung tiergestützter Interventionen im 20. Jahrhundert. Erwähnt werden Beispiele wie die „therapie naturelle“ in Gheel (Belgien), der Einsatz von Hunden in belgischen Klöstern, und die Entwicklung des York Retreat in England, wo der Kontakt mit Tieren die Behandlung psychisch kranker Menschen verbesserte. Der Text hebt die Rolle von Florence Nightingale im 19. Jahrhundert und die frühen Arbeiten in Bethel (Deutschland) hervor. Die Entwicklung von Blindenführhunden und anderen Assistenzhunden im 20. Jahrhundert sowie die zunehmende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema, insbesondere in den USA, werden ebenfalls detailliert beschrieben. Die Arbeit von Boris Levinson und die Veröffentlichung seines Werkes „Pet oriented Child-Psychiatry“ im Jahr 1969 markieren einen entscheidenden Schritt in der Systematisierung und Forschung im Bereich der tiergestützten Therapie.
Schlüsselwörter
Tiergestützte Therapie, Tiergestützte Pädagogik, Tiergestützte Aktivitäten, Mensch-Tier-Beziehung, verschiedene Tierarten, therapeutische Wirkung, historische Entwicklung, wissenschaftliche Forschung, Wirkungsweise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Tiergestützte Arbeit: Eine umfassende Übersicht"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über die tiergestützte Arbeit. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung, der Definition verschiedener Begriffe (Tiergestützte Aktivitäten, Pädagogik, Therapie), den Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener Tierarten und den Auswirkungen der tiergestützten Arbeit (physisch, psychisch, sozial).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: die historische Entwicklung der tiergestützten Arbeit von frühen Berichten bis zur modernen Forschung; genaue Definitionen von Tiergestützten Aktivitäten (AAA), Tiergestützter Erziehung/Pädagogik (AAE/AAP) und Tiergestützter Therapie (AAT); die Eignung verschiedener Tierarten (Hunde, Katzen, Nagetiere, Vögel, Fische, Pferde, Nutztiere, Kameliden, Delfine) für die tiergestützte Arbeit, inklusive der jeweiligen Auswahlkriterien; die physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen der tiergestützten Arbeit; und schließlich ein Literaturverzeichnis mit weiterführender Literatur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die tiergestützte Therapie und Pädagogik zu untersuchen, ihre historische Entwicklung zu beleuchten und die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener Tierarten zu analysieren. Ein wichtiges Ziel ist die Überprüfung des Wirkungsgrades dieser Methode und die Erläuterung der Einsatzmöglichkeiten verschiedener Tierarten. Die wissenschaftliche Fundierung der Wirksamkeit wird ebenfalls thematisiert.
Welche Tierarten werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet eine breite Palette von Tierarten, darunter Hunde, Katzen, Nagetiere, Vögel, Fische, Pferdeartige, Nutztiere, Kameliden und Delfine. Für jede Tierart werden die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen ihres Einsatzes in der tiergestützten Arbeit diskutiert.
Welche Auswirkungen der tiergestützten Arbeit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen der tiergestützten Arbeit. Es wird beleuchtet, wie der Kontakt mit Tieren positive Effekte auf die körperliche und geistige Gesundheit sowie auf die sozialen Interaktionen haben kann.
Wie wird die historische Entwicklung der tiergestützten Arbeit dargestellt?
Die historische Entwicklung wird von frühen Beispielen wie der „therapie naturelle“ in Gheel (Belgien) und dem Einsatz von Tieren in Klöstern über die Beiträge von Florence Nightingale bis hin zur systematischen Erforschung und Verbreitung tiergestützter Interventionen im 20. Jahrhundert (z.B. die Arbeit von Boris Levinson) nachgezeichnet. Die Entwicklung von Assistenzhunden und die zunehmende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema, insbesondere in den USA, werden ebenfalls detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Tiergestützte Therapie, Tiergestützte Pädagogik, Tiergestützte Aktivitäten, Mensch-Tier-Beziehung, verschiedene Tierarten, therapeutische Wirkung, historische Entwicklung, wissenschaftliche Forschung, Wirkungsweise.
- Quote paper
- Christiane Schöll (Author), 2007, Tiergestützte Therapie und Pädagogik. Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener Tierarten in der tiergestützten Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289397