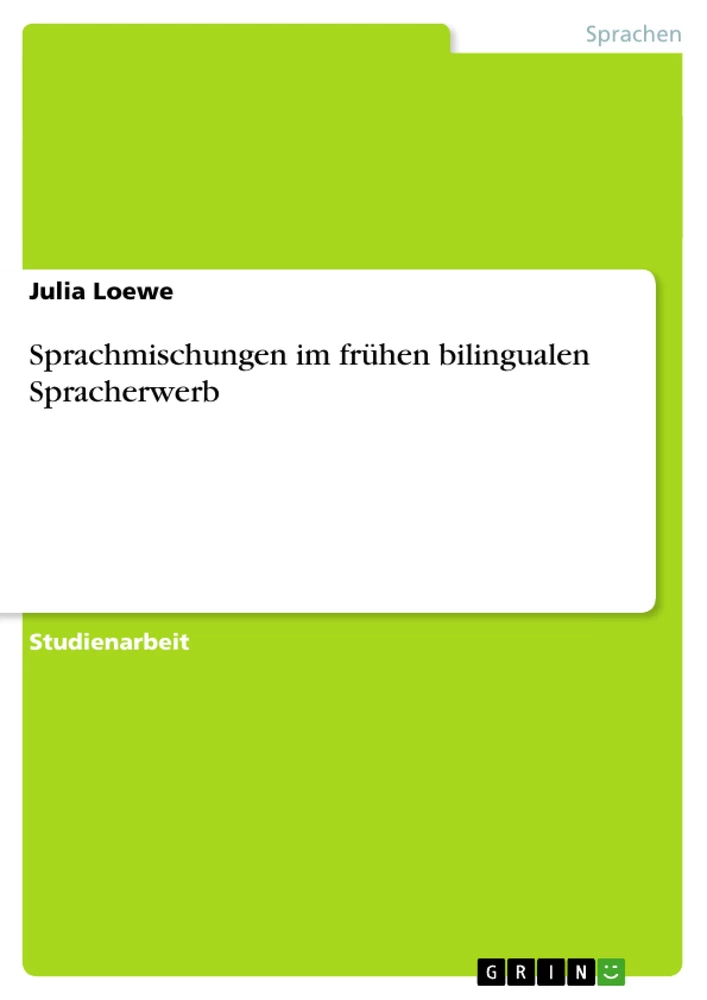Einleitung
In vielen Untersuchungen zum bilingualen Erstspracherwerb wurde festgestellt, dass Kinder, die von Geburt an zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, in den ersten Lebensjahren auffällig häufig die Sprachen mischen, die hohe Mischrate jedoch mit zunehmenden sprachlichen Kenntnissen rapide abnimmt. Kontroverse Hypothesen für diese frühen Sprachmischungen führten in der Wissenschaft zu Diskussionen und ein immer wieder auftauchendes Thema ist, ob mehrsprachigen Kindern zu Beginn des Spracherwerbs überhaupt bewußt ist, dass sie es mit mehr als einer Sprache zu tun haben . Anhänger der sogenannten “one-system hypothesis” oder auch “one-language hypothesis” sehen die Sprachmischungen als Beweis, dass die Sprachsysteme des Kindes anfangs noch fusioniert sind und sich erst mit der Entwicklung der grammatischen Kompetenz voneinander differenzieren. Befürworter der “two-system hypothesis” oder “differentiated-language hypothesis” weisen jedoch diese Argumentation zurück und zeigen, dass bilinguale Kinder von Geburt an die Fähigkeit besitzen, die Sprachen zu unterscheiden.
Ein mehrsprachiges Kind muss aber auch eine pragmatische Kompetenz entwickeln, in dem es lernt, sich der ′richtigen′ Sprache im ′richtigen′ Kontext zu bedienen, d. h. sich dem Gesprächspartner oder dem Gesprächskontext anzupassen. Dies gilt nicht nur für “einsprachige” Situationen, in der das Kind die Sprache des Gesprächspartners wählt, sondern auch für bilinguale Gesprächssituationen, in der die Gesprächsbeteiligten die selben Sprachen beherrschen und zwischen diesen wechseln können. Solche Sprachwechsel können innerhalb eines Dialoges, eines Satzes oder eines Wortes auftreten, was in der Sprachwissenschaft als “Code-switching” bezeichnet wird. Um es korrekt anzuwenden, müssen allerdings gewisse soziologische, pragmatische und grammatische Regeln befolgt werden. Demnach könnte “fehlerhaftes” Code-switching ebenfalls eine Ursache für die vermehrten Sprachmischungen sein, da die Sprachen aufgrund noch nicht erworbener Kompetenzen auch in einem unangebrachten Kontext gemischt werden. Code-switching setzt jedoch zwei differenzierte Sprachsysteme voraus. In der vorliegenden Arbeit sollen einige Untersuchungen betrachtet werden, die sich mit Sprachmischungen bilingualer Kinder während des frühen Spracherwerbs beschäftigt haben...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein oder zwei Sprachsysteme?
- The unitary-language hypothesis
- The differentiated-language hypothesis
- Die Annahme einer pre-grammatischen Phase
- Code-switching
- Die Rolle des sprachlichen Inputs durch Eltern und Umwelt
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Sprachmischungen im frühen bilingualen Erstspracherwerb. Sie untersucht, ob diese Mischungen auf ein noch nicht differenziertes Sprachsystem hindeuten oder ob mehrsprachige Kinder von Beginn an die Fähigkeit besitzen, Sprachen zu unterscheiden. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Hypothesen zur grammatischen Differenzierung im bilingualen Spracherwerb, insbesondere die "unitary-language hypothesis" und die "differentiated-language hypothesis". Darüber hinaus wird die Rolle von Code-switching sowie der Einfluss des sprachlichen Inputs durch Eltern und Umwelt betrachtet.
- Untersuchung der Sprachmischungen im frühen bilingualen Erstspracherwerb
- Analyse der "unitary-language hypothesis" und der "differentiated-language hypothesis"
- Bedeutung von Code-switching für den Spracherwerb
- Einfluss des sprachlichen Inputs durch Eltern und Umwelt
- Zusammenhänge zwischen Sprachmischungen und der Entwicklung der grammatischen Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und führt in die Thematik des Sprachmi schens im frühen bilingualen Erstspracherwerb ein. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Frage, ob mehrsprachige Kinder in den ersten Stadien des Spracherwerbs zwischen den Sprachen unterscheiden können. Hierbei werden die "unitary-language hypothesis" und die "differentiated-language hypothesis" näher beleuchtet. Kapitel 3 definiert den Begriff "Code-switching" und zeigt die Bedeutung dieses Phänomens für die Entwicklung der Sprachkompetenz mehrsprachiger Kinder auf. Kapitel 4 untersucht die Rolle des sprachlichen Inputs durch Eltern und Umwelt im Spracherwerbprozess. Die Schlussfolgerung fasst die verschiedenen Annahmen der Arbeit zusammen und versucht, die Ursachen für die häufigeren Sprachmischungen am Anfang der Sprachentwicklung zu erklären.
Schlüsselwörter
Bilingualer Erstspracherwerb, Sprachmischungen, Code-switching, "unitary-language hypothesis", "differentiated-language hypothesis", Sprachsystem, grammatische Differenzierung, sprachlicher Input, Eltern, Umwelt.
Häufig gestellte Fragen
Warum mischen bilinguale Kinder ihre Sprachen?
Sprachmischungen treten in den ersten Lebensjahren häufig auf und nehmen mit steigender grammatischer Kompetenz ab. Ursachen können noch nicht differenzierte Sprachsysteme oder pragmatische Anpassungen sein.
Was besagt die „Unitary-Language Hypothesis“?
Diese Hypothese nimmt an, dass bilinguale Kinder anfangs nur über ein fusioniertes Sprachsystem verfügen und die Sprachen erst allmählich voneinander trennen.
Was ist der Gegenentwurf zur Unitary-Language Hypothesis?
Die „Differentiated-Language Hypothesis“ besagt, dass bilinguale Kinder von Geburt an die Fähigkeit besitzen, die beiden Sprachsysteme zu unterscheiden.
Was versteht man unter Code-switching?
Code-switching ist der Wechsel zwischen Sprachen innerhalb eines Dialogs oder Satzes, der soziologischen, pragmatischen und grammatischen Regeln folgt.
Welche Rolle spielt der sprachliche Input der Eltern?
Der Input durch die Eltern und die Umwelt ist entscheidend dafür, wie schnell das Kind lernt, sich der „richtigen“ Sprache im jeweiligen Kontext zu bedienen.
Was ist eine „pre-grammatische Phase“?
Es ist eine Phase zu Beginn des Spracherwerbs, in der grammatische Regeln noch nicht vollständig gefestigt sind, was zu vermehrten Mischungen führen kann.
- Citar trabajo
- Julia Loewe (Autor), 2001, Sprachmischungen im frühen bilingualen Spracherwerb, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28945