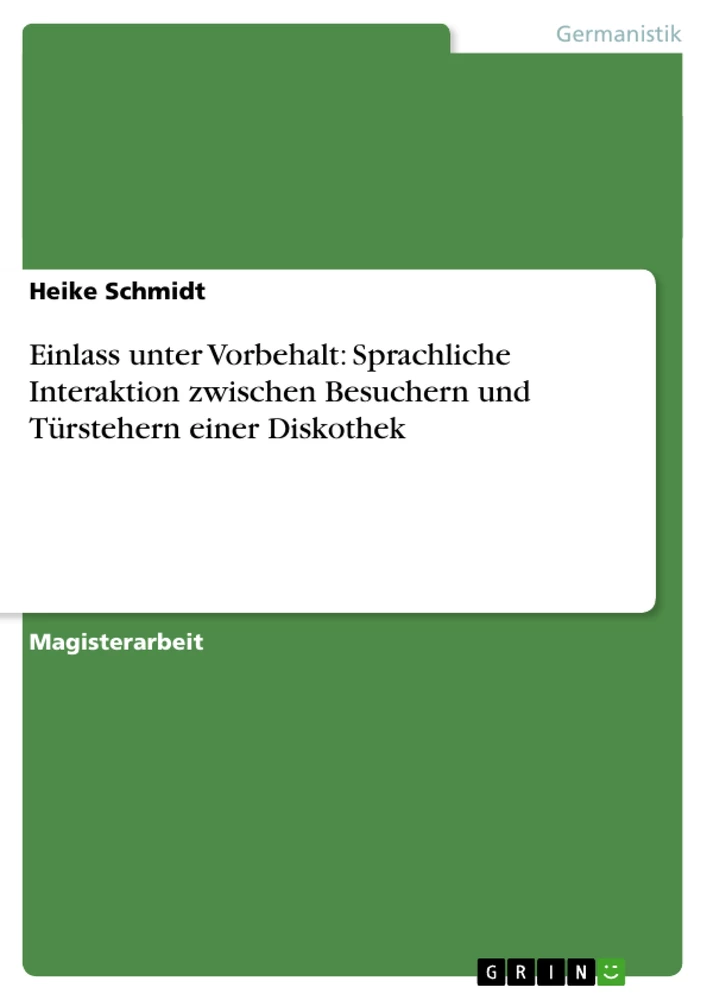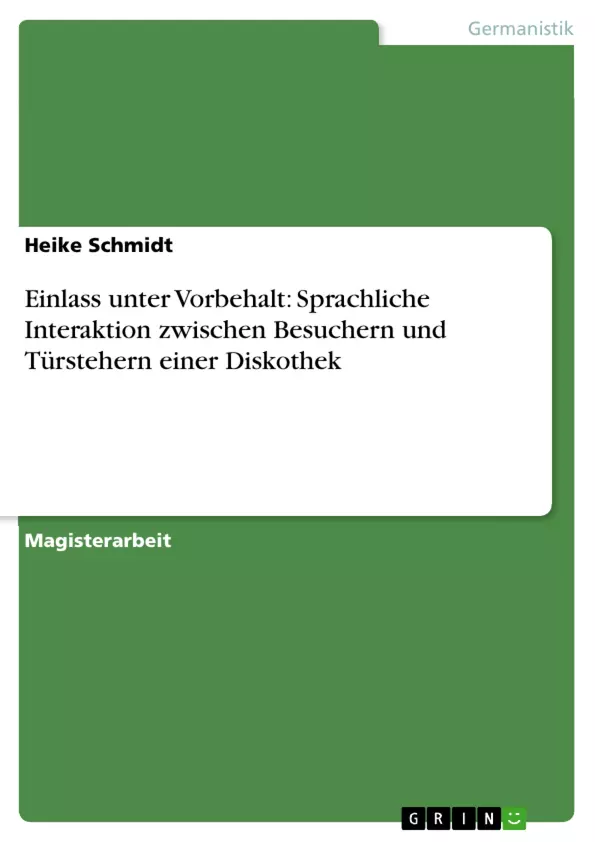Die Selbstcharakterisierung dieser Arbeit als der ethnomethodologischen
Konversationsanalyse verpflichtet verweist bereits auf die zugrundeliegende
Forschungstradition im Bereich der Konversationsanalyse. Darüber hinaus wird diese
Arbeit durch beobachtete Eindrücke im ethnographischen Bezugsrahmen gestützt.
Der Begriff der Ethnographie wurde Ende des vergangenen Jahrhunderts
gebräuchlich, um wissenschaftlich motivierte Beschreibungen nichtwestlicher
Kulturen von nichtwissenschaftlichen Reiseberichten abzugrenzen (vgl. Kallmeyer
1995: 16). Die Ethnographie befasst sich mit der
„Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Darstellung der Kultur
menschlicher Gruppen, die in ihrer Besonderheit dargestellt werden unter
möglichst genauer Rekonstruktion der jeweiligen Lebensform“ (Kallmeyer
1995: 14).
Als empirisches Programm bedient sich die Ethnographie insbesondere des
klassischen Verfahrens der teilnehmenden Beobachtung, wobei in der
ethnographischen Literatur unterschiedliche Formen der Beobachtung unterschieden
werden1.
Die Ethnographie ist nicht ausschließlich deskriptiv, ihre Beobachtungen führen
selbst schon zu ersten Theorieannahmen, die sich strukturell auf die Beschreibung
auswirken können. Geertz drückt dieses Verständnis in seiner Konzeption der „thick
description“ aus: Er versteht die Disziplin als interpretierende Wissenschaft, die nach
Bedeutungen sucht. (Geertz 1983: 9)
„Sie ist deutend; das, was sie deutet, ist ein Ablauf des sozialen Diskurses; und
das Deuten besteht darin, das „Gesagte“ eines solchen Diskurses dem
vergänglichen Augenblick zu entreißen“ (Geertz 1983: 30) Seit Malinowski, der durch seine Arbeiten in den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts zum Mitbegründer der modernen Ethnographie wurde, ist es zum
Standard ethnographischen Arbeitens geworden, die Position des Beobachters zum
Untersuchungsgegenstand näher zu beleuchten, damit es möglich ist, den Umfang, in
dem der Ethnograph selbst zur Gegenstandskonstitution beigetragen hat,
nachzuvollziehen (Schmitt 1992:29). (Vgl. zur Stellung der Autorin zu vorliegendem
Untersuchungsfeld: Kapitel 2.1) [...]
1 Vgl. hierzu Spradley (1980), der zwischen „nonparticipation“, „passive participation“, „moderate
participation“, „active participation “ und „complete participation “ unterscheidet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1 Forschungsüberblick und theoretische Grundlagen
- 1.1 Methoden zur Beschreibung sozialer Umwelt: Ethnographie und Konversationsanalyse
- 1.2 Theoretische Grundlagen
- 1.2.1 Der Begriff des Institutionalität
- 1.2.2 Levinsons Konzept des Aktivitätstyps
- 1.2.3 Der Begriff des Kontextes
- 1.2.4 Interkulturelle Kommunikation
- Kapitel 2 Das Untersuchungsgebiet in der Diskothek Feelings
- 2.1 Kontakt zum Untersuchungsgegenstand und Datenerhebung
- 2.2 Der Schauplatz
- 2.1.1 Die Diskothek
- 2.1.2 Der Eingangsbereich
- 2.3 Die Interaktanten
- 2.2.1 Die Türsteher
- 2.2.2 Die Einlasssuchenden
- 2.2.3 Die Institutionalität der Kontaktsituation zwischen Türsteher und Gast
- Kapitel 3 Der Aktivitätstyp „Zugangsgespräch an der Diskothekentür“
- 3.1 Das Zugangsgespräch als Aktivitätstyp
- 3.1.1 Der sequentielle Ablauf des Aktivitätstyps „Zugangsgespräch“
- 3.1.2 Möglichkeiten der Erweiterung des Sequenztyps
- 3.2 Die unproblematische Einlassgewährung
- 3.3 Einlasssituationen mit Nachfragen des Türpersonals
- 3.3.1 Die Frage nach dem Ausweis
- 3.3.1.1 „Wie alt bist du?“ - Kein Einlass wegen Fehlen des Altersnachweises
- 3.3.1.2 „Die Ausweise bitte“ - Ein Versuch, den Gast kennen zu lernen
- 3.3.2 „Wie fit bist du noch?“ - Vermuteter Alkoholkonsum als Nachfragegrund
- 3.3.1 Die Frage nach dem Ausweis
- 3.4 „Geht nicht“ - Die Einlassverweigerung als Eröffnung der Interaktion
- 3.5 Zusammenfassung
- 3.1 Das Zugangsgespräch als Aktivitätstyp
- Kapitel 4 Interkulturelle Kommunikation an der Diskothekentür
- 4.1 Interkulturelle Kommunikation im institutionellen Kontext
- 4.2 „Wart ihr schon mal hier?“ - Das Entscheidungsfindungsgespräch zwischen Türstehern und Nicht-Muttersprachlern
- 4.3 „Geht nicht“ - Die Einlassverweigerung als Eröffnung der Interaktion mit Nicht-Muttersprachlern
- 4.4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die sprachliche Interaktion zwischen Besuchern und Türstehern einer Diskothek. Ziel ist es, die kommunikativen Muster und Strategien in Einlasssituationen zu analysieren, insbesondere im Hinblick auf Einlassgewährung und -verweigerung. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Institutionalität, die Bedeutung von Kontext und Aktivitätstypen sowie den Einfluss interkultureller Kommunikation.
- Sprachliche Interaktion im Kontext der Diskotheken-Einlasssituation
- Analyse von Einlassgesprächen als Aktivitätstyp
- Rollenverständnis und Machtasymmetrie zwischen Türstehern und Besuchern
- Einfluss interkultureller Kommunikation auf die Einlassentscheidung
- Kommunikative Strategien bei Einlassgewährung und -verweigerung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung von Türstehern. Sie hebt die kommunikative Relevanz der Einlasssituation hervor und benennt die Forschungsfrage: Wie gestaltet sich die sprachliche Interaktion beim Einlass in eine Diskothek, insbesondere bei Einlassverweigerung? Die Arbeit positioniert sich im Kontext der Forschung zur institutionellen Kommunikation und interkultureller Kommunikation, unter Nutzung der Konversationsanalyse und des Konzepts des Aktivitätstyps nach Levinson.
Kapitel 1 Forschungsüberblick und theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt die verwendeten Methoden (Ethnographie und Konversationsanalyse) und erläutert zentrale Konzepte wie Institutionalität, Levinsons Aktivitätstypen, den Kontextbegriff und die Herausforderungen interkultureller Kommunikation. Diese theoretischen Rahmenbedingungen bilden die Basis für die Analyse der empirischen Daten im weiteren Verlauf.
Kapitel 2 Das Untersuchungsgebiet in der Diskothek Feelings: Kapitel 2 beschreibt den Untersuchungsort (die Diskothek Feelings) und die Datenerhebungsmethodik. Es charakterisiert die beteiligten Akteure (Türsteher und Einlasssuchende) und analysiert die Institutionalität der Einlasssituation. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Settings und der beteiligten Personen, um den Kontext der späteren Interaktionsanalyse zu schaffen.
Kapitel 3 Der Aktivitätstyp „Zugangsgespräch an der Diskothekentür“: Dieses Kapitel analysiert das „Zugangsgespräch“ als Aktivitätstyp. Es beschreibt den sequenziellen Ablauf und mögliche Erweiterungen der Sequenz. Die Analyse umfasst sowohl unproblematische Einlassgewährungen als auch Situationen mit Nachfragen des Türpersonals (z.B. nach dem Alter oder dem Alkoholkonsum). Es werden verschiedene Strategien der Einlassverweigerung untersucht und im Detail anhand von Beispielen aus dem Datenkorpus erklärt. Der Schwerpunkt liegt auf der systematischen Analyse der Gesprächsabläufe und ihrer Muster.
Kapitel 4 Interkulturelle Kommunikation an der Diskothekentür: Kapitel 4 befasst sich mit interkulturellen Aspekten der Kommunikation an der Diskothekentür. Es untersucht, wie die Interaktion in Situationen mit Nicht-Muttersprachlern gestaltet wird und wie kulturelle Unterschiede die Einlassentscheidung beeinflussen. Dabei werden spezifische kommunikative Herausforderungen und Strategien der beteiligten Akteure beleuchtet. Das Kapitel untersucht, ob und wie sich die Kommunikation in solchen interkulturellen Kontexten von den monolingualen Situationen unterscheidet.
Schlüsselwörter
Türsteher, Diskothek, Einlasskontrolle, Sprachliche Interaktion, Konversationsanalyse, Aktivitätstyp, Institutionalität, Interkulturelle Kommunikation, Einlassgewährung, Einlassverweigerung, Kommunikationsstrategien, Machtasymmetrie, Ethnographie.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Sprachliche Interaktion an der Diskothekentür
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die sprachliche Interaktion zwischen Besuchern und Türstehern einer Diskothek. Der Fokus liegt auf der Analyse kommunikativer Muster und Strategien in Einlasssituationen, insbesondere bei Einlassgewährung und -verweigerung.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nutzt qualitative Methoden, insbesondere die Konversationsanalyse und ethnographische Beobachtungen. Die Konversationsanalyse dient der detaillierten Untersuchung der Gesprächsabläufe, während die Ethnographie den Kontext der Interaktion im Diskotheken-Setting beschreibt.
Welche theoretischen Konzepte werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf Konzepte der institutionellen Kommunikation, inklusive des Begriffs der Institutionalität, sowie auf Levinsons Konzept des Aktivitätstyps. Der Einfluss interkultureller Kommunikation wird ebenfalls berücksichtigt.
Wo fand die Untersuchung statt?
Die Untersuchung fand in der Diskothek "Feelings" statt.
Welche Akteure werden in der Studie betrachtet?
Die Studie betrachtet die Interaktion zwischen Türstehern (als Repräsentanten der Institution) und den Einlasssuchenden (den Gästen der Diskothek).
Was ist der zentrale Forschungsgegenstand?
Der zentrale Forschungsgegenstand ist das „Zugangsgespräch“ an der Diskothekentür als Aktivitätstyp. Die Arbeit analysiert den sequentiellen Ablauf dieser Gespräche, verschiedene Strategien der Einlassgewährung und -verweigerung und den Einfluss interkultureller Kommunikation.
Welche Aspekte der Interaktion werden analysiert?
Die Analyse umfasst unproblematische Einlassgewährungen, Situationen mit Nachfragen des Türpersonals (z.B. nach dem Alter oder Alkoholkonsum) und verschiedene Strategien der Einlassverweigerung. Besonderes Augenmerk liegt auf der kommunikativen Gestaltung dieser Interaktionen und den beteiligten Strategien.
Wie wird der Einfluss interkultureller Kommunikation berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Interaktion in Situationen mit Nicht-Muttersprachlern gestaltet und wie kulturelle Unterschiede die Einlassentscheidung beeinflussen. Es werden spezifische kommunikative Herausforderungen und Strategien in interkulturellen Kontexten beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit dem Forschungsüberblick und theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur Beschreibung des Untersuchungsgebietes (Diskothek Feelings), ein Kapitel zur Analyse des Aktivitätstyps „Zugangsgespräch“ und ein Kapitel zur interkulturellen Kommunikation an der Diskothekentür. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Türsteher, Diskothek, Einlasskontrolle, Sprachliche Interaktion, Konversationsanalyse, Aktivitätstyp, Institutionalität, Interkulturelle Kommunikation, Einlassgewährung, Einlassverweigerung, Kommunikationsstrategien, Machtasymmetrie, Ethnographie.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie gestaltet sich die sprachliche Interaktion beim Einlass in eine Diskothek, insbesondere bei Einlassverweigerung?
- Quote paper
- Heike Schmidt (Author), 2003, Einlass unter Vorbehalt: Sprachliche Interaktion zwischen Besuchern und Türstehern einer Diskothek, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29148