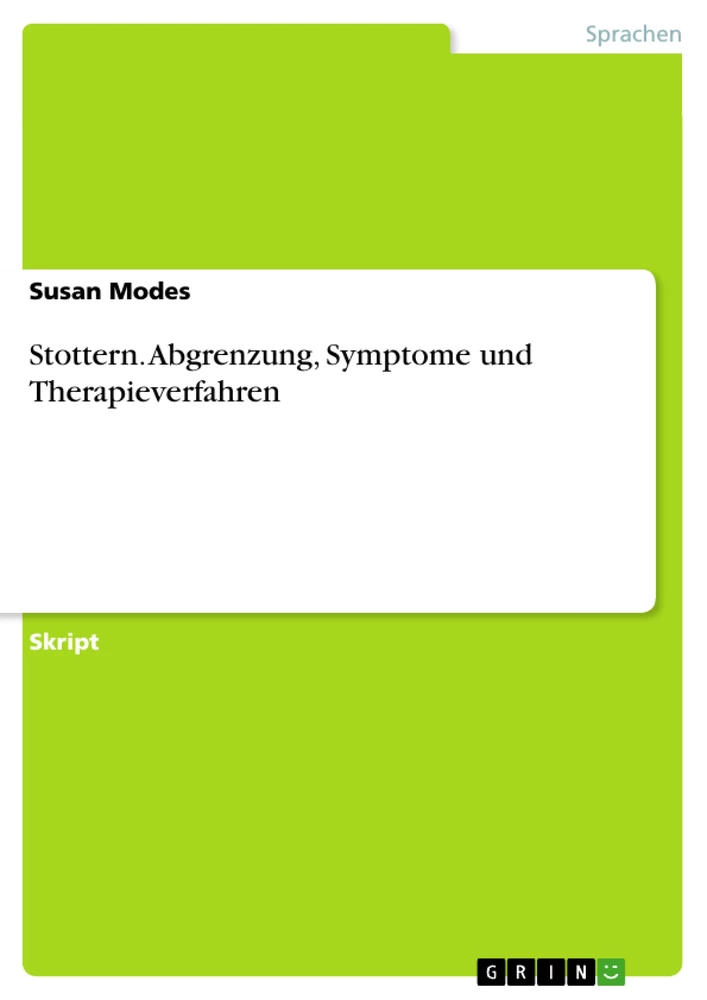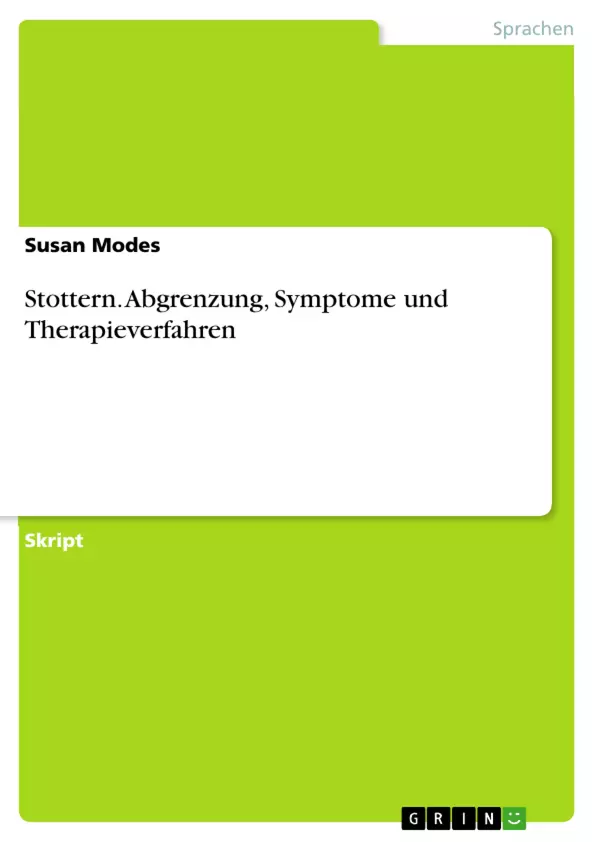Lidcombe basiert auf dem verhaltenstherapeutischen Ansatz.
Die therapeutischen Interventionen stützen sich auf das operante Konditionieren.
Während dieses Programmes werden keine Sprechtechniken angewendet oder eingeübt.
Somit handelt es sich hier eher um einen Fluency-Shaping-Ansatz. Damit ein Kind nach diesem Ansatz therapiert werden kann, sollte es mindestens 3 Jahre alt sein
und seit 6 Monaten stottern. Bei großem Leidensdruck des Kindes oder der Eltern liegt eventuell eine familiäre Komponente vor oder es besteht ein hoher Schweregrad des Stotterns.
Hier kann auch früher mit der Behandlung begonnen werden.
Lidcombe und KIDS (Kinder dürfen stottern) sind Therapieverfahren zur Behandlung von Stottern im Kindesalter. Ihre Ziele bestehen darin, das Stottern weitgehend oder vollkommen zu eliminieren.
Inhaltsverzeichnis
- Stottern - Abgrenzung, Symptome und Therapieverfahren
- Abgrenzung funktioneller Unflüssigkeiten von symptomatischen Unflüssigkeiten
- Indikationen für sprachtherapeutische Interventionen
- Therapiebausteine
- Therapieverfahren
- Lidcombe- Verfahren
- KIDS- Verfahren
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Phänomen des Stotterns, seiner Abgrenzung von anderen Sprechflüssigkeitsstörungen, seinen Symptomen und den gängigen Therapieverfahren. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Ursachen, die Entwicklung und die Behandlung des Stotterns zu vermitteln.
- Abgrenzung von funktionellen und symptomatischen Unflüssigkeiten
- Indikationen für sprachtherapeutische Interventionen
- Therapiebausteine und -verfahren
- Das Lidcombe-Verfahren und das KIDS-Verfahren
- Die Bedeutung der Elternarbeit und der Gruppentherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Textes befasst sich mit der Abgrenzung von funktionellen (physiologischen) Unflüssigkeiten von symptomatischen Unflüssigkeiten. Es werden die verschiedenen Ursachen, Symptome und Altersstufen der beiden Formen von Sprechflüssigkeitsstörungen erläutert. Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Stotterns von den ersten Anzeichen bis hin zum manifesten Stottern und beschreibt die verschiedenen Symptome, die mit dem Stottern einhergehen können.
Das zweite Kapitel behandelt die Indikationen für sprachtherapeutische Interventionen. Es werden die verschiedenen Risikofaktoren des Stotterns und die Untersuchungskriterien für die Diagnose einer Stotterstörung vorgestellt. Das Kapitel erläutert die Bedeutung der Elternarbeit und der frühzeitigen Intervention bei Stottern.
Das dritte Kapitel widmet sich den Therapiebausteinen und -verfahren, die bei der Behandlung von Stottern eingesetzt werden. Es werden verschiedene Therapieansätze vorgestellt, die sich auf die Atemtherapie, die Körpersprache, den emotionalen Ausdruck und die Förderung der Sprechfreude konzentrieren. Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Techniken, die in der Therapie eingesetzt werden, um das Stottern zu reduzieren und die Sprechflüssigkeit zu verbessern.
Das vierte Kapitel stellt zwei gängige Therapieverfahren für Stottern vor: das Lidcombe-Verfahren und das KIDS-Verfahren. Es werden die Prinzipien, die Anwendung und die Wirksamkeit der beiden Verfahren erläutert. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Elternarbeit und der Gruppentherapie bei der Behandlung von Stottern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stottern, Sprechflüssigkeit, Unflüssigkeiten, Therapie, Lidcombe-Verfahren, KIDS-Verfahren, Elternarbeit, Gruppentherapie, Symptome, Ursachen, Abgrenzung, Indikationen, Therapiebausteine, Therapieverfahren.
Häufig gestellte Fragen
Wie grenzt man normales Sprechverweilen von Stottern ab?
Es wird zwischen funktionellen (physiologischen) Unflüssigkeiten, die in der Entwicklung normal sind, und symptomatischen Unflüssigkeiten, die auf eine Stotterstörung hinweisen, unterschieden.
Was ist das Lidcombe-Verfahren?
Lidcombe ist ein verhaltenstherapeutisches Programm für Kinder ab 3 Jahren, das auf operantem Konditionieren basiert und ohne spezielle Sprechtechniken auskommt.
Was unterscheidet das KIDS-Verfahren vom Lidcombe-Ansatz?
KIDS („Kinder dürfen stottern“) ist ein Stottermodifikations-Ansatz, bei dem es eher darum geht, angstfrei und lockerer mit dem Stottern umzugehen, während Lidcombe auf die Eliminierung der Symptome zielt.
Wann sollte eine Sprachtherapie bei Stottern beginnen?
Eine Intervention wird empfohlen, wenn das Stottern länger als 6 Monate anhält, ein hoher Leidensdruck bei Kind oder Eltern besteht oder Risikofaktoren wie eine familiäre Häufung vorliegen.
Welche Rolle spielen die Eltern in der Stottertherapie?
Elternarbeit ist essenziell, da sie in Programmen wie Lidcombe die Therapie im Alltag durchführen und lernen müssen, angemessen auf die Sprechunflüssigkeiten ihres Kindes zu reagieren.
- Quote paper
- Martina Terhagen (Author), 2013, Stottern. Abgrenzung, Symptome und Therapieverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292822