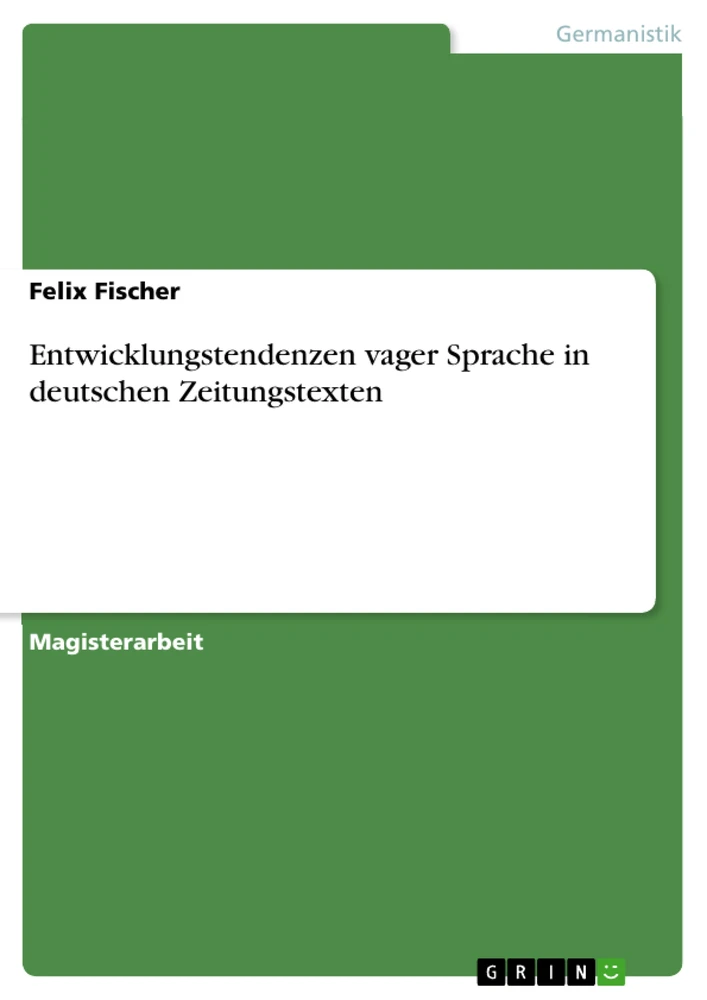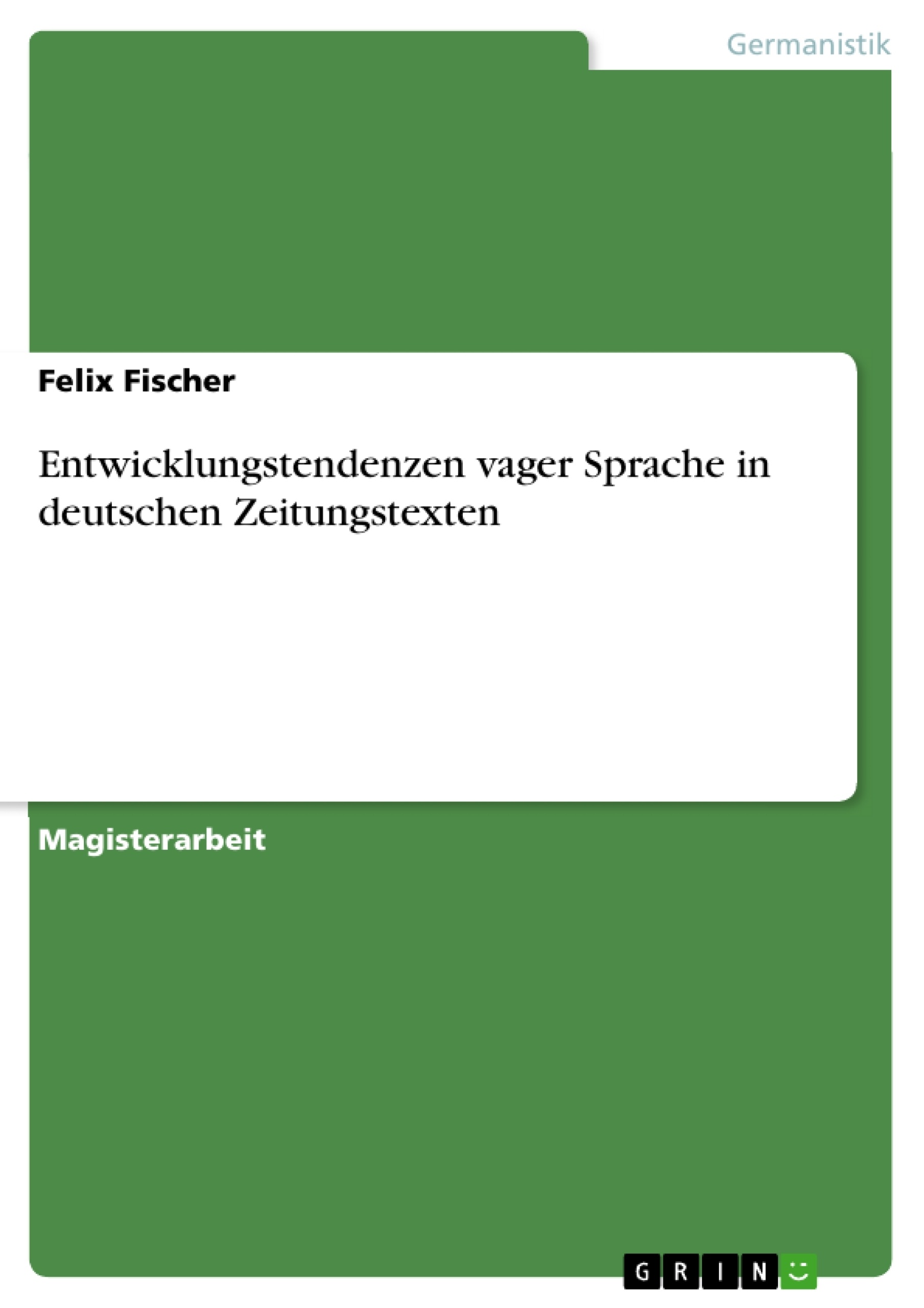Bei einer repräsentativen Studie zum Journalismus in Deutschland haben 88,6% der befragten Journalisten angegeben, dass es zu ihrem Rollenselbstverständnis gehört, „das Publikum möglichst neutral und präzise“ zu informieren (Weischenberg et al. 2006: S. 356). Nicht belegt ist, was sie darunter genau verstehen und wie gut es ihnen in der täglichen Arbeit gelingt, diesem Ziel gerecht zu werden. Voraussetzung für eine präzise Berichterstattung sind in der Regel aufwändige Recherchen, bei denen manchmal nur wenig Konkretes herauskommt. Im redaktionellen Alltag konkurriert der Präzisionsanspruch zudem mit anderen Zielen, wie Aktualität, Relevanz oder Publikumswirksamkeit.
Präzision ist kein Selbstzweck: Zuviel davon lässt einen Zeitungstext schnell akademisch wirken und bringt dem Leser meistens keinen zusätzlichen Nutzen. Übertriebene Genauigkeit kann sogar schaden, wenn dadurch das Leseverständnis leidet. Ein gezielter Einsatz von Vagheit kann den Rezipienten dagegen helfen, zu erkennen, auf welche Informationen sie ihre Aufmerksamkeit richten sollten (vgl. Jucker et al. 2003: S. 1737). Pan (2012) argumentiert, dass vage Sprache auch helfen kann, die Genauigkeit von Zeitungsinhalten zu verbessern. Dies ist z. B. der Fall, wenn präzise Zahlenangaben zu einem aktuellen Ereignis noch nicht vorliegen und Reporter mit Formulierungen, wie mindestens oder bis zu, diesen Unsicherheitsbereich in ihrem Kenntnisstand transparent machen. Tatsächlich können vage Ausdrücke also erforderlich sein, um möglichst präzise zu informieren.
Nicht jeder Journalist geht gleichermaßen redlich mit den sprachlichen Mitteln um. Besonders Boulevardzeitungen sind dafür bekannt, im Kampf um die Aufmerksamkeit der Leser, zu dramatisieren, zu skandalisieren, und sogar zu verfälschen. Das belegen mehr als 6000 Einträge im BILDblog, die „sachliche Fehler, Sinnentstellendes und bewusst Irreführendes in den Berichterstattungen“ deutscher Medien dokumentieren, wie es in der Eigenbeschreibung heißt. Vage Sprache eignet sich eben auch für Sensationsjournalismus, weil sie es ermöglicht, Übertreibungen zu verschleiern und unrealistische Vorstellungen hervorzurufen. Andererseits verzichten die entsprechenden Blätter oft auf vage Formulierungen, wo sie eigentlich zur Kenntlichmachung ungesicherter Informationen angebracht wären und präsentieren diese stattdessen als Fakten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theorie und Methoden
- 1. Untersuchte Kollektive
- 1.1. Vage Sprache
- 1.2. Deutsche Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts
- 2. Material
- 2.1. Inventar vager Ausdrücke
- 2.2. DWDS-Kernkorpus 20.
- 3. Methoden
- 3.1. Korpusanalyse
- 3.2. Datenerhebung
- 3.3. Datenaufbereitung
- 3.4. Datenauswertung
- III. Ergebnisse
- 1. Hypothesentest
- 2. Entwicklungstendenzen
- 2.1. vage Mengenwörter
- 2.2. vage Frequenzwörter
- 2.3. Zahlen-Approximatoren
- 2.4. Shields
- 2.5. Kategorievergleich
- 2.6. Einzelne Ausdrücke
- 3. Kritik
- IV. Zusammenfassung
- V. Ausblick
- 1. Verwertung
- 2. Weiterentwicklung
- VI. Literaturverzeichnis
- VII. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Entwicklungstendenzen vager Sprache in deutschen Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts. Ziel ist die Quantifizierung und der Vergleich des Vagheitsgrades in verschiedenen Dekaden. Die Arbeit analysiert, wie sich der Gebrauch vager Sprache im Laufe der Zeit verändert hat und welche Einflüsse (z.B. politische Ereignisse, journalistische Stilentwicklungen) diese Entwicklungen möglicherweise geprägt haben.
- Quantifizierung der Vagheit in deutschen Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts
- Vergleich des Vagheitsgrades über verschiedene Dekaden
- Analyse der Entwicklungstendenzen vager Sprache
- Untersuchung möglicher Einflussfaktoren auf die Entwicklung
- Bewertung der Ergebnisse im Kontext bestehender Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den Anspruch auf präzise Berichterstattung im Journalismus beleuchtet und gleichzeitig die Notwendigkeit und Funktion von Vagheit in der Sprache diskutiert. Sie thematisiert den Gegensatz zwischen dem Ideal der neutralen und präzisen Information und der Realität journalistischer Praxis, in der Faktoren wie Aktualität, Relevanz und Publikumswirksamkeit eine Rolle spielen. Die Arbeit von Grice (1967) zur Quantitätsmaxime wird eingeführt, um den Kontext von Präzision und Vagheit in der Kommunikation zu verdeutlichen. Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage nach der Entwicklung von Vagheit in deutschen Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts und die Methodik der Untersuchung, welche einen quantitativen Vergleich von Korpora aus verschiedenen Dekaden vorsieht. Die Bedeutung des Vergleichs von Texten unterschiedlicher Zeitperioden zur Erkennung überindividueller Tendenzen wird hervorgehoben.
II. Theorie und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen und die methodischen Ansätze der Arbeit. Es definiert den Begriff „vage Sprache“ und erläutert die Auswahl der untersuchten Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts. Das Kapitel detailliert die verwendeten Materialien, darunter ein Inventar vager Ausdrücke und das DWDS-Kernkorpus. Es werden die Methoden der Korpusanalyse, Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung ausführlich erklärt. Das Kapitel legt den methodischen Rahmen für die empirische Untersuchung fest und begründet die gewählten Verfahren.
III. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Korpusanalyse. Es beschreibt zunächst den Hypothesentest und legt dann die Entwicklungstendenzen vager Sprache in deutschen Zeitungstexten des 20. Jahrhunderts dar. Die Analyse umfasst verschiedene Kategorien vager Ausdrücke, wie Mengenwörter, Frequenzwörter, Zahlen-Approximatoren und sogenannte „Shields“. Ein detaillierter Kategorievergleich und die Untersuchung einzelner Ausdrücke liefern ein umfassendes Bild der Entwicklung. Der Abschnitt "Kritik" bewertet die Ergebnisse und deren Grenzen im Kontext der Methodik.
Schlüsselwörter
Vage Sprache, deutsche Zeitungstexte, 20. Jahrhundert, Korpusanalyse, Quantifizierung, Entwicklungstendenzen, Mengenwörter, Frequenzwörter, Zahlen-Approximatoren, Journalismus, Präzision, Vagheitsmarker, Historische Entwicklung, Stilistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Entwicklungstendenzen vager Sprache in deutschen Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Entwicklungstendenzen vager Sprache in deutschen Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Quantifizierung und dem Vergleich des Vagheitsgrades über verschiedene Dekaden hinweg. Analysiert wird, wie sich der Gebrauch vager Sprache im Laufe der Zeit verändert hat und welche Faktoren (z.B. politische Ereignisse, journalistische Stilentwicklungen) diese Entwicklungen beeinflusst haben könnten.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quantitative Methode basierend auf Korpusanalyse. Es wurde ein Inventar vager Ausdrücke erstellt und das DWDS-Kernkorpus des 20. Jahrhunderts herangezogen. Die Analyse umfasst Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung, um die Entwicklungstendenzen vager Sprache zu quantifizieren und zu vergleichen.
Welche Arten von vager Sprache wurden untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene Kategorien vager Ausdrücke, darunter Mengenwörter, Frequenzwörter, Zahlen-Approximatoren und sogenannte "Shields". Die Arbeit untersucht die Entwicklung dieser Kategorien im Zeitverlauf und vergleicht deren Häufigkeit in unterschiedlichen Dekaden.
Welche Zeiträume werden in der Studie betrachtet?
Die Studie analysiert deutsche Zeitungstexte des gesamten 20. Jahrhunderts, wobei ein Vergleich des Vagheitsgrades über verschiedene Dekaden hinweg im Mittelpunkt steht.
Welche Datenquellen wurden verwendet?
Die Hauptdatenquelle ist das DWDS-Kernkorpus des 20. Jahrhunderts. Zusätzlich wurde ein eigenes Inventar vager Ausdrücke erstellt, das als Grundlage für die Analyse dient.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Korpusanalyse werden im Kapitel III präsentiert. Sie beinhalten einen Hypothesentest und die Darstellung der Entwicklungstendenzen vager Sprache. Ein detaillierter Kategorievergleich und die Untersuchung einzelner Ausdrücke liefern ein umfassendes Bild der Entwicklung im 20. Jahrhundert. Die Ergebnisse werden kritisch bewertet und ihre Grenzen im Kontext der Methodik diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Vage Sprache, deutsche Zeitungstexte, 20. Jahrhundert, Korpusanalyse, Quantifizierung, Entwicklungstendenzen, Mengenwörter, Frequenzwörter, Zahlen-Approximatoren, Journalismus, Präzision, Vagheitsmarker, Historische Entwicklung, Stilistik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theorie und Methoden, Ergebnisse (inkl. Hypothesentest und Kritik), Zusammenfassung, Ausblick (inkl. Verwertung und Weiterentwicklung), Literaturverzeichnis und Anhang. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im HTML-Code der Originalfassung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Magisterarbeit zielt darauf ab, die Entwicklungstendenzen vager Sprache in deutschen Zeitungstexte des 20. Jahrhunderts zu quantifizieren und zu vergleichen. Sie untersucht, wie sich der Gebrauch vager Sprache über verschiedene Dekaden verändert hat und welche Faktoren diese Entwicklungen beeinflusst haben könnten.
Wie wird die Vagheit in der Sprache definiert?
Die genaue Definition von "vager Sprache" wird im Kapitel "Theorie und Methoden" erläutert. Es wird darauf eingegangen, wie Vagheit im Kontext journalistischer Texte verstanden und operationalisiert wird.
- Citation du texte
- Felix Fischer (Auteur), 2014, Entwicklungstendenzen vager Sprache in deutschen Zeitungstexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292861