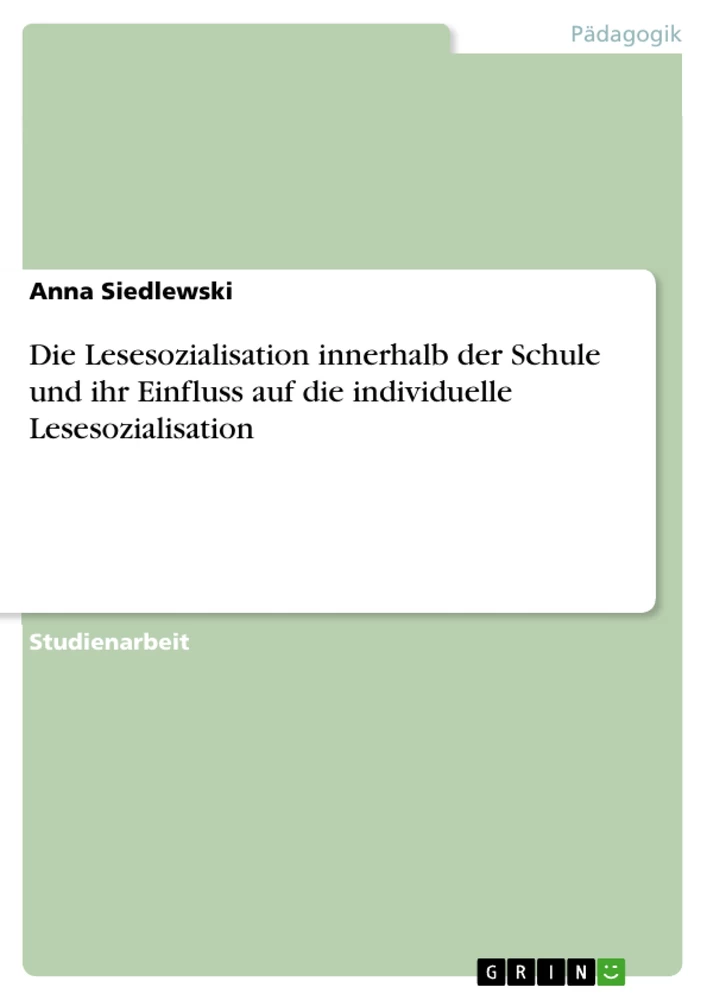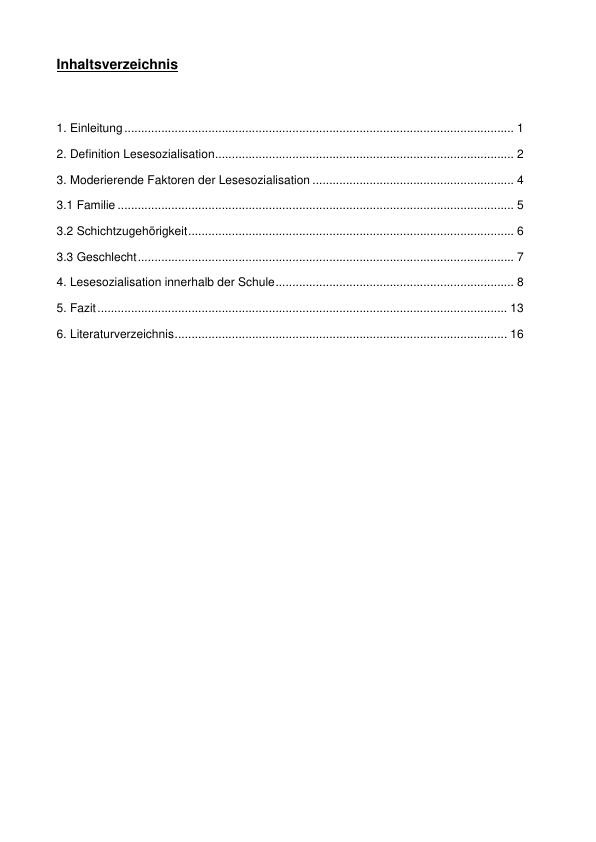Der Fähigkeit des Lesens kommt innerhalb des aktuellen Zeitalters eine besondere Bedeutung zu.
So ermöglicht das Decodieren von Schrift und das Verständnis von geschriebenen Informationen unter anderem eine aktive Teilnahme an der kulturellen und sozialen Gesellschaft der Moderne.
Dem Lesen kommt trotz der Zunahme von medialen Weiterentwicklungen und neuer Technologien innerhalb der heutigen Gesellschaft eine ungebrochene Relevanz zu. Anstatt durch innovative Entwicklungen im Bereich moderner Medien an Bedeutung zu verlieren, steht das Lesen diesen in keinem strikt konkurrierenden Verhältnis gegenüber, sondern bildet stattdessen den Ursprung für sämtliche weitere Medienprozesse (Groeben 2004a:11ff.).
Ob sich eine Person im Laufe ihres Lebens zu einem kompetenten Leser entwickelt oder nicht, lässt sich nicht verallgemeinernd feststellen. Allerdings lassen sich durch die Erforschung der sogenannten „Lesesozialisation“ verschiedene Faktoren und Merkmale ermitteln, welche einen relevanten Einfluss auf die Herausbildung von Lesekompetenzen und einer positiven Sozialisation durch das Lesen besitzen (Groeben 2004a:16ff.).
Der gesellschaftlichen Institution der Schule kommt dabei eine tragende Rolle zu, da diese das Individuum durch den Unterricht in die schriftliche und literarische Kultur einführen soll. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern diese kollektive Sozialisationsinstanz durch ihr Wirken die Lesesozialisation von heranwachsenden Gesellschaftsmitgliedern begünstigen und unterstützen kann.
Wie werden lesefördernd-ausgerichtete Vorgaben im Bereich des (Literatur-)Unterrichts möglichst erfolgsversprechend umgesetzt?
Wird die Schule ihrer Aufgabe als sozialisierende Instanz bezüglich der Problematik einer erfolgreichen Lesesozialisation durch Umsetzung gesellschaftlicher Standards gerecht?
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich zur Untersuchung dieser Fragen mit dem Einfluss von erzieherischen und sozialisierenden Aspekten der Instanz Schule auf die Herausbildung von Motivationen und Kompetenzen des Lesens.
Ziel ist es, aufzuzeigen, inwiefern die Schule den Prozess der Lesesozialisation begünstigt. Der Fokus liegt dabei im Besonderen bei der Betrachtung von Kindern, welche die Grundschule besuchen und sich somit in den Anfängen der Herausbildung ihrer Lesefertigkeiten befinden.
Dabei wird zunächst der Begriff der Sozialisation im Allgemeinen definiert und genauer erläutert, was unter dem sich dabei vollziehenden Prozess verstanden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Lesesozialisation
- Moderierende Faktoren der Lesesozialisation
- Familie
- Schichtzugehörigkeit
- Geschlecht
- Lesesozialisation innerhalb der Schule
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Einfluss der Schule auf die Lesesozialisation von Kindern im Grundschulalter. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie die Schule den Prozess der Lesesozialisation begünstigt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Der Fokus liegt dabei auf der Betrachtung der Motivation und Kompetenzentwicklung im Bereich des Lesens.
- Definition und Bedeutung der Lesesozialisation
- Einflussfaktoren auf die Lesesozialisation (Familie, Schichtzugehörigkeit, Geschlecht)
- Rolle der Schule bei der Lesesozialisation
- Fördernde und hinderliche Aspekte des Unterrichts
- Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Lesesozialisation ein und erläutert die Bedeutung des Lesens in der heutigen Gesellschaft. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Schule auf die Lesesozialisation und die Zielsetzung der Arbeit dar.
Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Lesesozialisation definiert und in den Kontext der allgemeinen Sozialisation eingebettet. Die Begriffe „Lesekompetenz“ und „Lesemotivation“ werden näher beleuchtet und in ihrer Verbindung zur Lesesozialisation dargestellt.
Kapitel drei analysiert die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Lesesozialisation, darunter die Familie, die Schule, die soziale Schicht und das Geschlecht. Die Rolle der Familie als besonders bedeutsame Sozialisationsinstanz wird hervorgehoben.
Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse der Auswirkungen der Schule auf die Lesesozialisation. Es untersucht die Einwirkung des Unterrichts auf die Lesefähigkeit und die Motivation zum Lesen, wobei der Fokus auf der Grundschule liegt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Lesesozialisation, die Lesekompetenz, die Lesemotivation, die Schule als Sozialisationsinstanz, die Familie, die Schichtzugehörigkeit, das Geschlecht und die Bedeutung des Lesens in der heutigen Gesellschaft. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Schule auf die Lesesozialisation von Kindern im Grundschulalter und beleuchtet die Faktoren, die die Entwicklung von Lesefähigkeiten und Motivationen beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Lesesozialisation"?
Lesesozialisation beschreibt den Prozess, in dem ein Individuum die Fähigkeit und Motivation zum Lesen erwirbt und in die schriftliche und literarische Kultur einer Gesellschaft hineinwächst.
Welchen Einfluss hat die Schule auf die Lesemotivation?
Die Schule fungiert als kollektive Sozialisationsinstanz. Durch den Literaturunterricht kann sie Freude am Lesen wecken oder durch zu starre Vorgaben die Motivation hemmen, besonders im wichtigen Grundschulalter.
Welche Rolle spielt die Familie bei der Lesesozialisation?
Die Familie ist die primäre Instanz. Vorlesen, der Zugang zu Büchern im Haushalt und das Vorbild der Eltern sind entscheidend für die Herausbildung früher Lesefertigkeiten und einer positiven Einstellung zum Lesen.
Wie beeinflussen Schichtzugehörigkeit und Geschlecht das Leseverhalten?
Studien zeigen, dass Kinder aus bildungsnahen Schichten oft bessere Startbedingungen haben. Zudem gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Lesemotivation, die die Schule durch gezielte Förderung ausgleichen muss.
Ist Lesen in Zeiten moderner Medien noch relevant?
Ja, Lesen bildet den Ursprung für sämtliche weitere Medienprozesse. Trotz neuer Technologien bleibt das Decodieren von Schrift die Grundvoraussetzung für die aktive Teilnahme an der modernen Informationsgesellschaft.
- Citar trabajo
- Anna Siedlewski (Autor), 2013, Die Lesesozialisation innerhalb der Schule und ihr Einfluss auf die individuelle Lesesozialisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292886