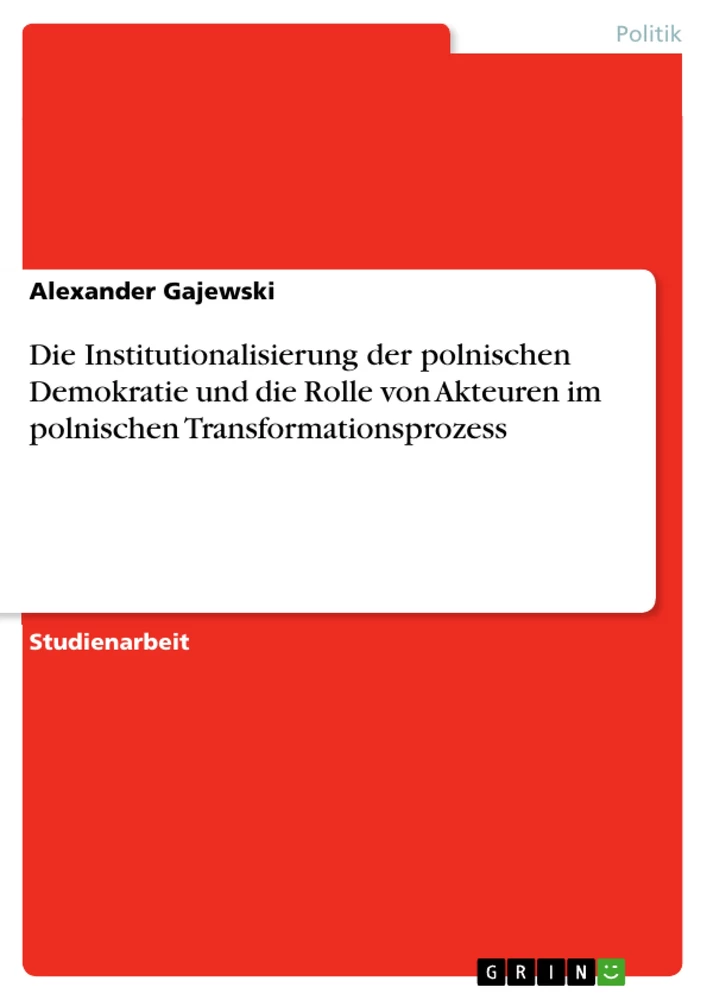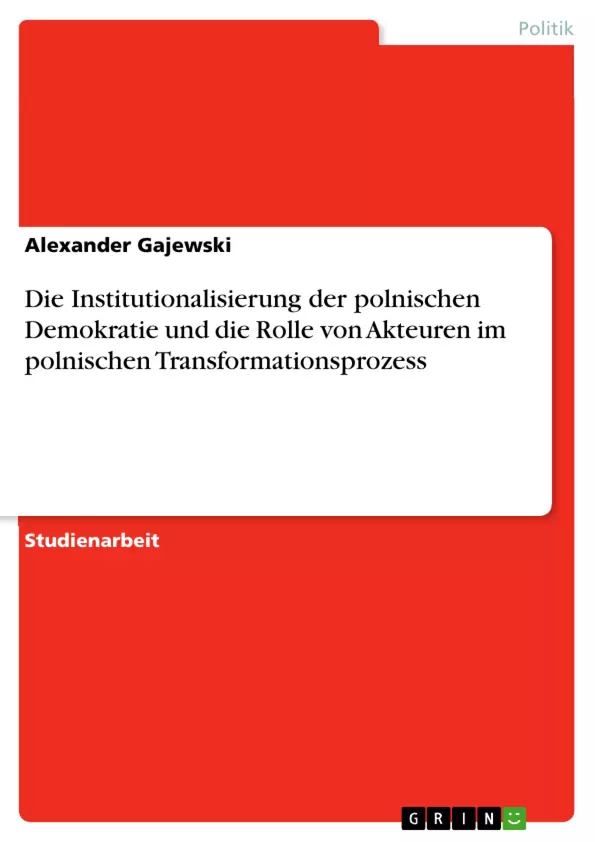Als 1989/1990 die kommunistischen Systeme in Osteuropa zusammenbrachen und der Eiserne Vorhang endgültig fiel, endete eine Zeit, die seit dem 2. Weltkrieg von der Rivalität zweier unterschiedlicher Weltanschauungen geprägt war. Die kommunistischen Staaten in Osteuropa hatten sich stets in der Tradition marxistisch-leninistischer Ideen verstanden und fühlten sich, durch ihren Anspruch eine egalitäre Gesellschaft zu schaffen, dem Westen, dessen Wirtschaft nach dem Konkurrenz- und Leistungsprinzip funktionierte und so soziale Disparitäten begünstigte, stets überlegen. Warum es letztendlich zu einem kompletten und rapiden Zusammenbruch der kommunistischen Systeme kam, ist bis heute nicht übereinstimmend geklärt worden. Es besteht keine Einigkeit bei den Autoren darüber, welches die Hauptursachen von Transformationsprozessen sind. Lediglich darüber, dass bei den osteuropäischen Transitionen in ihrer Komplexität eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden müssen, besteht Konsens. So weist jede Theorie in der Transformationsforschung gewisse Schwachstellen bei der Betrachtung von Systemwechseln auf, weswegen eine Synthese verschiedener Theoriestränge als angemessen erscheint, um Systemwechsel vor allem in der Wechselwirkung verschiedener Faktoren erklären zu können.
Besonders Polen spielte bei den osteuropäischen Transformationsprozessen eine wichtige Vorreiterrolle, weswegen die Entwicklungen, die Polen den Übergang zur Demokratie ermöglichten, auch wegweisend für andere Länder in Osteuropa waren, die sich durchaus ähnlichen Problemen, bedingt durch vergleichbare System-, Wirtschafts-, und Sozialstrukturen, gegenüber sahen.
Deswegen soll in dieser Arbeit der „ausgehandelte Systemwechsel“ am Fallbeispiel Polen vorgestellt werden. Dabei wird von der Behauptung ausgegangen, dass handelnde Akteure die wichtigste Rolle beim Transformationsprozess in Polen spielten und System-, Struktur-, und Kulturtheorien lediglich den Rahmen vorgaben, in dem sich die Akteure bewegen konnten. Im Laufe der Arbeit soll also die Frage beantwortet werden, ob handelnde Akteure mit ihren Strategien, Präferenzen aber auch Fehleinschätzungen den Systemwechsel weitgehend bestimmen oder ob während der Handlungen der Akteure andere Faktoren eine gewichtigere Rolle spielten. Dies lässt sich allerdings nicht allgemeingültig bestimmen, sondern variiert von Transformationsfall zu Transformationsfall [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenbedingungen und Krisenpotenziale
- Das Ende des autoritären Regimes
- Die Situation der Jahre 1980/81
- Der Weg zum „Runden Tisch" 1988/89
- Institutionalisierung der polnischen Demokratie
- Akteure am „Runden Tisch"
- Solidarnosc
- Regimeelite
- Die erste Verhandlungsrunde
- Die zweite Verhandlungsrunde
- Akteure am „Runden Tisch"
- Probleme der Konsolidierung
- Fazit: Die herausragende Rolle politischer Akteure
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den „ausgehandelten Systemwechsel“ in Polen und analysiert die Rolle von Akteuren im Transformationsprozess. Sie argumentiert, dass handelnde Akteure mit ihren Strategien und Präferenzen den Systemwechsel maßgeblich beeinflusst haben, während System-, Struktur- und Kulturtheorien lediglich den Rahmen für ihr Handeln vorgegeben haben. Die Arbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen und Krisenpotenzialen, die zur Bildung einer fähigen Opposition führten, sowie mit dem Ende des autoritären Regimes und der Institutionalisierung der polnischen Demokratie. Dabei werden die Kräfteverhältnisse der Akteure, ihre Präferenzen und Strategien sowie ihr Durchsetzungsvermögen analysiert.
- Die Rolle von Akteuren im polnischen Transformationsprozess
- Die Rahmenbedingungen und Krisenpotenziale des kommunistischen Regimes
- Das Ende des autoritären Regimes und die Entstehung der Solidarnosc
- Die Institutionalisierung der polnischen Demokratie durch den „Runden Tisch“
- Die Herausforderungen der Konsolidierung der polnischen Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des polnischen Transformationsprozesses für die osteuropäischen Systemwechsel dar und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie argumentiert, dass die Rolle von Akteuren im Transformationsprozess von großer Bedeutung ist und dass System-, Struktur- und Kulturtheorien lediglich den Rahmen für ihr Handeln vorgeben.
Das zweite Kapitel beschreibt die Rahmenbedingungen und Krisenpotenziale, die zur Bildung einer fähigen Opposition in Polen führten. Es analysiert die systeminternen Spezifika des kommunistischen Regimes, die zu einer politischen Krise führten.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Ende des autoritären Regimes in Polen. Es analysiert die Situation der Jahre 1980/81, die Entstehung der Solidarnosc und den Weg zum „Runden Tisch“ 1988/89.
Das vierte Kapitel untersucht die Institutionalisierung der polnischen Demokratie. Es analysiert die Akteure am „Runden Tisch“, ihre Präferenzen und Strategien sowie die Ergebnisse der Verhandlungen.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Problemen der Konsolidierung der polnischen Demokratie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Transformationsprozess in Polen, die Rolle von Akteuren, die Institutionalisierung der Demokratie, die Solidarnosc, der „Runde Tisch“, die Rahmenbedingungen und Krisenpotenziale des kommunistischen Regimes sowie die Herausforderungen der Konsolidierung der polnischen Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten politische Akteure beim Systemwechsel in Polen?
Die Arbeit argumentiert, dass handelnde Akteure mit ihren Strategien und Präferenzen die wichtigste Rolle spielten und den Systemwechsel weitgehend bestimmten.
Was war der „Runde Tisch“ in Polen?
Der „Runde Tisch“ (1988/89) war ein Verhandlungsprozess zwischen der kommunistischen Regimeelite und der Opposition (Solidarnosc), der den Übergang zur Demokratie einleitete.
Was ist Solidarnosc?
Solidarnosc war eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung in Polen, die zur wichtigsten Oppositionskraft gegen das kommunistische Regime wurde.
Welche Krisenpotenziale führten zum Zusammenbruch des Systems?
Wirtschaftliche Instabilität, soziale Unzufriedenheit und die mangelnde Legitimität des Einparteiensystems schufen die Rahmenbedingungen für den Umbruch.
Was versteht man unter einem „ausgehandelten Systemwechsel“?
Es bezeichnet einen friedlichen Übergang von einer Autokratie zur Demokratie, der durch Kompromisse und Verhandlungen zwischen alten Eliten und neuen Kräften erreicht wird.
Warum gilt Polen als Vorreiter der Transformation in Osteuropa?
Polen war das erste Land im Ostblock, das durch erfolgreiche Oppositionsarbeit und Verhandlungen den Übergang zu einem demokratischen System vollzog.
- Quote paper
- M. A. Alexander Gajewski (Author), 2010, Die Institutionalisierung der polnischen Demokratie und die Rolle von Akteuren im polnischen Transformationsprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292898