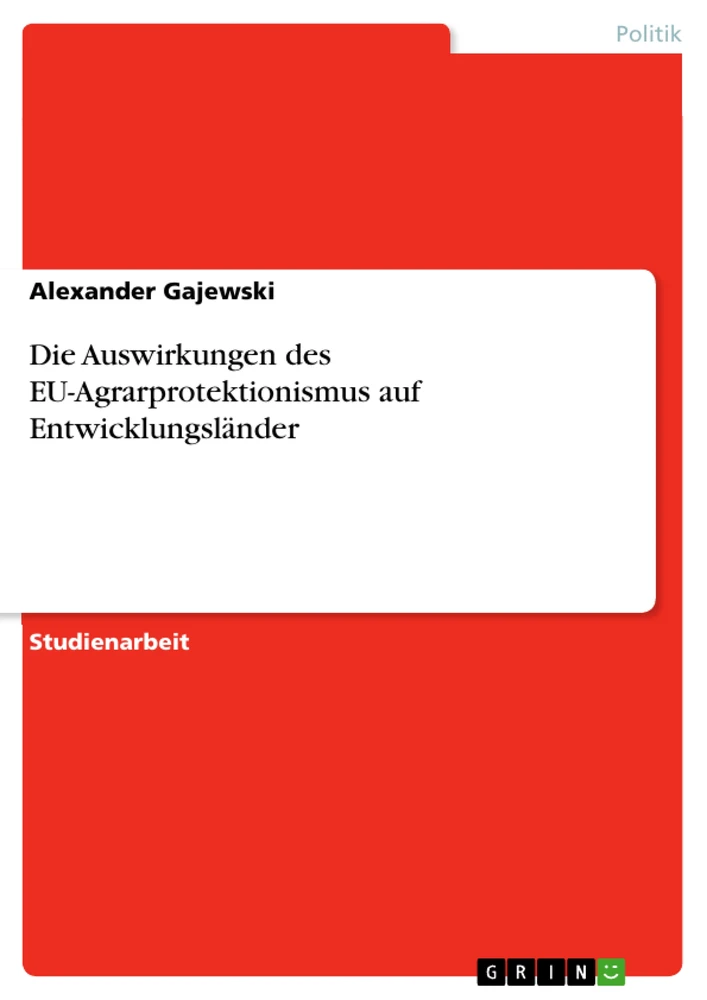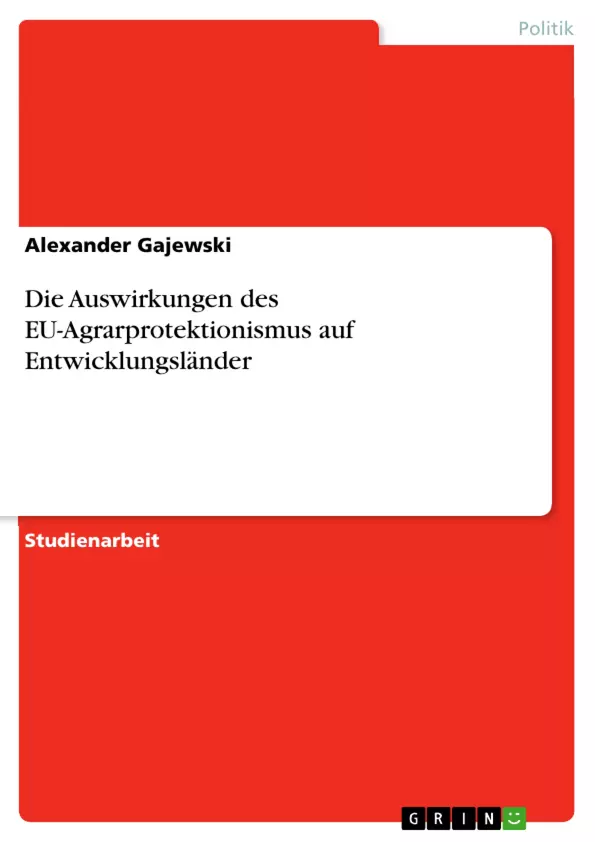Die Bekämpfung des Hungers in der Welt ist schon seit Jahrzehnten ein viel diskutiertes Thema in der internationalen Politik. Trotz zahlreicher Versprechungen, Zielvorgaben und Kampagnen, die allesamt nicht den gewünschten Erfolg verbuchen konnten, bleibt dieses Thema auch vorerst ein globales Problem, welches künftig eine wichtige und vor allem ernsthafte Rolle bei internationalen Verhandlungen über Entwicklung, Freihandel etc. spielen sollte.
Warum das Hungerproblem bis heute nicht gelöst werden konnte, hat vielfältige und aufgrund der Heterogenität der betroffenen Länder sehr unterschiedliche Ursachen. Eine vollständige Analyse des Problems, inklusive der Vorstellung verschiedener Lösungsansätze, erscheint im Rahmen dieser Arbeit wenig sinnvoll und kaum möglich. Deswegen wird im Folgenden das Hauptaugenmerk auf der Diskussion zu Freihandel und Protektionismus im Agrarbereich liegen. Ganz besonders soll dabei die EU-Agrarpolitik mit ihren Auswirkungen auf die Entwicklungsländer beleuchtet werden. Die EU betreibt seit der Einführung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bei vielen landwirtschaftlichen Produkten Protektionismus, um den eigenen Markt vor billiger ausländischer Konkurrenz zu schützen und darüber hinaus durch Exportsubventionen eigene Waren zu günstigen Preisen auf dem Weltmarkt abzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung des Agrarsektors
- Der Agrarsektor in Industrieländern
- Der Agrarsektor in Entwicklungsländern
- Das Ricardo-Modell der komparativen Kostenvorteile
- Der EU-Agrarprotektionismus
- Ziele und Entwicklung der GAP
- Instrumente protektionistischer Maßnahmen
- Reformen der GAP
- Auswirkungen des EU-Agrarprotektionismus auf Entwicklungsländer
- Fallstudie: Sambias und Ugandas Milchbauern
- Fallstudie: Der Hühner- und Tomatenmarkt in Ghana
- Liberalisierungsabsichten der Doha-Runde
- Chancen und Gefahren für Entwicklungsländer
- Ernährungssouveränität als Strategie gegen den Hunger
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen des EU-Agrarprotektionismus auf Entwicklungsländer und untersucht die Rolle von Freihandel und Protektionismus im Agrarbereich für die Bekämpfung von Hunger und Armut. Die Arbeit beleuchtet die Besonderheiten des Agrarsektors in Industrie- und Entwicklungsländern und analysiert die theoretischen Grundlagen des Freihandels anhand des Ricardo-Modells der komparativen Kostenvorteile. Im Fokus stehen die Ziele, Instrumente und Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU und deren Folgen für die Entwicklungsländer.
- Die Bedeutung des Agrarsektors für Industrie- und Entwicklungsländer
- Die Rolle des internationalen Agrarhandels für die Bekämpfung von Hunger und Armut
- Die Auswirkungen des EU-Agrarprotektionismus auf Entwicklungsländer
- Die Chancen und Risiken der Liberalisierung des Agrarhandels im Rahmen der Doha-Runde
- Das Konzept der Ernährungssouveränität als Alternative zum Freihandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem des Welthungers dar und erläutert die Bedeutung von Freihandel und Protektionismus im Agrarbereich. Sie skizziert die Relevanz der EU-Agrarpolitik für die Entwicklungsländer und führt die Themenschwerpunkte der Arbeit aus.
- Die Bedeutung des Agrarsektors: Dieses Kapitel beschreibt die ökonomische Bedeutung des Agrarsektors für Industrie- und Entwicklungsländer und hebt die Unterschiede in ihrer Rolle und Bedeutung hervor. Es bietet somit die Grundlage für das Verständnis des internationalen Agrarhandels.
- Das Ricardo-Modell der komparativen Kostenvorteile: Dieses Kapitel widmet sich dem Ricardo-Modell und erklärt dessen theoretische Legitimierung für Freihandel. Es argumentiert, dass Länder durch Spezialisierung und Handel effizienter produzieren und Wohlstandsgewinne erzielen können.
- Der EU-Agrarprotektionismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU, ihre Ziele und die eingesetzten Instrumente zur Protektion des eigenen Marktes. Es geht zudem auf die Reformen der GAP seit 1992 ein.
- Auswirkungen des EU-Agrarprotektionismus auf Entwicklungsländer: Dieses Kapitel analysiert die Folgen des EU-Agrarprotektionismus für die Entwicklungsländer und zeigt die unterschiedlichen Auswirkungen auf verschiedene Länder auf. Es präsentiert zwei Fallstudien, die die Folgen für die Milchproduktion in Uganda und Sambia sowie für den Hühner- und Tomatenmarkt in Ghana untersuchen.
- Liberalisierungsabsichten der Doha-Runde: Dieses Kapitel beleuchtet die Doha-Runde der WTO und deren Bedeutung für die Liberalisierung des Agrarhandels. Es diskutiert die Chancen und Risiken der weiteren Liberalisierung für die Entwicklungsländer und stellt das Konzept der Ernährungssouveränität als alternative Strategie zur Bekämpfung des Welthungers vor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen EU-Agrarpolitik, Freihandel, Protektionismus, Entwicklungsländer, Ernährungssicherheit, Doha-Runde, Welthunger, Agrarhandel, Ernährungssouveränität, komparative Kostenvorteile, GAP, Ricardo-Modell, Milchproduktion, Hühner- und Tomatenmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU?
Die GAP nutzt Protektionismus, um den EU-Markt vor billiger ausländischer Konkurrenz zu schützen und eigene Waren durch Exportsubventionen auf dem Weltmarkt abzusetzen.
Welche Auswirkungen hat der EU-Agrarprotektionismus auf Entwicklungsländer?
Er führt oft dazu, dass lokale Märkte in Entwicklungsländern durch billige EU-Exporte untergraben werden, was die Existenz lokaler Bauern gefährdet.
Was besagt das Ricardo-Modell der komparativen Kostenvorteile?
Es liefert die theoretische Basis für Freihandel und besagt, dass Länder durch Spezialisierung und Handel effizienter produzieren und Wohlstandsgewinne erzielen können.
Welche Fallstudien werden in der Arbeit untersucht?
Untersucht werden die Milchbauern in Sambia und Uganda sowie der Hühner- und Tomatenmarkt in Ghana.
Was bedeutet „Ernährungssouveränität“?
Ernährungssouveränität ist ein Konzept, das als Strategie gegen den Hunger dient und Ländern das Recht zuspricht, ihre Agrar- und Ernährungspolitik selbst zu bestimmen.
- Quote paper
- Alexander Gajewski (Author), 2011, Die Auswirkungen des EU-Agrarprotektionismus auf Entwicklungsländer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292907