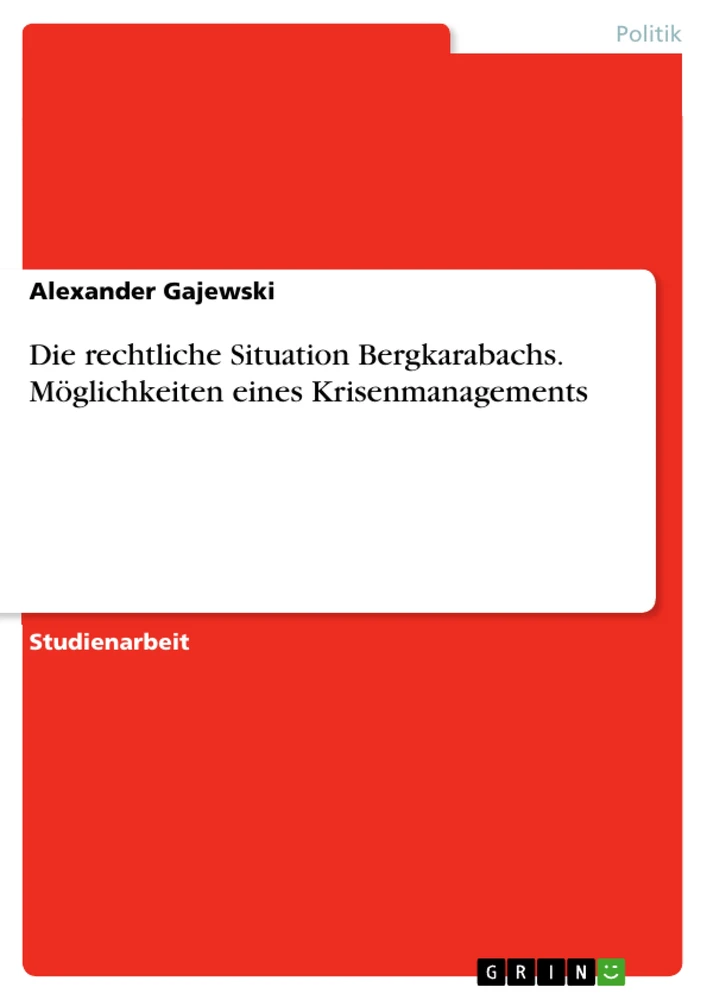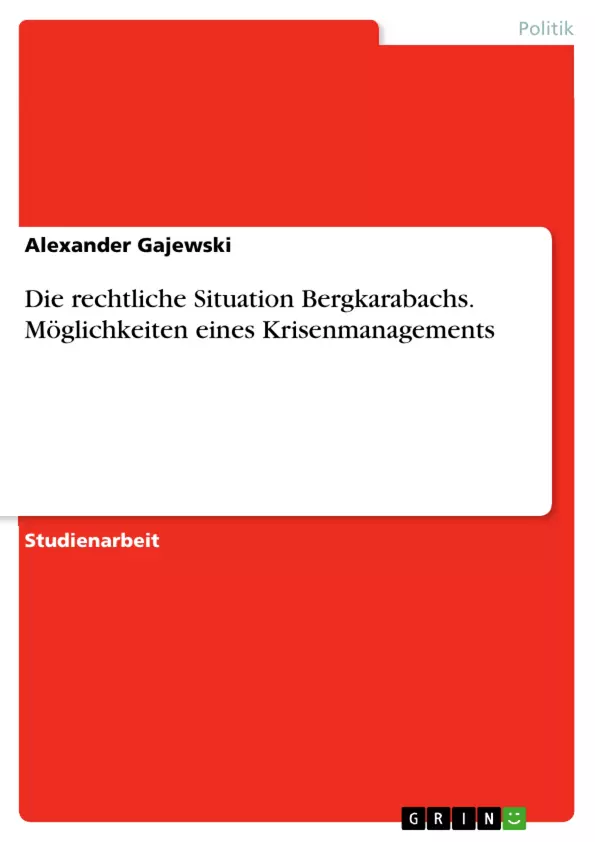Als Ende der 1980er Jahre armenische Intelektuelle, im Zuge der durch Glasnost und Perestroika veränderten Artikulationsmöglichkeiten für nationale Anliegen, den seit der Annexion des Südkaukasus durch die Sowjetunion unterdrückten Konflikt um Bergkarabach auf die politische Tagesordnung setzten, entwickelte sich eine Krise, die von 1991 bis 1994 zu einem zwischenstaatlichen Konflikt zwischen Aserbeidschan auf der einen und Armenien und dem Autonomen Gebiet Bergkarabach (zu Aserbeidschan gehörig) auf der anderen Seite führte. Bereits mit dem Antrag des Gebietssowjets von Bergkarabach auf Übertragung des Autonomen Gebiets von Aserbeidschan auf Armenien im Februar 1988 trat das Problem ungelöster Nationalitätenkonflikte und umstrittener Territorialfragen innerhalb der Sowjetunion offen in Erscheinung.
Immer häufiger kam es in der Folgezeit zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Armeniern und Aserbeidschanern, die sich wie erwähnt seit 1991 zu einem Krieg um das Autonome Gebiet Bergkarabach ausweiteten. Neben zahlreichen Todesopfern und Flüchtlingen, die in Folge dieses Krieges ihre Heimat verlassen mussten, wurde durch die armenische Besetzung von Bergkarabach und insgesamt sieben aserbeidschanischen Provinzen, die nach unterschiedlichen Angaben etwa 16 bis 20 Prozent des aserbeidschanischen Territoriums ausmachen, eine auf Dauer unhaltbare Situation geschaffen, die bis heute unverändert Bestand hat und zu deren möglicher Lösung die internationalen Organisationen bisher nur wenig beigetragen haben. Zwar wurde der ursprünglich innerstaatliche Konflikt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Rahmen der OSZE und durch die Einsetzung der sog. Minsker Gruppe bereits 1992 internationalisiert, allerdings konnten sich Armenien und Aserbeidschan trotz internationaler Vermittlung bisher auf keinen Kompromiss einigen.
Die Ursachen für die zementierte Situation und die Unfähigkeit der beteiligten Konfliktparteien zur Kompromissfindung liegen dabei vor allem in einer diametral entgegengesetzten Geschichtsauffassung und der unterschiedlichen Interpretation sowohl des sowjetischen Rechts als auch des Völkerrechts begründet. Denn sowohl Armenien als auch Aserbeidschan gehen davon aus, dass Bergkarabach das ursprüngliche Siedlungsgebiet des jeweils eigenen Volkes gewesen ist, bzw. dass die zu früherer Zeit dort ansässigen Siedler entweder ihre direkten Vorfahren gewesen sind oder schon frühzeitig von ihnen assimiliert wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte Bergkarabachs und Entwicklung des Konflikts
- Rechtliche Situation Bergkarabachs
- Bergkarabachs Stellung in der Verfassung der UdSSR von 1977
- Bergkarabach und das Völkerrecht
- Internationalisierung des Bergkarabachkonflikts
- Bisherige Maßnahmen der UNO, der EU und der OSZE zur Konfliktbeilegung
- Künftiges Krisenmanagement der UNO, der EU und der OSZE
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die rechtliche Situation Bergkarabachs aus der Sicht des sowjetischen Sezessionsrechts und des Völkerrechts und untersucht die Möglichkeiten eines künftigen Krisenmanagements durch die UNO, die EU und die OSZE im Bergkarabachkonflikt. Dabei wird die Entwicklung des Konflikts seit den späten 1980er Jahren betrachtet und die unterschiedlichen Perspektiven Armeniens und Aserbeidschans auf die Geschichte und rechtliche Situation des Gebietes beleuchtet.
- Die rechtliche Situation Bergkarabachs im Kontext des sowjetischen Rechts und des Völkerrechts
- Die Rolle der internationalen Organisationen bei der Konfliktbeilegung
- Möglichkeiten des zukünftigen Krisenmanagements
- Die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen und ethnischen Zugehörigkeiten in Bergkarabach
- Die Bedeutung des territorialen Status Bergkarabachs für die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbeidschan
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in das Thema ein und beschreibt den Ursprung des Bergkarabachkonflikts im Kontext der sowjetischen Politik der späten 1980er Jahre. Es beleuchtet die Entwicklung des Konflikts bis zu seinem Ausbruch im Jahr 1991 und die Schwierigkeiten, die durch die mangelnde Bereitschaft zur Kompromissfindung seitens Armeniens und Aserbeidschans entstanden sind.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte Bergkarabachs und die Entwicklung des Konflikts seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. Es wird auf die unterschiedlichen ethnischen Gruppen und kulturellen Einflüsse in der Region eingegangen, wobei der Fokus auf die ethnische Zugehörigkeit der Albaner und die ethnischen Veränderungen im Laufe der Geschichte liegt.
Das dritte Kapitel analysiert die rechtliche Situation Bergkarabachs sowohl nach dem sowjetischen Recht als auch nach dem Völkerrecht. Es befasst sich mit der Stellung Bergkarabachs in der Verfassung der UdSSR von 1977 und untersucht, ob eine Sezession des Gebiets nach dem Völkerrecht rechtmäßig wäre.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Internationalisierung des Bergkarabachkonflikts. Es beschreibt die bisherigen Maßnahmen der UNO, der EU und der OSZE zur Konfliktbeilegung und analysiert deren Effektivität.
Schlüsselwörter
Bergkarabachkonflikt, Sezessionsrecht, Völkerrecht, UdSSR, Armenien, Aserbeidschan, UNO, EU, OSZE, Krisenmanagement, Konfliktbeilegung, ethnische Konflikte, territorialer Streit, Geschichtsinterpretation, ethnische Zugehörigkeit, kultureller Einfluss, internationales Recht, Rechtsstatus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Ursache des Bergkarabach-Konflikts?
Die Ursachen liegen in territorialen Ansprüchen und einer diametral entgegengesetzten Geschichtsauffassung zwischen Armenien und Aserbaidschan, verschärft durch den Zerfall der Sowjetunion.
Wie war der rechtliche Status Bergkarabachs in der UdSSR?
Bergkarabach war ein Autonomes Gebiet innerhalb der Aserbaidschanischen Sozialistischen Sowjetrepublik (ASSR). Ein Antrag auf Übertragung nach Armenien im Jahr 1988 löste die Krise aus.
Was sagt das Völkerrecht zur Sezession Bergkarabachs?
Hier kollidieren zwei Prinzipien: das Selbstbestimmungsrecht der Völker (Armenier in Bergkarabach) und die territoriale Integrität von Staaten (Aserbaidschan).
Welche Rolle spielt die Minsker Gruppe der OSZE?
Die Minsker Gruppe wurde 1992 ins Leben gerufen, um eine friedliche Verhandlungslösung für den Konflikt unter Vermittlung von Russland, den USA und Frankreich zu finden.
Warum konnten sich die Parteien bisher nicht einigen?
Beide Seiten beanspruchen das Gebiet als ihr historisches Kernland. Kompromisse werden oft als nationaler Verrat angesehen, was die politische Spielräume massiv einengt.
- Quote paper
- M. A. Alexander Gajewski (Author), 2012, Die rechtliche Situation Bergkarabachs. Möglichkeiten eines Krisenmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292937