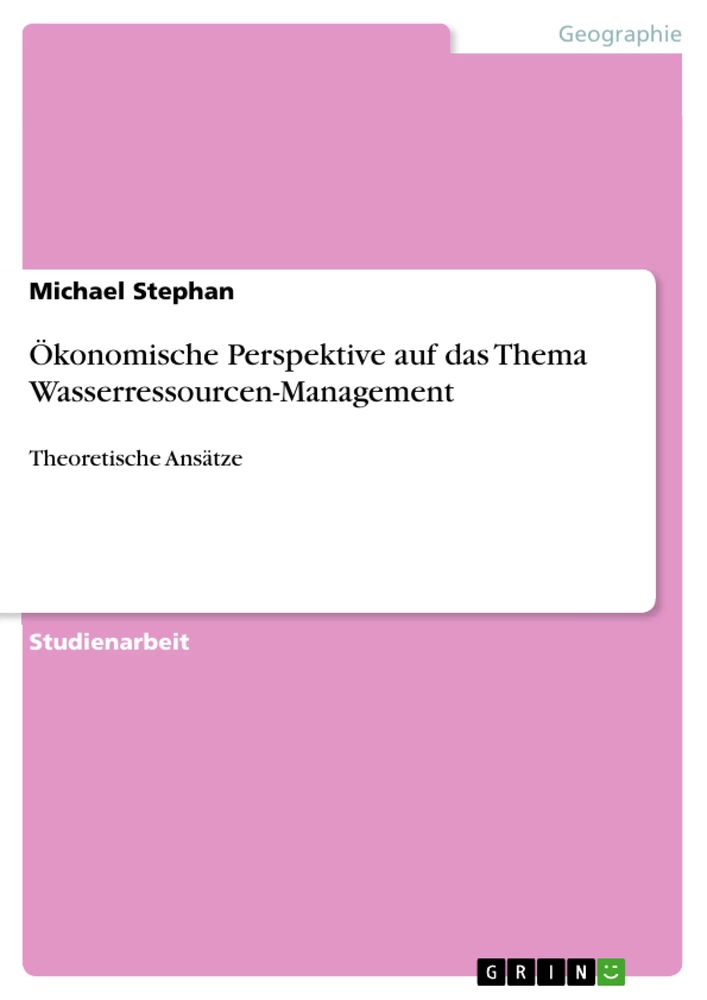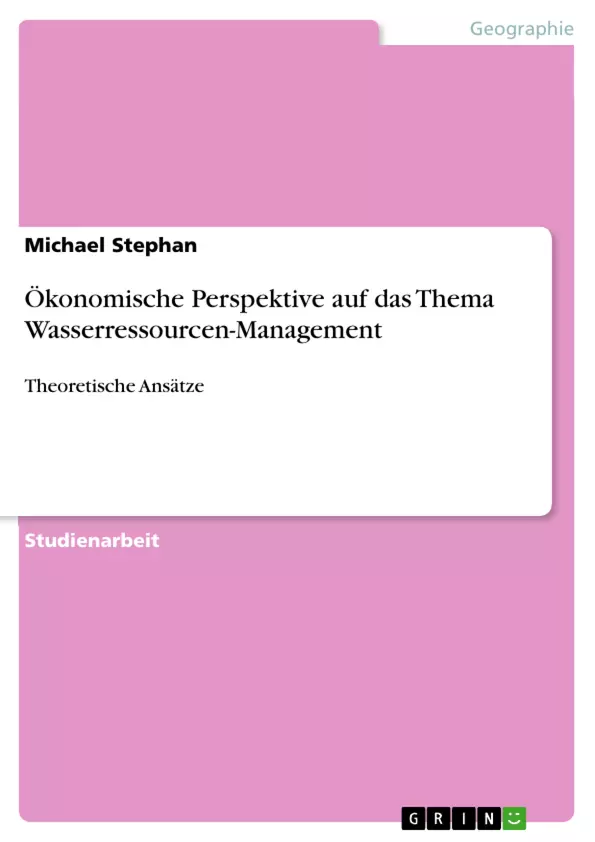Wasserressourcen-Management ist ein breit gefächertes Thema, das Wissen aus vielen verschiedenen Bereichen fordert und weit über die Geographie hinausgeht. Grundlegendes Wissen aus den Bereichen der Politikwissenschaften, der Biologie und der Volkswirtschaft sind essentiell um Prozesse und Systeme des Wasserressourcen-Managements zu verstehen.
Diese Arbeit vermittelt in erster Linie grundlegendes Wissen aus der Volkswirtschaft und erklärt theoretische Ansätze, die man wissen muss, um sich tiefergehend mit dem Thema Wasserressourcen-Management beschäftigen zu können.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Einflussfaktoren auf das Marktgleichgewicht.
Es wird der Frage nachgegangen: Welche Möglichkeiten gibt es ein Marktversagen zu beseitigen und das Marktgleichgewicht wieder herzustellen? Hier werden zwei unterschiedliche theoretische Ansätze näher erläutert.
Im zweiten Teil geht es um Gemeingüter und die Tragik der Allmende. Hier wird zunächst theoretisch der Begriff des Gemeinguts geklärt und anschließend die Problematik der Gemeinressourcen und deren Ausbeutung. Am Beispiel der Bedrohung der Fischbestände in den Weltmeeren werden Lösungsansätze in Form der acht Gestaltungsprinzipien von Elinor Ostrom erarbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einfluss externer Effekte auf den Markt
- Die Pigou-Steuer
- Das Coase-Theorem
- Gemeingüter
- Abgrenzung der Gemeingüter
- Die Tragik der Allmende
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Wasserressourcen-Management aus ökonomischer Perspektive. Sie vermittelt grundlegendes Wissen aus der Volkswirtschaft und erklärt theoretische Ansätze, die für ein tiefergehendes Verständnis des Themas relevant sind.
- Einfluss externer Effekte auf das Marktgleichgewicht
- Die Pigou-Steuer und das Coase-Theorem als Lösungsansätze für Marktversagen
- Definition und Abgrenzung von Gemeingütern
- Die Tragik der Allmende und die Problematik der Ausbeutung von Gemeinressourcen
- Lösungsansätze für die Bewältigung der Tragik der Allmende
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Wasserressourcen-Management ein und betont die Relevanz von ökonomischem Wissen für die Analyse und Bewältigung von Herausforderungen in diesem Bereich.
Das Kapitel "Einfluss externer Effekte auf den Markt" beleuchtet die Bedeutung von externen Effekten für das Marktgleichgewicht. Es werden die Pigou-Steuer und das Coase-Theorem als zwei unterschiedliche Ansätze zur Korrektur von Marktversagen vorgestellt.
Das Kapitel "Gemeingüter" beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung von Gemeingütern. Es wird die Tragik der Allmende als Problematik der Ausbeutung von Gemeinressourcen erläutert. Am Beispiel der Bedrohung der Fischbestände in den Weltmeeren werden Lösungsansätze in Form der acht Gestaltungsprinzipien von Elinor Ostrom erarbeitet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wasserressourcen-Management, Marktversagen, externe Effekte, Pigou-Steuer, Coase-Theorem, Gemeingüter, Tragik der Allmende, Elinor Ostrom, Gestaltungsprinzipien, Fischbestände, Weltmeere.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Marktversagen im Wasserressourcen-Management?
Marktversagen tritt auf, wenn externe Effekte (wie Verschmutzung) nicht im Preis berücksichtigt werden oder wenn Gemeingüter übernutzt werden, da niemand direkt für deren Erhalt verantwortlich ist.
Was besagt die "Tragik der Allmende"?
Dieses Konzept beschreibt die Übernutzung von frei verfügbaren, aber begrenzten Ressourcen (Gemeingüter). Jeder Einzelne maximiert seinen Nutzen, was langfristig zur Zerstörung der Ressource für alle führt, wie z.B. bei Fischbeständen.
Wie hilft die Pigou-Steuer beim Gewässerschutz?
Die Pigou-Steuer ist ein Instrument, um negative externe Effekte zu korrigieren. Durch eine Steuer auf Verschmutzung werden die Verursacher gezwungen, die gesellschaftlichen Kosten ihres Handelns einzupreisen.
Was sind die Gestaltungsprinzipien von Elinor Ostrom?
Elinor Ostrom entwickelte acht Prinzipien für die nachhaltige Bewirtschaftung von Gemeinressourcen ohne staatliche Eingriffe, die auf Selbstorganisation, Überwachung und gemeinschaftlichen Regeln basieren.
Was ist der Unterschied zwischen der Pigou-Steuer und dem Coase-Theorem?
Während die Pigou-Steuer auf staatliche Eingriffe setzt, geht das Coase-Theorem davon aus, dass private Verhandlungen zwischen Beteiligten zu effizienten Lösungen führen können, sofern Eigentumsrechte klar definiert sind.
- Arbeit zitieren
- Michael Stephan (Autor:in), 2014, Ökonomische Perspektive auf das Thema Wasserressourcen-Management, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293024