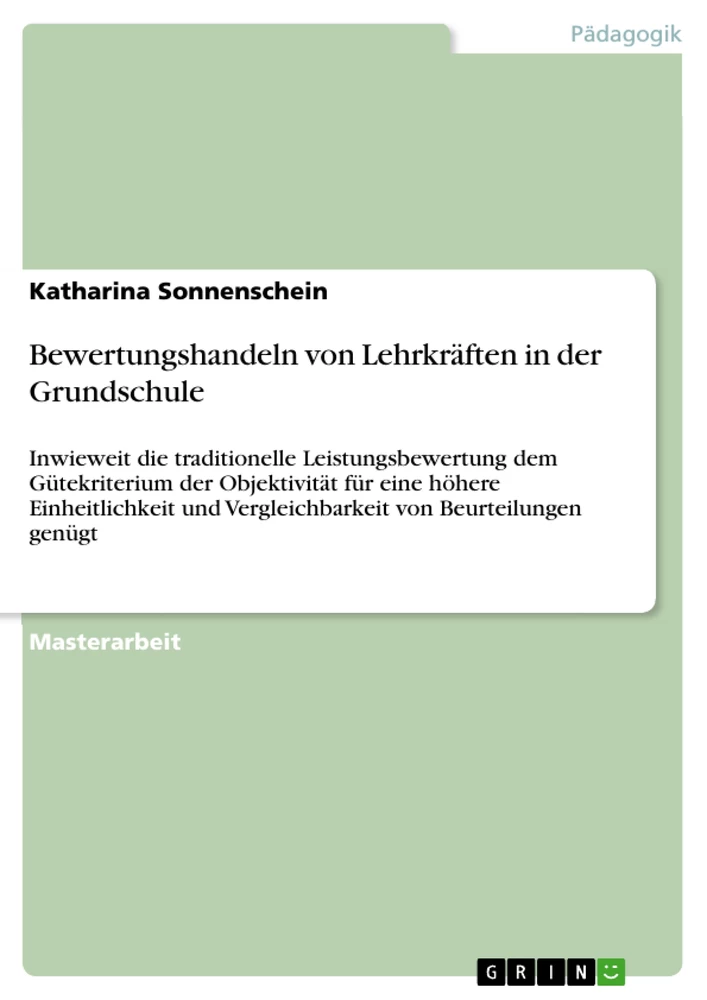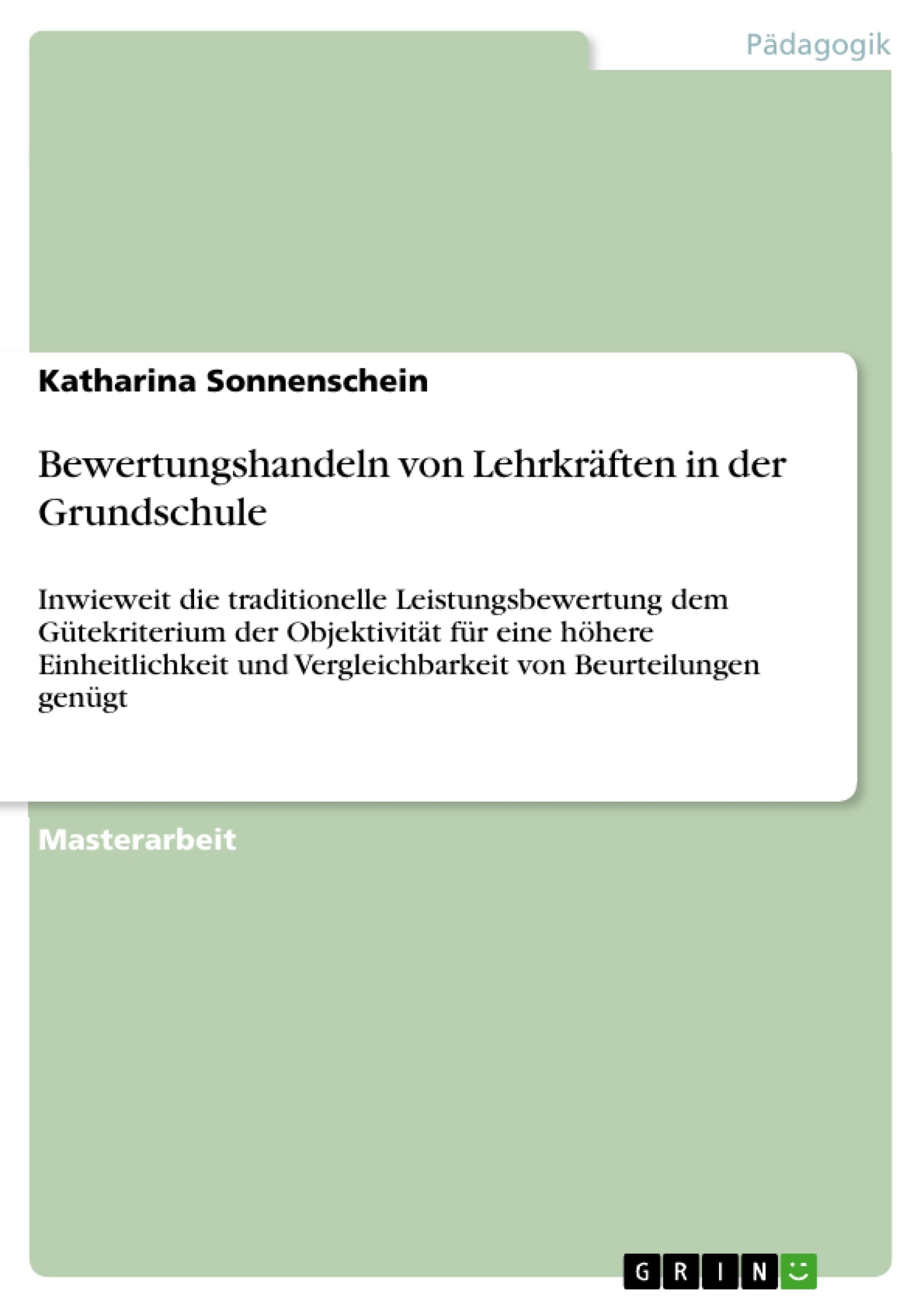Mit der Leistungsbewertung fällt eines der mächtigsten und einflussreichsten Instrumente zur Bestimmung der Chancen auf schulischen wie auch beruflichen Erfolg in den Verantwortungsbereich von Lehrerinnen und Lehrern. Basierend auf deren Beurteilungen werden weitreichende Laufbahnentscheidungen wie „das Eröffnen oder Verwehren von Zugängen zu weiterführenden Schulen, das Versetzen oder Nichtversetzen am Ende eines Schuljahres, die Zuweisung zu unterschiedlich anspruchsvollen Kursen im Fachleistungskurssystem, die Aufnahme in Förderkurse [sowie] die Einleitung von Sonderschulüberweisungsverfahren“ (Jürgens 2005: 58) getroffen. Dieses Verteilungs- und Selektionswesen legitimiert sich durch die vorausgesetzte Vergleichbarkeit von Leistungsbewertungen und der damit einhergehenden angenommenen Erfüllung messtheoretischer Gütekriterien beim Beurteilungsprozess. Aufgrund der bedeutenden Relevanz jener Voraussetzungen bzw. Annahmen ist die Vergleichbarkeit von schulischen Bewertungen mehrmals in den Fokus der bildungswissenschaftlichen Forschung gerückt. Bereits Anfang der 70er Jahre existierten zahlreiche empirische Studien, die bezüglich der Vergleichbarkeit sowie der Messqualität von Beurteilungen erhebliche Mängel herausstellten (vgl. u.a. Ingenkamp 1989; Thiel/Valtin 2002: 67; Winter 2012: 3). Trotz andauernder Kritik hält das deutsche Schulsystem weitestgehend an traditionellen Prüfungs- und Bewertungsmethoden fest (vgl. Jachmann 2003: 13; Winter 2012: 3).
Die veralteten Studienergebnisse, die Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Praxis sowie die unverkennbare Relevanz von Bewertungsentscheidungen für den beruflichen wie auch persönlichen Erfolg von Schülerinnen und Schülern begründen eine erneute Auseinandersetzung mit dem Bewertungshandeln von Lehrkräften. Unter Einbeziehung eigener empirischer Untersuchungen wird der Anspruch der schriftlichen Leistungsbewertung im Primarbereich der Wirklichkeit gegenübergestellt.
Dazu werden 20 Lehrpersonen im Rahmen eines Fragebogens gebeten, einen beispielhaft angeführten Deutschaufsatz zu zensieren, die angedachte Benotung zu begründen und weitere Fragen bzgl. ihres Bewertungsverhaltens zu beantworten. Neben der Gesamtnote sind auch die Beurteilung einzelner Kriterien und Bereiche sowie die der Leistungsbeurteilung zugrunde gelegten Bezugsnormen von Bedeutung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Aspekte der Leistungsbewertung
- Die Messung“ schriftlicher Schulleistungen
- Messtheoretische Gütekriterien
- Bezugsnormen der Leistungsbewertung
- Rechtliche Grundlagen zur Leistungserfassung und -bewertung
- Anforderungen an die Leistungsbeurteilung
- Exemplarische Darstellung der empirisch relevanten Studien.
- Alternative Methoden der Leistungsbewertung
- Methodischer Aufbau der Studie
- Erkenntnisinteresse der Untersuchung........
- Überlegungen zum Erhebungsinstrument
- Bestimmung und Beschreibung des Erhebungsinstrumentes
- Vorstellung des verwendeten Fragebogens
- Zum Untersuchungsgegenstand....
- Feldzugang und Rücklauf..
- Deskriptive Statistik ......
- Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ....
- Darstellung der Befunde ....
- Deskriptive Darstellung.
- Begründete Auswahl und Entwicklung von Kategorien
- Analyse der qualitativen Antworten
- Interpretationen
- Interpretationen der deskriptiven Befunde ........
- Interpretationen zu den Ergebnissen der kategorialen Analyse
- Gegenüberstellung zentraler Befunde
- Fazit.........
- Literatur
- Anhang
- Tabelle 1: Bewertung des Deutschaufsatzes
- Tabelle 2: absolute und relative Häufigkeiten der vergebenen Schulnoten
- Tabelle 3: bewertete Bereiche/Kriterien in Bezug auf Fragestellung 2.3...
- Tabelle 4: absolute und relative Häufigkeiten der bewerteten Bereiche/Kriterien.
- Tabelle 5: aufgeführte Bezugsnormen der Fragestellung 3.4.….….......
- Tabelle 6: absolute und relative Häufigkeiten der Bezugsnormen
- Tabelle 7: Auflistung der Einzelnennungen bzw. Kombinationen der Bezugsnormen....
- Tabelle 8: absolute und relative Häufigkeiten der Nennungen der Tabelle 7.
- Tabelle 9: Auswertungstabelle zur ersten Oberkategorie.……........
- Tabelle 10: Erwähnte Bezugsnormen in offenen Fragestellungen..
- Tabelle 11: Auswertungstabelle zur zweiten Oberkategorie.……........
- Tabelle 12: Zusammenfassung der Unterkategorie 2.1.
- Tabelle 13: Zusammenfassung der Unterkategorie 2.2..
- Tabelle 14: Ausprägungen der Unterkategorie 2.2.
- Tabelle 15: absolute und relative Häufigkeiten der Nennungen der Tabelle 14 ............
- Tabelle 16: absolute und relative Häufigkeiten der priorisierten Bewertungskriterien ...
- Tabelle 17: Gegenüberstellung der Antworten bezüglich der Bezugsnormen
- Tabelle 18: Gegenüberstellung der Antworten betreffs der Bewertung des exemplari- schen Deutschaufsatzes
- Tabelle 19: Gegenüberstellung aller Ergebnisse hinsichtlich der bewerteten Bereiche und Kriterien...
- Legende/Abkürzungsverzeichnis ..
- Gegenüberstellung absolute und relative Häufigkeiten …......
- Bezugsnormmodell nach Rheinberg....
- Ausschnitt aus dem Schulgesetz .......
- Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring......
- Fragebogen zur Erfassung von Bewertungshandeln.…….......
- Eigenständigkeitserklärung....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Bewertungshandeln von Lehrkräften in der Grundschule. Ziel ist es, die Objektivität der traditionellen Leistungsbewertung im Primarbereich zu untersuchen. Dabei werden die Bewertungskriterien, Bezugsnormen und die Vergleichbarkeit von Beurteilungen analysiert.
- Objektivität der Leistungsbewertung
- Bewertungskriterien und Bezugsnormen
- Vergleichbarkeit von Beurteilungen
- Empirische Untersuchung des Bewertungshandelns
- Qualitative Inhaltsanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Leistungsbewertung für den schulischen und beruflichen Erfolg von Schülerinnen und Schülern hervorhebt. Sie stellt die Problematik der Vergleichbarkeit von Beurteilungen und die Notwendigkeit einer erneuten Auseinandersetzung mit dem Bewertungshandeln von Lehrkräften dar.
Kapitel 2 behandelt die theoretischen Aspekte der Leistungsbewertung. Es werden die messtheoretischen Gütekriterien, die Bezugsnormen der Leistungsbewertung und die rechtlichen Grundlagen zur Leistungserfassung und -bewertung erläutert. Zudem werden exemplarische empirische Studien vorgestellt und alternative Methoden der Leistungsbewertung beschrieben.
Kapitel 3 beschreibt den methodischen Aufbau der Studie. Es werden das Erkenntnisinteresse, das Erhebungsinstrument, der Untersuchungsgegenstand, der Feldzugang und der Rücklauf erläutert. Die Verfahren der deskriptiven Statistik und der qualitativen Inhaltsanalyse werden vorgestellt.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die deskriptiven Befunde dargestellt und die Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse entwickelt. Die Ergebnisse der Analyse der qualitativen Antworten werden vorgestellt.
Kapitel 5 interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung. Die Interpretationen der deskriptiven Befunde und der Ergebnisse der kategorialen Analyse werden getrennt dargestellt. Anschließend werden die zentralen Befunde miteinander in Beziehung gesetzt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Leistungsbewertung, die Objektivität, die Vergleichbarkeit von Beurteilungen, die Bewertungskriterien, die Bezugsnormen, die empirische Forschung, die qualitative Inhaltsanalyse und das Bewertungshandeln von Lehrkräften in der Grundschule.
Häufig gestellte Fragen
Wie objektiv sind Schulnoten in der Grundschule?
Die Arbeit zeigt auf, dass Leistungsbewertungen oft Mängel in der Objektivität und Vergleichbarkeit aufweisen, da verschiedene Lehrkräfte denselben Aufsatz sehr unterschiedlich zensieren.
Was sind messtheoretische Gütekriterien?
Dazu gehören Objektivität (Unabhängigkeit vom Prüfer), Reliabilität (Zuverlässigkeit der Messung) und Validität (Messung dessen, was gemessen werden soll).
Welche Bezugsnormen nutzen Lehrer bei der Bewertung?
Man unterscheidet die soziale Bezugsnorm (Vergleich mit der Klasse), die sachliche Bezugsnorm (Erfüllung von Lernzielen) und die individuelle Bezugsnorm (Lernfortschritt des Schülers).
Warum sind Laufbahnentscheidungen in der Grundschule so kritisch?
Noten in der Grundschule bestimmen maßgeblich den Zugang zu weiterführenden Schulen und beeinflussen somit frühzeitig die beruflichen Erfolgschancen der Kinder.
Gibt es alternative Methoden zur Leistungsbewertung?
Ja, die Arbeit diskutiert Alternativen wie Portfolios, Lernentwicklungsberichte oder verbale Beurteilungen, die über reine Ziffernnoten hinausgehen.
- Quote paper
- Katharina Sonnenschein (Author), 2014, Bewertungshandeln von Lehrkräften in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293143