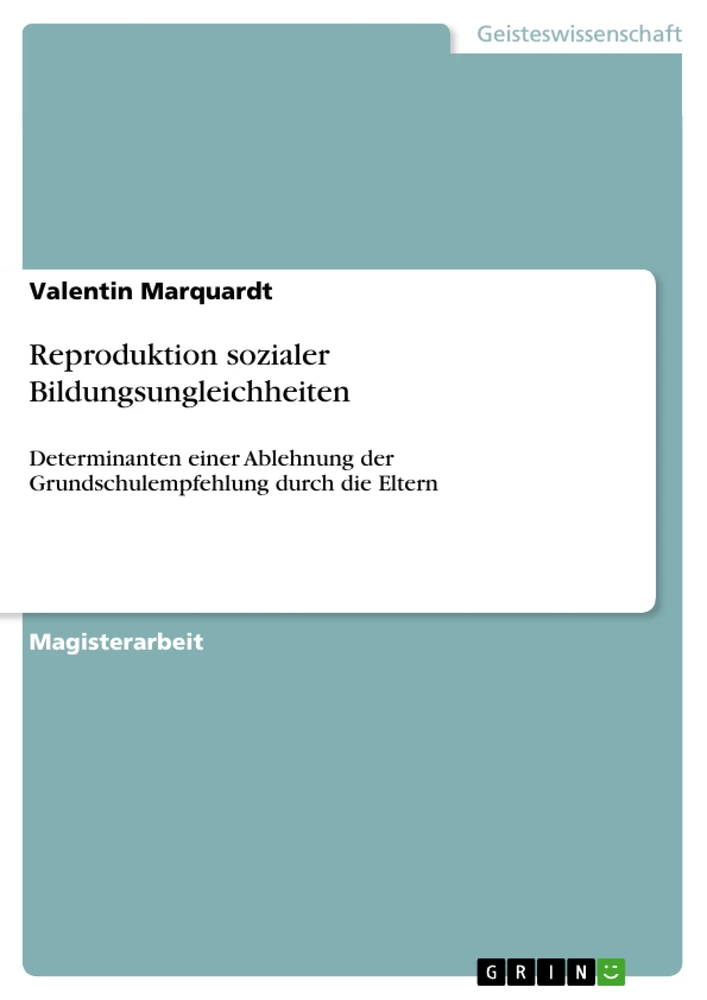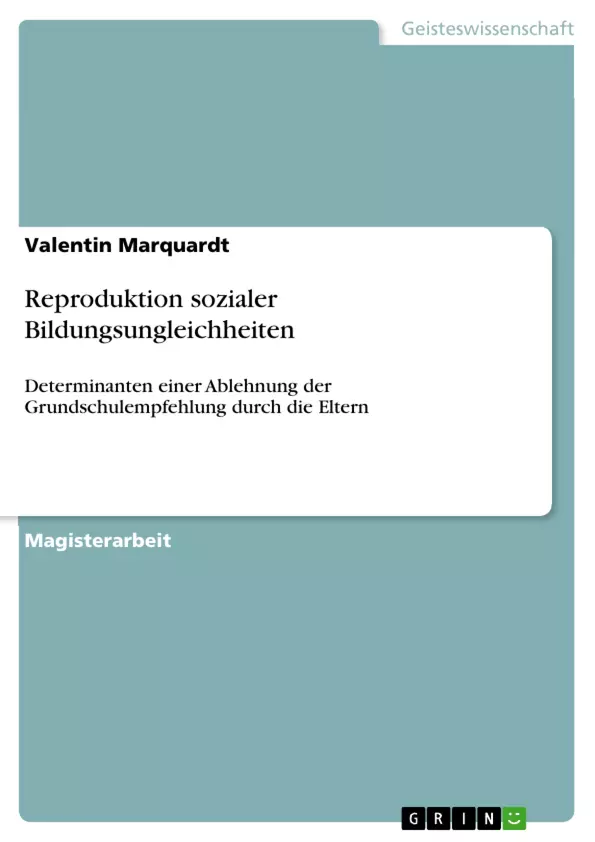Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer Begriffsexplikation der Elemente des Übergangs von der Grundschule in die Sekundarstufe I. Da ein nonkonformer Bildungsübergang durch die Eltern erwirkt wird, soll im Anschluss eine Theorie herangezogen werden, die das elterliche Entscheidungsverhalten begründen kann. Hierfür wird das Wert-Erwartungstheoretische Modell von Esser vorgestellt und durch Anmerkungen Beckers ergänzt. Das entscheidende Moment dieser Arbeit ist die Annahme, dass der Übergang auf eine Schulform nicht nur von dem Bildungswunsch der Eltern determiniert wird, sondern auch durch die Tatsache, ob Eltern in der Lage sind, diesen auch zu verwirklichen. Eine potentielle Hürde auf dem Weg zu der Umsetzung des Bildungswunsches stellt eine unerwünschte Schulempfehlung von Seiten der Lehrer dar. Die Ressourcen, die es Eltern ermöglichen, ihre Bildungsabsichten auch gegen eine unerwartete GSE durchzusetzen, werden im Anschluss in der Hypothesengenerierung spezifiziert.
Im darauffolgenden Kapitel soll ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand gegeben und auf bestehende Differenzen in den Studien hingewiesen werden. Für die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Analysen werden die aktuellen Daten des Nationalen Bildungspanels für die Bundesrepublik Deutschland (National Educational Panel Study, NEPS) aus den Jahren 2010/2011 verwendet. Die Grundgesamtheit der Untersuchung besteht aus Schülern, die im Jahr 2010 auf eine Regelschule wechselten und die fünfte Klasse besuchten. Nach der Beschreibung des Operationalisierungsprozesses wird über erste deskriptive Ergebnisse berichtet und auf mögliche systematische Verzerrungen hingewiesen. Im anschließenden inferenzstatistischen Teil soll die binär-logistische Regression vorgestellt werden, mit der die Zusammenhänge zwischen den Prädiktorvariablen und dem zu erklärenden Phänomen, dem nonkonformen Schulübertritt, quantifiziert und interpretiert wer-den. Im abschließenden Kapitel wird die Arbeit kritisch resümiert, auf Probleme hingewiesen und die Notwendigkeit von Verlaufsdaten für folgende Untersuchungen begründet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Der Schulformwechsel am Ende der Grundschulzeit
- Die Grundschulempfehlung
- Der nonkonforme Übergang
- Theorien zur Erklärung der Schulformwahl
- Die Wert-Erwartungstheorie - das Modell von Esser (1999)
- Der Einfluss der Schulleistung und Lehrerempfehlung
- Das Modell von Becker (2000)
- Unsicherheit im Entscheidungsprozess
- Der nonkonforme Schulübertritt als Bestandteil des Reproduktionsmechanismus sozialer Bildungsungleichheiten
- Modellvorschlag & Ableitung der Hypothesen
- Das Modell zur Erklärung eines nonkonformen Überganges
- Ableitung der Hypothesen
- Der Schulformwechsel am Ende der Grundschulzeit
- Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand
- Ausgewählte Studien
- Einflüsse des Elternhauses auf die Schulwahl der Kinder in Berlin und Brandenburg - Merkens et al. 1997
- LAU & KESS - Lehmann et al. 1997 & 2003
- Kompetenzaufbau und Laufbahnen im Schulsystem - Ditton 2007
- Was bedingt die Wahl eines nicht empfohlenen höheren Bildungsgangs? - Harazd & Ophuysen 2008
- Die Elternentscheidung beim Übergang in die Sekundarstufe I - Jonkmann et al. 2010
- Akzeptanz von Grundschulempfehlungen und Auswirkungen auf den weiteren Bildungsverlauf - Lohmann & Groh-Samberg 2010
- Verbindliche vs. unverbindliche Grundschulempfehlung
- Zusammenfassung
- Ausgewählte Studien
- Projekt und Methodik
- Das Nationale Bildungspanel
- Die Stichprobe – Etappe 3
- Wieso NEPS?
- Befragungszeitpunkt & Richtung der Kausalität
- Datensatzkonstruktion und Operationalisierung
- Datensatzkonstruktion
- Deskriptive Ergebnisse
- Inferenzstatistischer Teil
- Modellspezifikation
- Die binäre logistische Regression als Schätzmethode
- Ergebnisse der inferenzstatistischen Analyse
- Gesamtmodell I: Der nonkonforme Gymnasialübergang
- Gesamtmodell II: Ablehnung einer Gymnasialschulempfehlung
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- Das Nationale Bildungspanel
- Schlussfolgerung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Frage, welche Faktoren die Ablehnung einer Grundschulempfehlung durch Eltern beeinflussen. Sie untersucht den nonkonformen Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I, wobei der Fokus auf der Ablehnung einer Gymnasialempfehlung liegt. Ziel ist es, die Determinanten dieser Entscheidung zu identifizieren und zu analysieren, um einen Beitrag zum Verständnis der Reproduktion sozialer Bildungsungleichheiten zu leisten.
- Reproduktion sozialer Bildungsungleichheiten
- Nonkonformer Schulübertritt
- Grundschulempfehlung
- Elternentscheidung
- Soziale Determinanten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungsungleichheiten ein und beleuchtet die Bedeutung des Übergangs von der Grundschule auf die Sekundarstufe I als zentrale Weichenstellung im Bildungsverlauf. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von nonkonformen Schulübergängen, also Entscheidungen der Eltern, die gegen die ausgesprochene Grundschulempfehlung der Lehrkräfte verstoßen. Die Annahme ist, dass diese Entscheidungen besonders stark von statusbezogenen Dimensionen beeinflusst werden und somit einen wichtigen Teil des Reproduktionsmechanismus sozialer Bildungsungleichheiten darstellen.
Der theoretische Teil der Arbeit beleuchtet verschiedene Theorien zur Erklärung der Schulformwahl, darunter die Wert-Erwartungstheorie von Esser (1999) und das Modell von Becker (2000). Es wird die Rolle der Schulleistung, der Lehrerempfehlung und der Unsicherheit im Entscheidungsprozess der Eltern beleuchtet. Zudem wird der nonkonforme Schulübertritt als Bestandteil des Reproduktionsmechanismus sozialer Bildungsungleichheiten diskutiert.
Im Kapitel „Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand“ werden ausgewählte Studien vorgestellt, die sich mit dem Einfluss des Elternhauses auf die Schulwahl, der Akzeptanz von Grundschulempfehlungen und den Determinanten eines nonkonformen Schulübertritts befassen. Die Ergebnisse dieser Studien liefern wichtige Erkenntnisse für die weitere Analyse.
Das Kapitel „Projekt und Methodik“ beschreibt die verwendeten Daten und Methoden der Arbeit. Es wird das Nationale Bildungspanel (NEPS) vorgestellt, das als Datengrundlage dient. Die Stichprobe, die Datensatzkonstruktion und die Operationalisierung der relevanten Variablen werden erläutert. Zudem werden die deskriptiven und inferenzstatistischen Analysen vorgestellt, die zur Beantwortung der Forschungsfrage eingesetzt werden.
Die Ergebnisse der inferenzstatistischen Analyse werden im Kapitel „Ergebnisse der inferenzstatistischen Analyse“ präsentiert. Es werden zwei Gesamtmodelle vorgestellt, die den nonkonformen Gymnasialübergang und die Ablehnung einer Gymnasialschulempfehlung erklären. Die Ergebnisse werden interpretiert und in Bezug zu den theoretischen Modellen und dem aktuellen Forschungsstand diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Reproduktion sozialer Bildungsungleichheiten, den nonkonformen Schulübertritt, die Grundschulempfehlung, die Elternentscheidung, soziale Determinanten, die Wert-Erwartungstheorie, das Modell von Becker, das Nationale Bildungspanel (NEPS) und die binäre logistische Regression.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „nonkonformer Bildungsübergang“?
Ein nonkonformer Übergang liegt vor, wenn Eltern ihre Kinder an einer Schulform (z.B. Gymnasium) anmelden, obwohl die Lehrkräfte eine andere Empfehlung ausgesprochen haben.
Wie erklärt die Wert-Erwartungstheorie die Schulwahl?
Nach Esser (1999) basiert die Entscheidung der Eltern auf einer Abwägung zwischen dem Nutzen des Bildungsabschlusses, der Erfolgswahrscheinlichkeit und den anfallenden Kosten.
Welche Rolle spielen soziale Ressourcen der Eltern beim Schulwechsel?
Höher gebildete Eltern verfügen oft über mehr Ressourcen, um ihre Bildungsabsichten auch gegen eine unerwünschte Grundschulempfehlung durchzusetzen, was zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beiträgt.
Welche Daten wurden für die Analyse in dieser Arbeit genutzt?
Die Analyse basiert auf Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) aus den Jahren 2010/2011, speziell von Schülern in der fünften Klassenstufe.
Warum ist der Übergang nach der Grundschule so entscheidend?
Er gilt als zentrale Weichenstellung im deutschen Bildungssystem, die maßgeblich über den weiteren Bildungsverlauf und spätere Lebenschancen entscheidet.
- Citar trabajo
- Valentin Marquardt (Autor), 2014, Reproduktion sozialer Bildungsungleichheiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293382