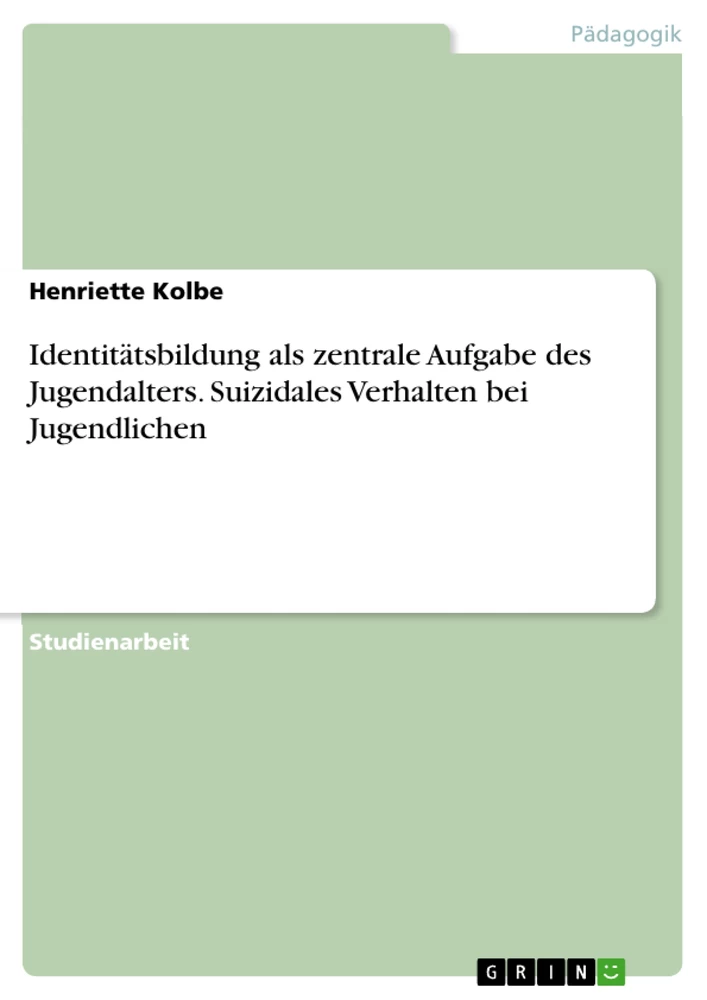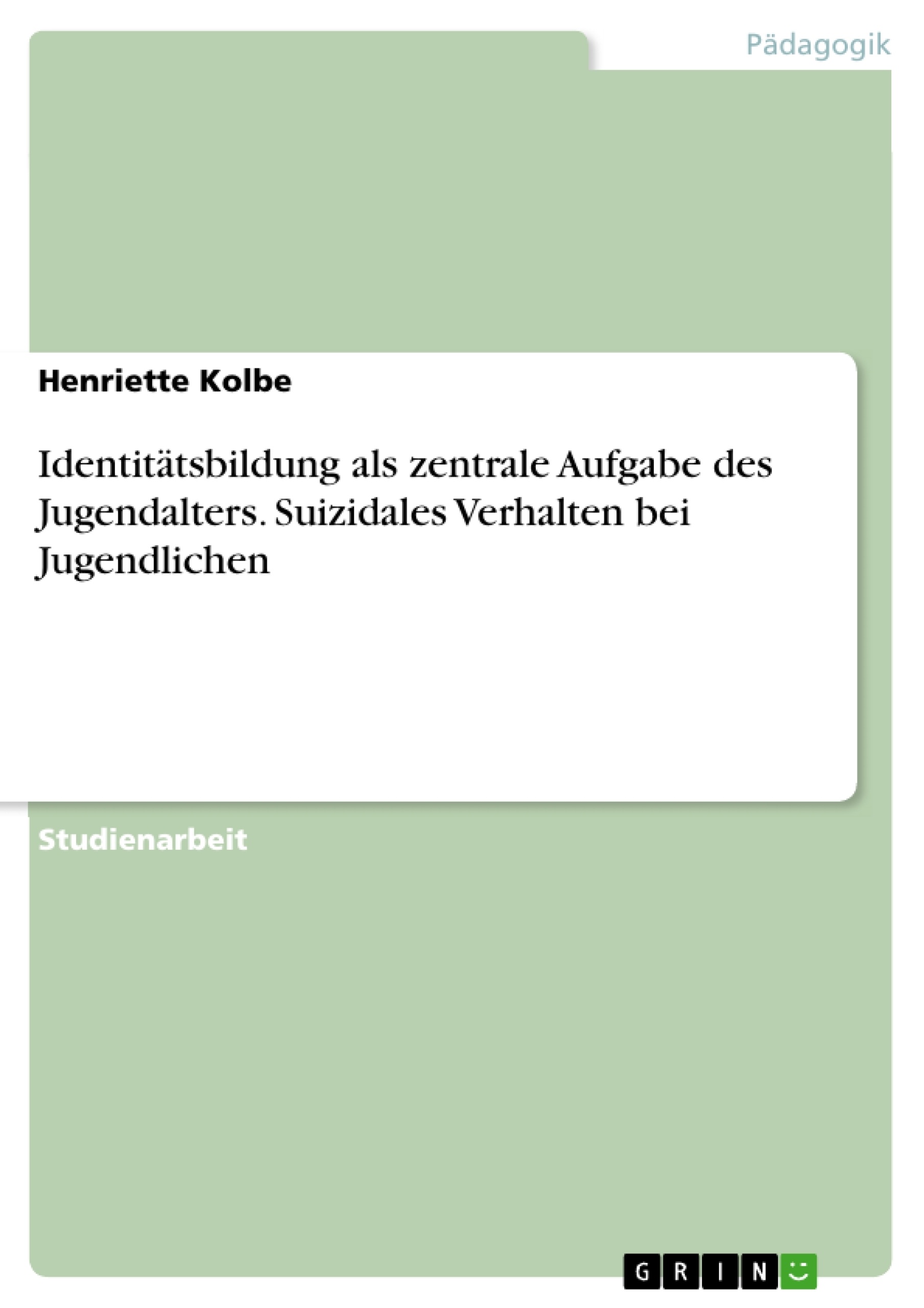Weshalb verletzt sich ein Mensch selbst und nimmt dabei möglicherweise bewusst oder unbewusst den eigenen Tod in kauf? Das ist eine sehr vielschichtige Frage, die nicht pauschal beantwortet werden kann. Individuelle Auslöser, die einen gravierenden Einschnitt darstellen, wie der Tod einer nahe stehenden Person, geben wohl einen ersten Ansatzpunkt. Allerdings liegen die Ursachen, solch ein Verhalten als Handlungsoption zu wählen, vermutlich deutlich tiefer. Dem Menschen fehlt es an Alternativen, sich aus dieser Situation adäquat zu befreien. Alternativen könnten durch das soziale Umfeld und die eigene Wertschätzung gegeben werden. Die Wertschätzung setzt allerdings ein Bewusstsein seiner selbst voraus. Demnach liegt es nahe, dass neben traumatischen oder gesundheitlichen Ursachen auch die Gewissheit über die eigene Person in Wechselwirkung mit dem sozialen Kontext eine Rolle spielt. Identität ist dabei als ein weites Feld zu begreifen. Die stetige Entwicklung und Anpassung der eigenen Identität ist eine zentrale Aufgabe im Leben eines Menschen. Ob beruflich, privat oder gesellschaftlich, der Mensch ist immer wieder vor neue Anforderungen gestellt, denen er sich anpassen sollte. Vor allem im Jugendalter, wenn in Loslösung von den kindlichen Vorstellungen erstmals eine eigene, reflektierte Auseinandersetzung mit einem selbst erfolgt, stellt die Entwicklung des eigenen Ichs eine wesentliche Entwicklungsaufgabe dar. Doch gerade in dieser unbeständigen Zeit des Jugendalters lässt sich das Gefühl von Überforderung wohl nicht vermeiden. In einem Zwischenstadium zwischen Kind sein, welches wohlbehütet unter dem Schutz der Eltern steht, und dem Erwachsenenalter, in dem man selbstbestimmt sein Leben führen kann, muss der / die Adoleszente seinen / ihren neuen Platz erst finden. In Anbetracht dieser Besonderheit des Jugendalters beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf die Gruppe der Jugendlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Identität
- Jugendalter
- Suizidalität
- Theorien der Identitätsentwicklung
- Einflussfaktoren auf die Identitätsbildung
- Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson
- Identitätstypen nach James Marcia
- Suizidalität im Jugendalter
- Ursachen und Suizidrate in Deutschland
- Einfluss der Identitätsentwicklung
- Schlussbetrachtung
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem möglichen Zusammenhang zwischen der Identitätsentwicklung und suizidalem Verhalten im Jugendalter. Ziel ist es, die Bedeutung der Identitätsbildung für die psychische Gesundheit von Jugendlichen zu beleuchten und mögliche Zusammenhänge zwischen einer gestörten Identitätsentwicklung und suizidalen Gedanken oder Handlungen aufzuzeigen.
- Identitätsentwicklung im Jugendalter
- Einflussfaktoren auf die Identitätsbildung
- Suizidalität als Ausdruck von Identitätskonflikten
- Mögliche Zusammenhänge zwischen Identitätsentwicklung und Suizidalität
- Pädagogische Implikationen für die Prävention suizidaler Verhaltensweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Suizidalität bei Jugendlichen ein und stellt die zentrale Frage nach dem Zusammenhang zwischen Identitätsentwicklung und suizidalem Verhalten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gruppe der Jugendlichen, da diese sich in einer besonderen Phase der Entwicklung befinden, in der die eigene Identität neu definiert und gefestigt wird.
Im Kapitel "Begriffsbestimmungen" werden die Begriffe Identität, Jugendalter und Suizidalität definiert und im Kontext der Arbeit erläutert. Die Identität wird als ein komplexes Konstrukt verstanden, das sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, wie z.B. Selbstbild, Selbstwertgefühl und soziale Rolle. Das Jugendalter wird als eine Phase des Umbruchs und der Veränderung beschrieben, in der die Jugendlichen ihre eigene Identität finden und festigen müssen. Suizidalität wird als ein komplexes Phänomen verstanden, das durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. psychische Erkrankungen, soziale Isolation und traumatische Erlebnisse.
Das Kapitel "Theorien der Identitätsentwicklung" beleuchtet verschiedene Theorien, die die Entwicklung der Identität im Jugendalter erklären. Es werden die Einflussfaktoren auf die Identitätsbildung, das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson und die Identitätstypen nach James Marcia vorgestellt. Diese Theorien liefern wichtige Erkenntnisse über die Prozesse, die bei der Entwicklung der eigenen Identität eine Rolle spielen.
Das Kapitel "Suizidalität im Jugendalter" befasst sich mit den Ursachen und der Suizidrate in Deutschland. Es werden verschiedene Faktoren, die zu suizidalem Verhalten bei Jugendlichen führen können, wie z.B. psychische Erkrankungen, soziale Isolation, Mobbing und familiäre Probleme, diskutiert. Darüber hinaus wird der Einfluss der Identitätsentwicklung auf die Entstehung suizidaler Gedanken und Handlungen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Identitätsbildung, das Jugendalter, Suizidalität, psychosoziale Entwicklung, Erikson, Marcia, Einflussfaktoren, Ursachen, Prävention und pädagogische Implikationen. Der Text beleuchtet die Bedeutung der Identitätsentwicklung für die psychische Gesundheit von Jugendlichen und untersucht mögliche Zusammenhänge zwischen einer gestörten Identitätsentwicklung und suizidalem Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Identitätsbildung im Jugendalter so wichtig?
In der Adoleszenz müssen Jugendliche ihren Platz zwischen Kindheit und Erwachsenenalter finden, was oft zu Gefühlen der Überforderung führen kann.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Identität und Suizidalität?
Ja, die Arbeit untersucht, ob eine gestörte Identitätsentwicklung und mangelnde Selbstwertschätzung Risikofaktoren für suizidales Verhalten sind.
Welche Theorien werden zur Identitätsentwicklung herangezogen?
Die Arbeit nutzt das Stufenmodell von Erik H. Erikson und die Identitätstypen nach James Marcia.
Was sind häufige Ursachen für Suizidalität bei Jugendlichen?
Neben Identitätskonflikten spielen psychische Erkrankungen, soziale Isolation, Mobbing und traumatische Erlebnisse eine Rolle.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld?
Ein stabiles soziales Umfeld kann Alternativen und Rückhalt bieten, um Krisensituationen ohne Selbstverletzung zu bewältigen.
- Quote paper
- Henriette Kolbe (Author), 2014, Identitätsbildung als zentrale Aufgabe des Jugendalters. Suizidales Verhalten bei Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293476