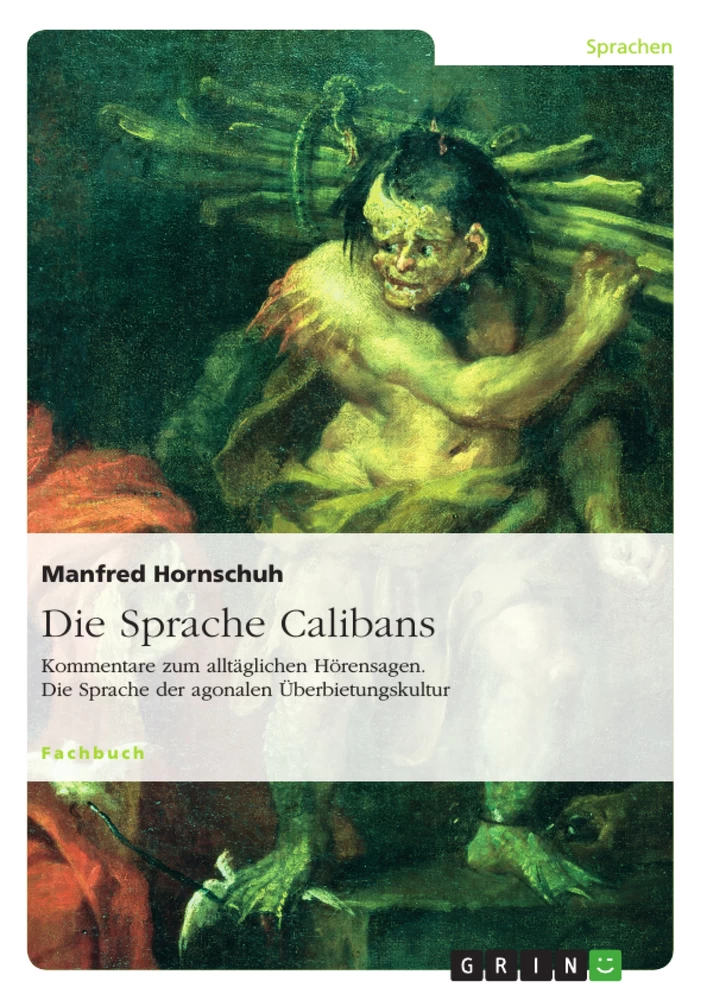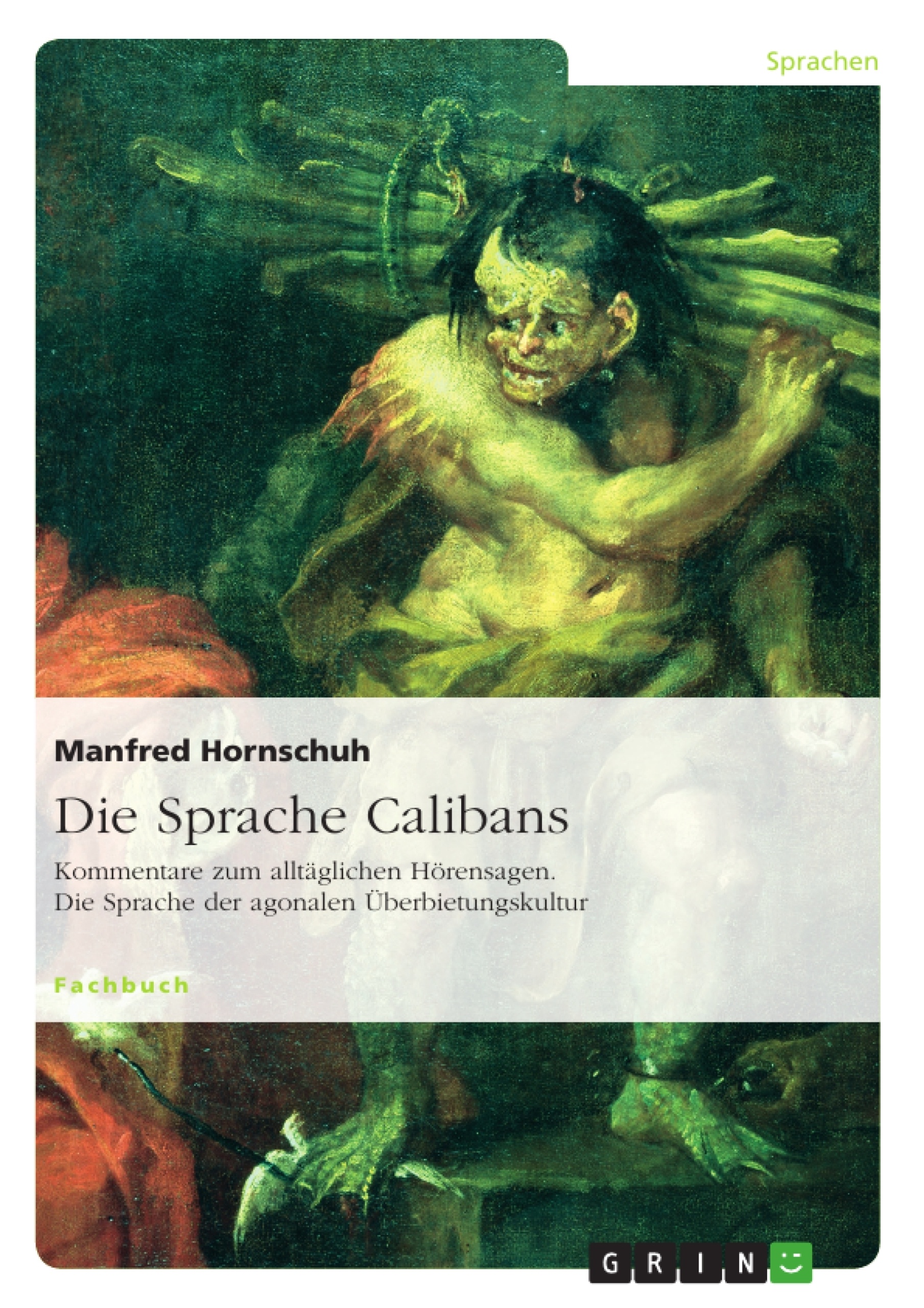„Die Sprache Calibans“ ist eine materialgesättigte Gegenwartskunde in philosophischer Perspektive. Die Arbeit versucht herauszufinden, woran wir sind; sie erschließt in dieser Absicht den Wesenskern der Gegenwart aus ihrer Sprache, aus charakteristischen Wortverbindungen, mehr noch aus dem was sie von sich abstößt: den „veraltet“ genannten Wörtern. Da Sprache kein isoliertes Dasein hat, stellt diese Arbeit sie in ihren realen, das heißt gesellschaftlichen, Zusammenhang. Sprachanalyse geht Hand in Hand mit Gesellschaftskritik.
Teil 1: Kommentare zum alltäglichen Hörensagen
Teil 2: Zur Sprache der agonalen Überbietungskultur
You will find a text preview here soon.
Excerpt out of 643 pages
- scroll top
- Quote paper
- Manfred Hornschuh (Author), 2015, Die Sprache Calibans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293508
Look inside the ebook