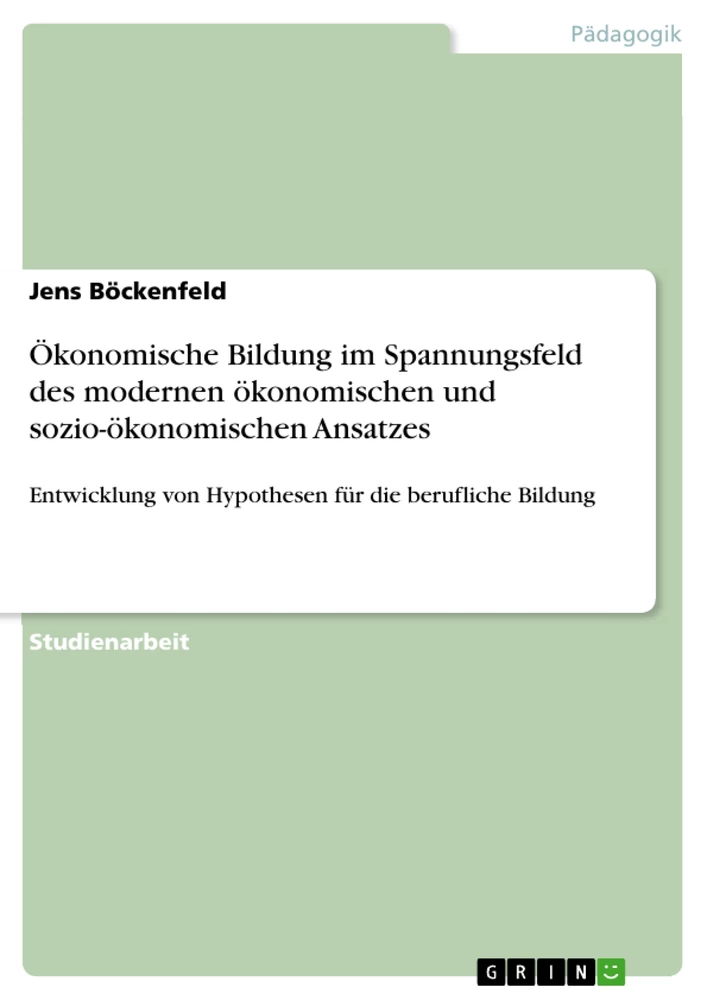In unserer heutigen Gesellschaft werden die kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Systeme oft für Phänomene wie z. B. Globalisierung, Klimawandel, Umweltzerstörung, soziale Ungleichheit, Managergier, Korruption usw. verantwortlich gemacht (vgl. exemplarisch Hedtke 2008a, S. 457). Bereits seit den 1960er-Jahren üben links-liberale Autoren derartige Gesellschaftskritik aus. In vergangener Zeit hat z. B. die Occupy-Bewegung oder der konservative Buchautor und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Frank Schirrmacher medienwirksam die Macht der Ökonomie in Frage gestellt.
In allen Argumentationen wird der dem Eigennutzen folgende Mensch, der sein Leben als eine einzige Gewinn- und Verlustrechnung in einer von sozialen Beziehungen geprägten Welt darstellt, als Ursache ausgemacht. Der sogenannte homo oeconomicus sei in allen Lebensbereichen menschlichen Handelns wiederzufinden (vgl. Engartner / Krisanthan 2013, S. 243 f.). Dabei ist zu beachten, dass gesellschaftliche Wertvorstellungen das Ergebnis komplexer Bildung-, Erziehungs- und Sozialisationsprozessen ist. Gerade in einem für diese Prozesse wichtigen Bildungssystem hat Ökonomie auch bereits Einzug gehalten, was z. B. alleine schon an Schlagworten wie Humankapital, Wettbewerb autonomer Schulen und Hochschulen, Output-Orientierung, Leistungsmessung und Evaluation oder Bildungsstandards deutlich wird (vgl. Krautz 2007, Pos. 53). Auch ökonomische Bildung ist von diesem Trend ergriffen: Obwohl diese von verschiedenen Denkschulen geprägt ist, ist von den Kritikern oft von einer eindimensionalen ökonomischen Sichtweise die Rede.
Die vorliegende Arbeit skizziert eingangs anhand des Buchs Des Menschen Wolf von Jürgen Freimann die Phänomene, Ursachen und Auswege der Ökonomisierung unserer Gesellschaft. Im Anschluss werden die Ansätze der modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Bildung pointiert vorgestellt, um diese dann auf der Grundlage des Buches von Freimann zu erörtern. In einem nächsten Schritt werden auf Grundlage dieser Erörterung Thesen bzw. Hypothesen für die berufliche Bildung aufgestellt und argumentativ begründet. Im abschließenden Fazit erfolgen eine Rekapitulation der zentralen Ergebnisse sowie eine kritische Reflexion dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Ökonomisierung der Gesellschaft nach Freimann: Phänomene, Ursachen, Auswege
- Ansätze ökonomischer Bildung
- Ansatz der modernen ökonomischen Bildung
- Ansatz der sozio-ökonomischen Bildung
- Erörterung des Ansatzes von Freimann im Spannungsfeld der modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Bildung
- Übertragung auf die berufliche Bildung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Ökonomisierung der Gesellschaft anhand des Buches "Des Menschen Wolf" von Jürgen Freimann und untersucht die Auswirkungen auf die ökonomische Bildung. Die Arbeit beleuchtet die Ansätze der modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Bildung und erörtert deren Spannungsfeld. Schließlich werden Hypothesen für die berufliche Bildung entwickelt, die auf den Erkenntnissen der Analyse basieren.
- Ökonomisierung der Gesellschaft und ihre Auswirkungen
- Ansätze der modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Bildung
- Spannungsfeld zwischen den Ansätzen der ökonomischen Bildung
- Hypothesen für die berufliche Bildung
- Kritik an der eindimensionalen ökonomischen Sichtweise
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Ökonomisierung der Gesellschaft ein und stellt die Relevanz des Themas für die ökonomische Bildung dar. Sie beleuchtet die Kritik an der eindimensionalen ökonomischen Sichtweise und die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtungsweise.
Das Kapitel "Ökonomisierung der Gesellschaft nach Freimann: Phänomene, Ursachen, Auswege" analysiert die Phänomene der Ökonomisierung anhand des Buches "Des Menschen Wolf" von Jürgen Freimann. Es werden die Ursachen der Ökonomisierung untersucht und mögliche Auswege aufgezeigt.
Das Kapitel "Ansätze ökonomischer Bildung" stellt die Ansätze der modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Bildung vor. Es werden die jeweiligen Schwerpunkte und Ziele der Ansätze erläutert.
Das Kapitel "Erörterung des Ansatzes von Freimann im Spannungsfeld der modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Bildung" setzt sich mit dem Ansatz von Freimann auseinander und untersucht dessen Positionierung im Spannungsfeld der modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Bildung.
Das Kapitel "Übertragung auf die berufliche Bildung" entwickelt Hypothesen für die berufliche Bildung, die auf den Erkenntnissen der vorherigen Kapitel basieren. Es werden die Implikationen der Ökonomisierung der Gesellschaft für die berufliche Bildung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ökonomisierung der Gesellschaft, die moderne ökonomische Bildung, die sozio-ökonomische Bildung, das Spannungsfeld zwischen den Ansätzen, die berufliche Bildung, die Kritik an der eindimensionalen ökonomischen Sichtweise und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "Ökonomisierung der Gesellschaft"?
Damit ist die Ausbreitung ökonomischer Denkweisen (Gewinn-Verlust-Rechnung, Wettbewerb) auf alle Lebensbereiche wie Bildung, Gesundheit und soziale Beziehungen gemeint.
Was ist der Unterschied zwischen ökonomischer und sozio-ökonomischer Bildung?
Die moderne ökonomische Bildung fokussiert oft auf Marktmechanismen, während die sozio-ökonomische Bildung wirtschaftliches Handeln in seinen sozialen und gesellschaftlichen Kontext einbettet.
Wer ist Jürgen Freimann und was thematisiert sein Buch "Des Menschen Wolf"?
Freimann analysiert in seinem Buch die Phänomene und Ursachen der Ökonomisierung und sucht nach Auswegen für eine nachhaltigere Lebensweise.
Welche Kritik gibt es am Modell des "Homo Oeconomicus"?
Kritiker bemängeln, dass dieses Modell den Menschen nur als egoistischen Nutzenmaximierer sieht und soziale Werte sowie komplexe Bildungsprozesse vernachlässigt.
Wie wirkt sich Ökonomisierung auf die berufliche Bildung aus?
Sie zeigt sich in Schlagworten wie Humankapital, Output-Orientierung und Leistungsmessung, was die pädagogischen Ziele der Ausbildung beeinflussen kann.
- Arbeit zitieren
- Diplom Kaufmann (FH) Jens Böckenfeld (Autor:in), 2014, Ökonomische Bildung im Spannungsfeld des modernen ökonomischen und sozio-ökonomischen Ansatzes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293514