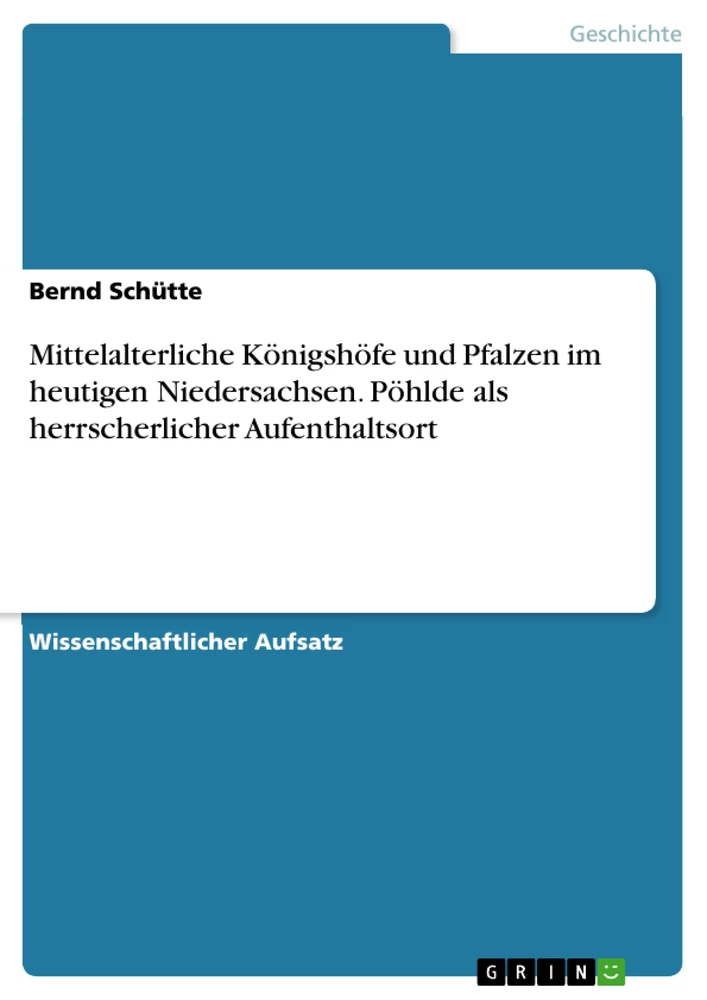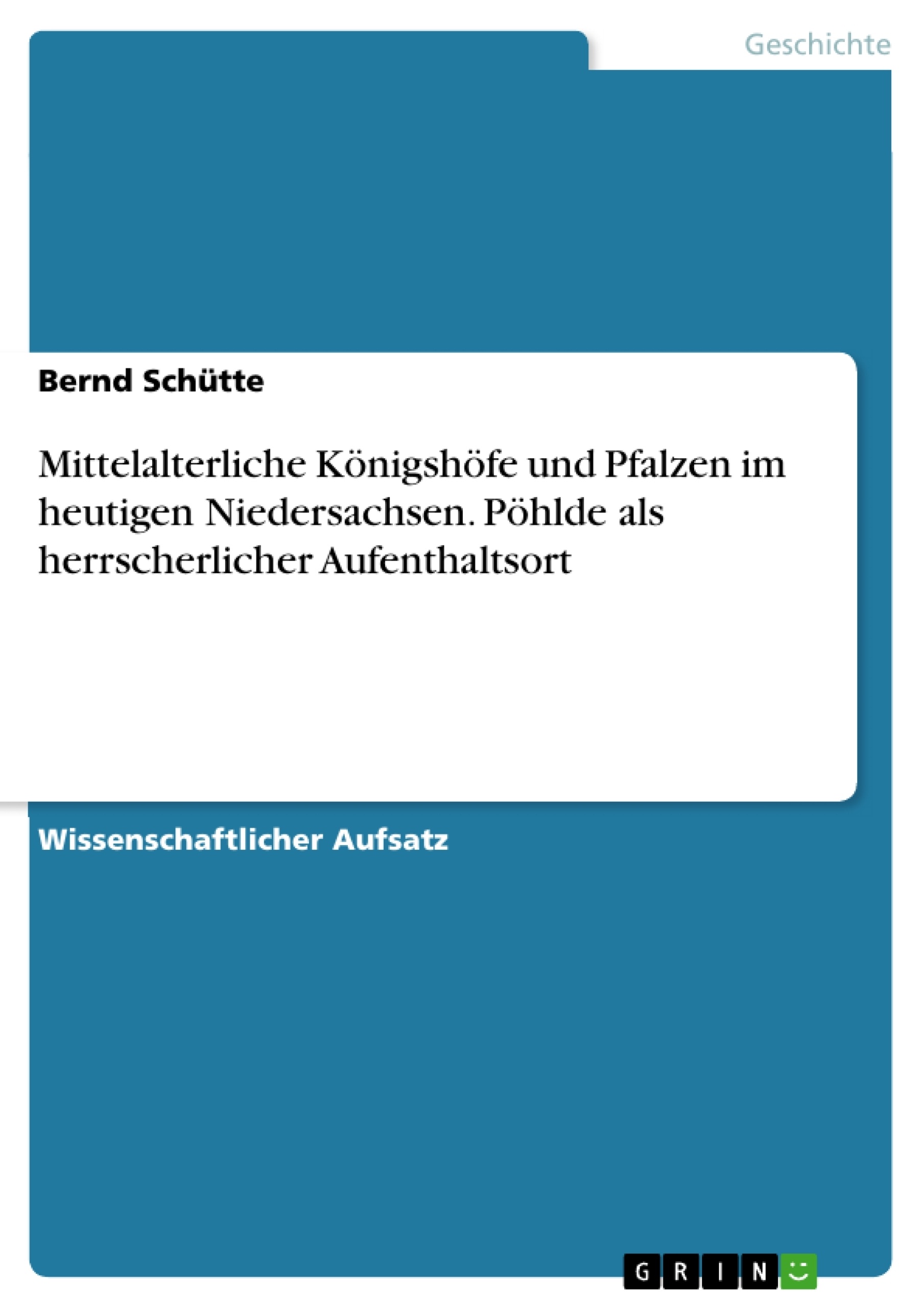Die mit den Reisewegen der hochmittelalterlichen Herrscher verbundenen Fragen genießen seit langem die besondere Aufmerksamkeit der Forschung, denn die vor allem vergleichende Untersuchung der Aufenthaltsorte führt in wichtige strukturelle, die Funktionsgeschichte des Königtums berührende Zusammenhänge.
Mit Blick auf die Auswahl der Itinerarstationen, auf die Anzahl und die Dauer der Besuche, auf die den Hof jeweils bildenden Großen und auf das herrscherliche Handeln liegen mittlerweile etliche Arbeiten vor, die sich mit unterschiedlichen Herangehensweisen und in unterschiedlicher Gewichtung dieses Themenkreises annehmen.
Neben prominenten Aufenthaltsstätten wie zum Beispiel Aachen, Frankfurt, Goslar, Quedlinburg, Regensburg, Speyer oder Würzburg lassen sich zahlreiche Orte verzeichnen, die zwar dem reisenden Königshof oft Unterkunft geboten haben und durchaus Schauplatz wichtiger Entscheidungen waren, aber einen weniger bekannten Namen haben, weil sie zum Beispiel nicht Sitz eines Bischofs waren, sich nicht zu einem städtischen Gemeinwesen entwickelten oder bald wieder aufgegeben wurden .
Zu diesem Kreis zählt das am südwestlichen Harzrand gelegene und heute zur niedersächsischen Stadt Herzberg zählende Pöhlde, das im 10. und 11. Jahrhundert als Itinerarstation der Könige und Kaiser in der Tat nicht ganz bedeutungslos war, wie im Folgenden umrissen werden soll .
Die von Heinrich I. (919-936) bis zu Heinrich IV. (1056-1106) reichenden Herrscheraufenthalte in Pöhlde am Harz werden in dieser Arbeit chronologisch vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Mittelalterliche Königshöfe und Pfalzen im heutigen Niedersachsen
- Pöhlde als herrscherlicher Aufenthaltsort
- Liudolfingisches Eigengut und die Schenkung an Mathilde
- Herrscherliche Aufenthalte in Pöhlde
- Regionale Bezüge und Intervenienten
- Heinrich I. und seine Aufenthaltsorte
- Königin Mathilde und die Gründung einer geistlichen Gemeinschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Pöhlde als Itinerarstation der Könige und Kaiser im 10. und 11. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Rolle Pöldes im Kontext des mittelalterlichen Reisekönigtums und der Funktionsgeschichte des Königtums im Allgemeinen.
- Pöhlde als liudolfingisches Eigengut und seine Schenkung an Königin Mathilde
- Die Aufenthalte Heinrichs I. in Pöhlde und deren Bedeutung
- Die regionalen Bezüge der in Pöhlde ausgestellten Urkunden
- Die Gründung einer geistlichen Gemeinschaft in Pöhlde durch Königin Mathilde
- Pöhlde im Vergleich zu anderen Aufenthaltsorten der Ottonen
Zusammenfassung der Kapitel
Mittelalterliche Königshöfe und Pfalzen im heutigen Niedersachsen: Der Text einleitet die Untersuchung der Bedeutung von Pöhlde als herrschaftlicher Aufenthaltsort im Kontext des mittelalterlichen Reisekönigtums und der Funktionsgeschichte des Königtums. Er hebt die Bedeutung vergleichender Untersuchungen von Aufenthaltsorten hervor, um strukturelle Zusammenhänge aufzuzeigen. Der Text verweist auf die bereits existierende Forschung zu diesem Thema und betont die Bedeutung von weniger bekannten Orten wie Pöhlde, die trotz ihrer geringeren Prominenz wichtige Funktionen erfüllten.
Pöhlde als herrscherlicher Aufenthaltsort: Dieses Kapitel beschreibt Pöhlde, seine Lage und seine Bedeutung im 10. und 11. Jahrhundert als Itinerarstation. Es wird die Frage nach dem Weg in den liudolfingischen Besitz untersucht. Die Erwähnung des Ortes in verschiedenen Quellen wird beleuchtet und die Bedeutung des Suffixes „-ithi“ im Ortsnamen erörtert.
Liudolfingisches Eigengut und die Schenkung an Mathilde: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Schenkung Pöldes an Königin Mathilde durch König Heinrich I. Es analysiert die Urkunden, die diese Schenkung belegen, und diskutiert die Bedeutung von Pöhlde als „propria hereditas“ im Kontext der anderen geschenkten Orte. Die Frage nach dem Zeitpunkt und dem Weg des Übergangs in liudolfingischen Besitz wird thematisiert.
Herrscherliche Aufenthalte in Pöhlde: Hier werden die dokumentierten Aufenthalte Heinrichs I. in Pöhlde detailliert untersucht. Die Urkunden aus den Jahren 922 und 932 werden analysiert, und es wird spekuliert, ob Heinrich I. auch Weihnachten 931 und das Epiphaniasfest 932 in Pöhlde verbrachte. Die Bedeutung dieser Aufenthalte für die regionale Politik und die Herrschaftsausübung wird erörtert.
Regionale Bezüge und Intervenienten: Dieses Kapitel analysiert die regionalen Bezüge der in Pöhlde ausgestellten Urkunden, insbesondere die Rolle des Bischofs Adalward von Verden als Fürsprecher. Die Bedeutung der Intervenienten und Petenten wird diskutiert, und es wird die Frage aufgeworfen, ob deren Anwesenheit in Pöhlde zu den jeweiligen Zeitpunkten tatsächlich belegt ist.
Heinrich I. und seine Aufenthaltsorte: Der Abschnitt untersucht die Aufenthaltsorte Heinrichs I. im Kontext seiner Herrschaft. Es werden die wenigen erhaltenen Urkunden und die erzählenden Quellen verglichen, wobei die Häufung von Aufenthaltsorten im liudolfingischen Kerngebiet (Harz und Thüringen) hervorgehoben wird. Pöhlde wird im Vergleich zu anderen Aufenthaltsorten des Königs hinsichtlich der Häufigkeit seiner Besuche eingeordnet.
Königin Mathilde und die Gründung einer geistlichen Gemeinschaft: Abschließend wird die Gründung einer geistlichen Gemeinschaft in Pöhlde durch Königin Mathilde nach dem Tod Heinrichs I. beleuchtet. Die Rolle dieser Gründung im Kontext der Memoria und der Herrschaftsrepräsentation wird erörtert. Die Unsicherheiten bezüglich der genauen Zeit der Gründung und der Zusammensetzung des Konvents werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Pöhlde, mittelalterliches Reisekönigtum, Liudolfinger, Heinrich I., Königin Mathilde, Itinerarstation, königlicher Aufenthaltsort, Urkunden, geistliche Gemeinschaft, Ottonen, Harz, Witwengut, propria hereditas.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Königshöfe und Pfalzen im heutigen Niedersachsen - Pöhlde als Itinerarstation
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Pöhlde als Itinerarstation der Könige und Kaiser im 10. und 11. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Rolle Pöldes im Kontext des mittelalterlichen Reisekönigtums und der Funktionsgeschichte des Königtums. Die Studie vergleicht Pöhlde mit anderen Aufenthaltsorten der Ottonen und beleuchtet dessen Bedeutung trotz seiner geringeren Prominenz im Vergleich zu anderen, bekannteren Orten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Untersuchung umfasst die liudolfingische Geschichte Pöldes, die Schenkung an Königin Mathilde, die Aufenthalte Heinrichs I. in Pöhlde und deren Bedeutung für die regionale Politik, die Analyse der in Pöhlde ausgestellten Urkunden und deren regionale Bezüge, sowie die Gründung einer geistlichen Gemeinschaft in Pöhlde durch Königin Mathilde nach dem Tod Heinrichs I.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Studie basiert auf der Analyse von Urkunden aus den Jahren 922 und 932, die die Aufenthalte Heinrichs I. in Pöhlde belegen. Weiterhin werden erzählende Quellen und die Forschung zu anderen Aufenthaltsorten der Ottonen herangezogen, um Pöhlde in einen größeren Kontext einzubetten. Die Bedeutung der in Pöhlde ausgestellten Urkunden und die Rolle der darin genannten Intervenienten werden ebenfalls untersucht.
Welche Bedeutung hatte Pöhlde als königlicher Aufenthaltsort?
Pöhlde diente als wichtige Itinerarstation im 10. und 11. Jahrhundert. Die Aufenthalte Heinrichs I. in Pöhlde, belegt durch Urkunden, unterstreichen die Bedeutung des Ortes für die regionale Politik und Herrschaftsausübung. Die Untersuchung beleuchtet, ob Heinrich I. auch Weihnachten 931 und das Epiphaniasfest 932 in Pöhlde verbrachte. Die Häufung von Aufenthaltsorten Heinrichs I. im liudolfingischen Kerngebiet wird im Kontext der Gesamtstrategie seiner Herrschaft betrachtet.
Welche Rolle spielte Königin Mathilde in Bezug auf Pöhlde?
Königin Mathilde erhielt Pöhlde als Schenkung von König Heinrich I. Nach dessen Tod gründete sie in Pöhlde eine geistliche Gemeinschaft, deren Bedeutung für Memoria und Herrschaftsrepräsentation untersucht wird. Die genaue Zeit der Gründung und die Zusammensetzung des Konvents bleiben jedoch teilweise ungeklärt.
Wie wird Pöhlde im Vergleich zu anderen Aufenthaltsorten der Ottonen betrachtet?
Die Studie vergleicht Pöhlde mit anderen Aufenthaltsorten Heinrichs I. und anderer Ottonen, um dessen Bedeutung im Kontext des gesamten Herrschaftsgebietes und der politischen Strategien der Könige einzuordnen. Der Vergleich hebt die Bedeutung weniger bekannter Orte wie Pöhlde hervor und zeigt deren Funktion im Gesamtgefüge des mittelalterlichen Reisekönigtums.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pöhlde, mittelalterliches Reisekönigtum, Liudolfinger, Heinrich I., Königin Mathilde, Itinerarstation, königlicher Aufenthaltsort, Urkunden, geistliche Gemeinschaft, Ottonen, Harz, Witwengut, propria hereditas.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu mittelalterlichen Königshöfen und Pfalzen in Niedersachsen, Pöhlde als herrschaftlicher Aufenthaltsort, dem liudolfingischen Eigengut und der Schenkung an Mathilde, den herrschaftlichen Aufenthalten in Pöhlde, regionalen Bezügen und Intervenienten, den Aufenthaltsorten Heinrichs I., und schließlich der Gründung einer geistlichen Gemeinschaft durch Königin Mathilde.
- Citation du texte
- Bernd Schütte (Auteur), 2015, Mittelalterliche Königshöfe und Pfalzen im heutigen Niedersachsen. Pöhlde als herrscherlicher Aufenthaltsort, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293556