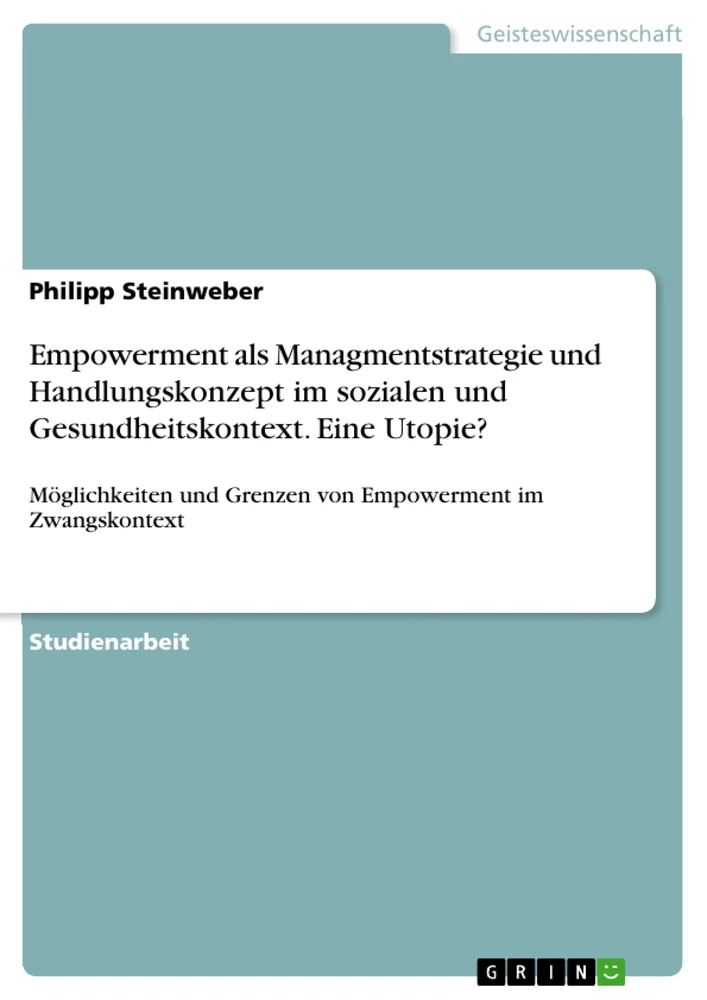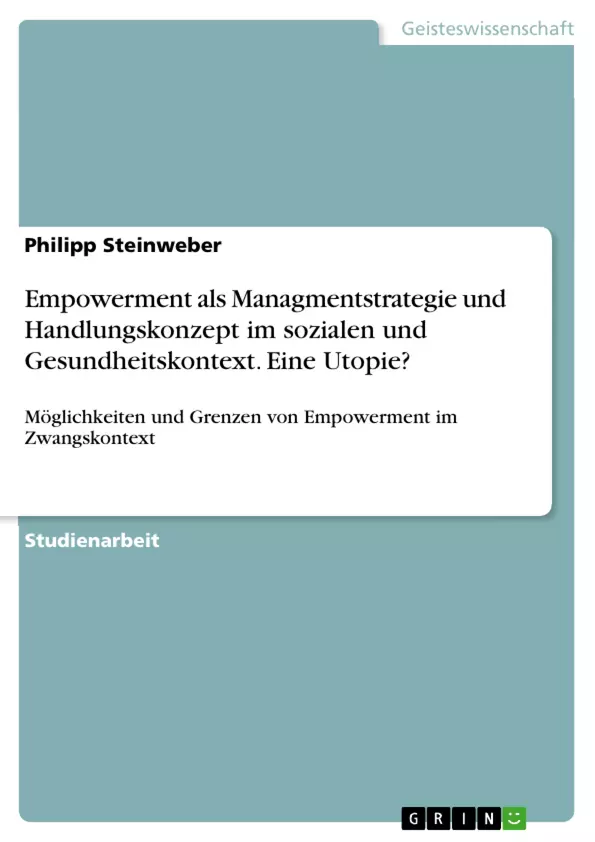Egal in welchem Bereich des Lebens versuchen wir Menschen immer effizienter zu werden. Immer neue Modelle und Konzepte erreichen viele Bereiche des alltäglichen Lebens. Bestimmte Situationen im Leben bringen uns und andere wiederum an die Grenzen des Machbaren oder aber auch darüber hinaus. Ein Gefühl des Ausgeliefertsein und der Ohnmacht macht sich breit und es gilt nun zu überlegen, was zu tun ist. In vielen Situationen sieht man aber keinen Ausweg und bleibt resignierend auf der Strecke.
So geht es Einzelpersonen, Gruppen und Vereinen mit einem gemeinsamen Hintergrund oder Anliegen oder eben Firmen und ganzen Branchen. Gegen diese Situation des Ausgeliefertsein und der Abhängigkeit von Strukturen und Mechanismus oder anderen Menschen versucht das Konzept von Empowerment eine neue Denkstruktur anzubieten. In Situationen der Machtlosigkeit, eben der Ohnmacht, richtet Empowerment „den Blick auf die Selbstgestaltungskräfte […] und auf die Ressourcen, die […] produktiv zur Veränderung von belastenden Lebensumständen einzusetzen“ sind (Herriger 2006 S. 7). Empowerment wird nicht als Übertagung von Fähigkeiten und Macht angesehen, sondern als Machtaktivierung, da die Macht Gutes zu leisten in einem jeden Menschen bereits vorhanden ist (Blanchard et al. 2003 S.24).
Die Frage ist, ob dieses Konzept sich in allen Bereichen der Sozialen Arbeit und des Gesundheitswesen umsetzte lässt. Im Besonderen stellt sich die Frage, ob in einem Zwangskontext wie einer beschützten Unterbringung Empowerment er- und gelebt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Geschichte des Empowements
- 3. Der Zwangskontext
- 3.1 Bedingungen für Empowerment
- 3.2 Empowerment in der Praxis
- 3.3 Transparenz schaffen und Rollen klären
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit des Empowerment-Konzepts im Sozial- und Gesundheitskontext, insbesondere im Kontext der beschützten Unterbringung. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob Empowerment in Zwangssituationen, in denen Freiwilligkeit eingeschränkt ist, überhaupt möglich ist und unter welchen Bedingungen es angewandt und umgesetzt werden kann.
- Definition und Geschichte des Empowements
- Herausforderungen des Zwangskontextes für Empowerment
- Bedingungen für Empowerment im Zwangskontext
- Praktische Umsetzung von Empowerment in der Praxis
- Transparenz und Rollenklärung im Empowerment-Prozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Empowerment ein und erläutert dessen Bedeutung in verschiedenen Lebensbereichen, insbesondere in Situationen von Ohnmacht und Abhängigkeit. Kapitel 2 definiert den Begriff "Empowerment" und beleuchtet seine historische Entwicklung. Dabei werden die Wurzeln der Empowerment-Bewegung in der Bürgerrechtsbewegung, der Friedensbewegung und der Frauenbewegung hervorgehoben.
Kapitel 3 widmet sich dem Zwangskontext, in dem Empowerment Anwendung finden soll. Hierbei werden die spezifischen Herausforderungen und Schwierigkeiten beleuchtet, die sich aus der eingeschränkten Freiwilligkeit und der Fremdbestimmung ergeben. Es wird untersucht, welche Bedingungen für eine gelungene Empowerment-Arbeit in solchen Situationen notwendig sind.
In Kapitel 3.1 werden die Voraussetzungen für Empowerment in Zwangssituationen näher betrachtet. Es wird deutlich, dass Empowerment eine gewisse Erkenntniskompetenz und soziale Ressourcen voraussetzt, ohne die eine Selbstbefähigung kaum möglich ist.
Schlüsselwörter
Empowerment, Selbstbefähigung, Selbstbemächtigung, Zwangskontext, beschützte Unterbringung, Freiwilligkeit, Fremdbestimmung, soziale Arbeit, Gesundheitswesen, Ressourcen, Erkenntniskompetenz, Transparenz, Rollenklärung, Praxis,
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Empowerment?
Empowerment bedeutet "Selbstbemächtigung" und zielt darauf ab, die Selbstgestaltungskräfte und Ressourcen von Menschen zu aktivieren.
Ist Empowerment in einem Zwangskontext möglich?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Empowerment in geschlossenen Unterbringungen funktionieren kann, wenn die Freiwilligkeit eingeschränkt ist.
Welche Rolle spielt Transparenz beim Empowerment?
Transparenz und klare Rollenverteilung sind essenziell, damit Betroffene ihre Situation verstehen und Handlungsspielräume nutzen können.
Was sind die Wurzeln der Empowerment-Bewegung?
Das Konzept stammt ursprünglich aus der Bürgerrechts-, Friedens- und Frauenbewegung.
Wie wird Empowerment im Gesundheitswesen eingesetzt?
Es dient dazu, Patienten von passiven Empfängern zu aktiven Gestaltern ihrer eigenen Gesundheit und Genesung zu machen.
- Arbeit zitieren
- Philipp Steinweber (Autor:in), 2014, Empowerment als Managmentstrategie und Handlungskonzept im sozialen und Gesundheitskontext. Eine Utopie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293585