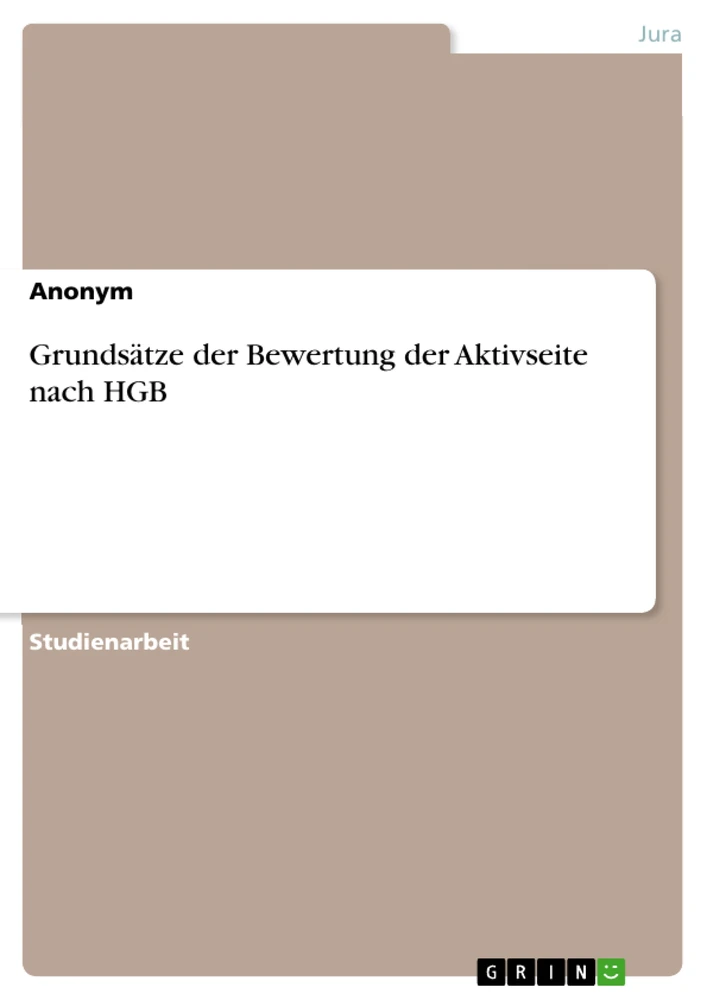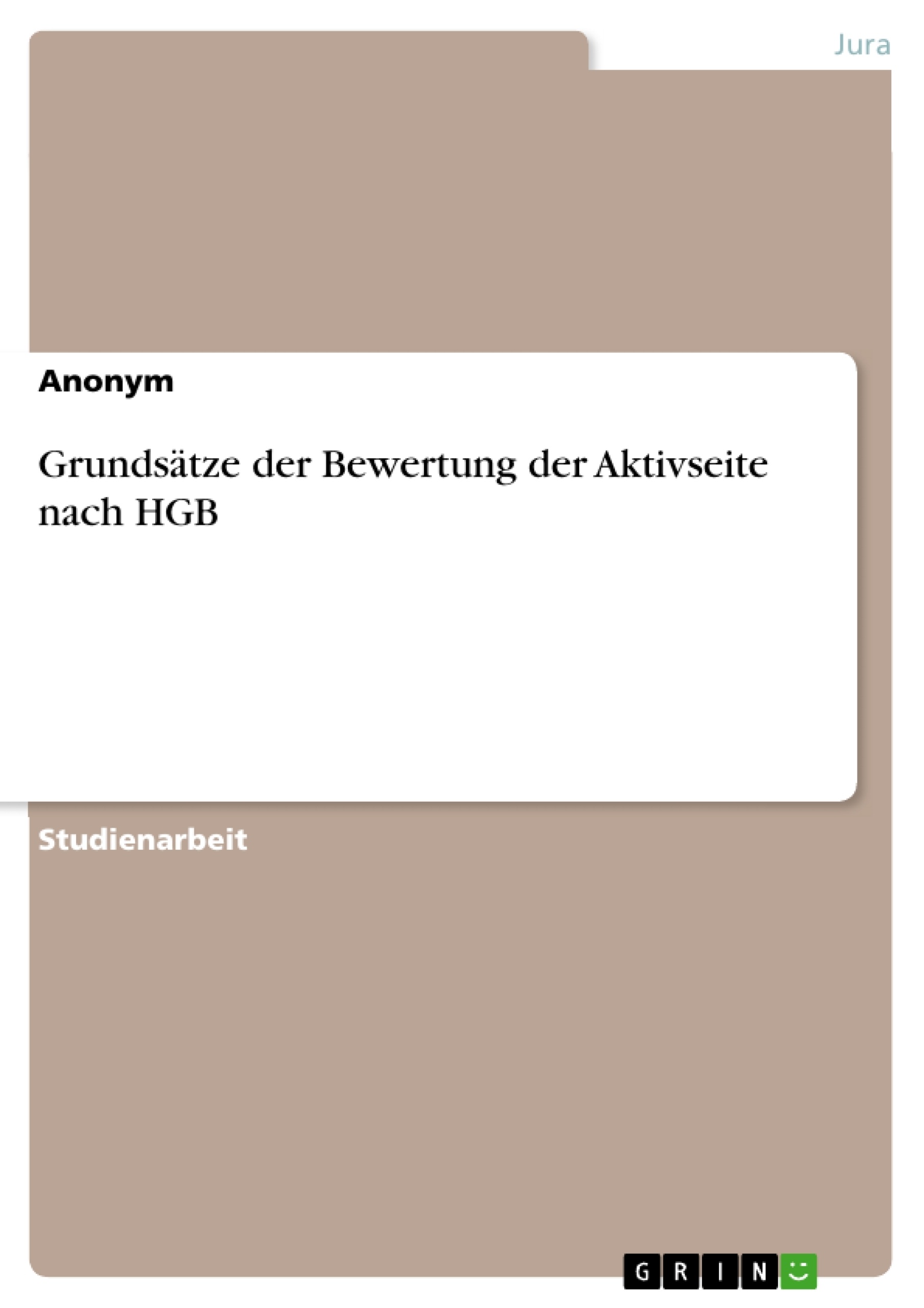Die Bilanz, die ein Kaufmann am Ende eines Wirtschaftsjahres zu erstellen hat, wird von dem Wertansatz der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst. Es genügt deshalb nicht, alle Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens gem. geltenden Aktivierungsvoraussetzungen vollständig zu erfassen. Steht fest, welche Posten der Unternehmer bilanzieren muss und welche er darüber hinaus zulässigerweise bilanzieren will, hat er gem. den Bewertungsvorschriften §§ 252 bis 256 HGB die Werte zu ermitteln, mit denen die Posten in der Bilanz anzusetzen sind. Diese Werte ergeben sich für die Vermögensgegenstände grundsätzlich dadurch, dass die Buchwerte der Wirt-schaftsgüter um ggf. vorzunehmende Abschreibungen vermindert werden.
Abschreibungen sind aus verschiedenen Gründen vorzunehmen. Gem. § 253 HGB kann es sich um planmäßige (vorhersehbare) und außerplanmäßige Abschreibungen handeln. Verbrauchsbedingt abgeschrieben wird ein Vermögensgegenstand beispielsweise durch natürlichen Verschleiß (Bsp. Abnutzung einer Produktionsmaschine), technischen Verschleiß (Bsp. PKW-Abschreibung aufgrund eines Totalschadens) oder Katastrophenverschleiß (höhere Gewalt). Wirtschaftlich bedingte Abschreibungen können sich infolge von Nachfrageverschiebungen, technischem Fortschritt, sinkender Wiederbeschaffungskosten oder sinkender Absatzpreise ergeben.
Steuerrechtliche Bewertungsregelungen sowie die Bewertung der Passivseite werden in dieser Ausarbeitung nicht betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Ansatz- und Bewertungsgrundsätze
- Grundsatz der Bilanzkontinuität
- Grundsatz der Unternehmensfortführung
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Grundsatz der Vorsicht
- Grundsatz der Periodenabgrenzung
- Grundsatz der Stetigkeit
- Grundlegende Bewertungsmaßstäbe
- Bewertung des Anlagevermögens
- Nicht abnutzbares Anlagevermögen
- Grund und Boden
- Finanzanlagevermögen
- Abnutzbares Sachanlagevermögen
- Immaterielles Anlagevermögen
- Nicht abnutzbares Anlagevermögen
- Bewertung des Umlaufvermögens
- Anmerkung zur Vorratsbewertung
- Anmerkung zur Forderungsbewertung in Euro
- Anmerkung zur Forderungsbewertung in Fremdwährung
- Anlagen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit den Grundsätzen der Bewertung der Aktivseite nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Es analysiert die relevanten Vorschriften des HGB und beleuchtet die wichtigsten Bewertungsgrundsätze, die bei der Erstellung der Bilanz eines Kaufmanns zu beachten sind.
- Die Bedeutung der Bilanzkontinuität und des Going-Concern-Prinzips
- Die verschiedenen Bewertungsmaßstäbe für Anlage- und Umlaufvermögen
- Die Anwendung des Vorsichtsprinzips bei der Bewertung von Vermögensgegenständen
- Die Bedeutung der Periodenabgrenzung und der Stetigkeit bei der Bilanzierung
- Die spezifischen Bewertungsregelungen für verschiedene Vermögensgegenstände, wie Grund und Boden, Finanzanlagen und Forderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Bewertung der Aktivseite im HGB ein. Es erläutert die Notwendigkeit einer korrekten Bewertung der Vermögensgegenstände und die Relevanz der Abschreibungen.
Kapitel 2 behandelt die allgemeinen Ansatz- und Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB. Es stellt das Identitätsprinzip (Bilanzkontinuität), das Going-Concern-Prinzip, das Einzelbewertungsprinzip, das Vorsichtsprinzip, das Periodenabgrenzungsprinzip und das Stetigkeitsprinzip vor.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Referats sind: Bilanz, Handelsgesetzbuch (HGB), Aktivseite, Bewertungsgrundsätze, Bilanzkontinuität, Going-Concern-Prinzip, Einzelbewertung, Vorsichtsprinzip, Periodenabgrenzung, Stetigkeit, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Abschreibungen, Wertansatz.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Grundsätze der Bewertung der Aktivseite nach HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293701