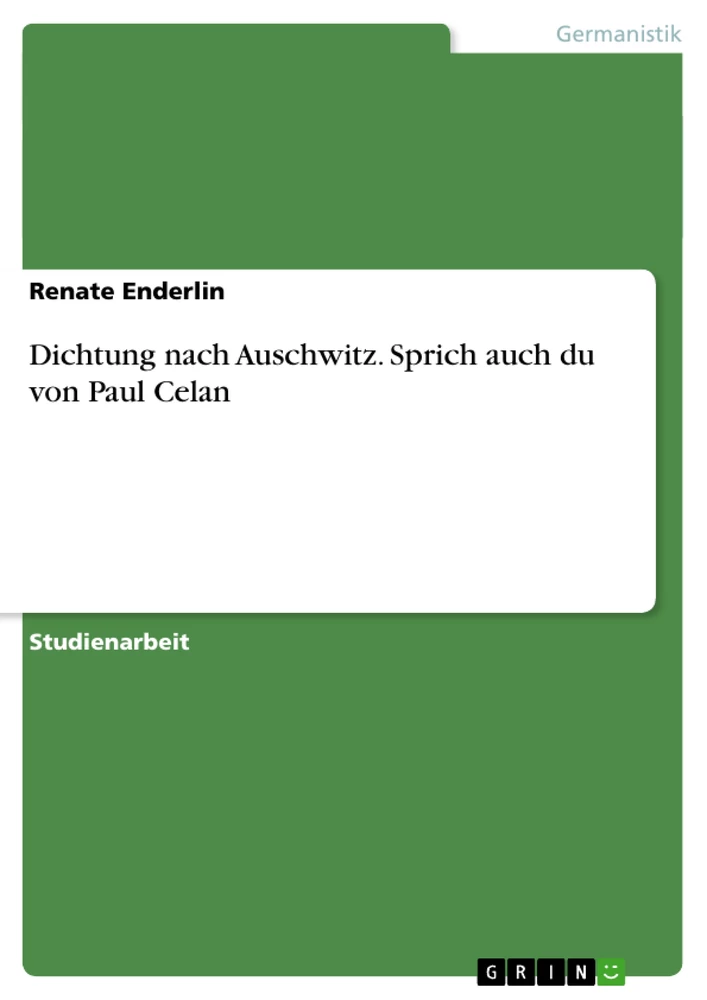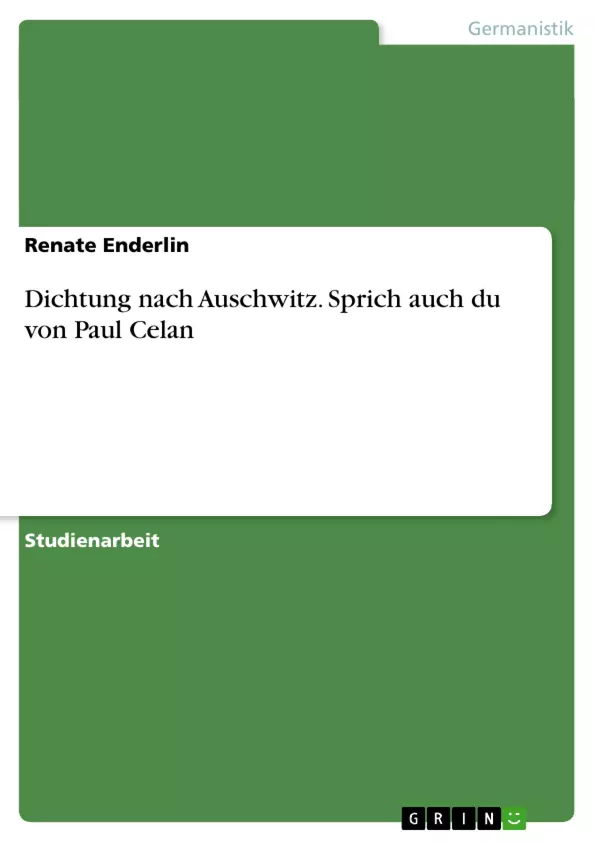In den Gedichten Paul Celans begegnet dem Leser nicht Stille, sondern bewusstes Schweigen. Im Zentrum steht nicht stumme Passivität, sondern Schweigen selber wird zur Aktivität. Doch lässt sich dieses nicht auf eine bestimmte Form des Schweigens reduzieren und auch nur durch seinen jeweiligen Kontext genauer festlegen. Außerdem ließe sich mit Blick auf Celans Gesamtwerk eine Entwicklung im (Begriff des) Schweigen(s) feststellen, deren Näherbestimmung den Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen würde.
Die Differenzierung unterschiedlicher Formen des Schweigens, verdeutlicht den Mitteilungsgehalt dieses Schweigens, das aktive Handlung (z.B. im Gedicht „Engführung“), Richtungsvorgabe (und -vorbild), Ergebnis (eines schmerzvollen Prozesses) oder Veredelung des Redens sein kann. Weitere Formen, wie Schweigen als Ort der Sammlung, als Schlussfolgerung, in Verbindung mit Musik und Natur oder Schweigen im Vergleich zu Stille ließen sich finden.
Meine Arbeit muss sich darauf beschränken, nach jenen Formen des Schweigens zu suchen, die in das Gedicht „Sprich auch du“ verwoben sind: Schweigen und ausgesprochene Identität, Schweigen in Paradoxie und Negation, Schweigen als Totalität, Begründetes und wiederholtes Schweigen, Wahrheit im Schweigen, Schweigen als Aushalten der Ortlosigkeit, Schweigen aufgrund uneinholbarer Bedeutungsvielfalt, Landschaft des Schweigens, Schweigen als Wende, Selbstbegegnung und Begegnung des Anderen im Schweigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Worüber nicht geschwiegen wird nach Auschwitz
- 1. Können und dürfen nach Auschwitz noch Gedichte geschrieben werden? Oder muss man schweigen - im Gedicht?
- 2. Stationen aus Celans Leben sprechen und schweigen
- 3. Worüber gesprochen wird
- 4. Was verbricht – wer schweigt - wer spricht?
- II. Sprich auch Du
- 1. Nicht in Sprache - Ausgesprochene Identität
- 2. Schweigen in Paradoxie und Negation
- 3. Totalität im Schweigen
- 4. Begründetes Schweigen
- 5. Wiederholtes Schweigen
- 6. Wahrheit zeigt sich
- 7. Aushalten der Ortlosigkeit
- 8. Befreiung zur Identität am Grund uneinholbarer Bedeutungsvielfalt
- 9. Landschaft des Schweigens
- 10. Die Wende im Gedicht
- 11. Selbstbegegnung in der Begegnung mit dem Anderen
- 12. Erinnertes Leid im neuerlernten Sprechen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Gedicht „Sprich auch du“ von Paul Celan und untersucht das Thema des Schweigens im Kontext der Literatur des 20. Jahrhunderts. Dabei wird die Frage nach der Möglichkeit des Sprechens und des Dichtens nach Auschwitz thematisiert und Celans Lebensgeschichte sowie sein Werk in Bezug auf diese Problematik beleuchtet.
- Die Unmöglichkeit des Sprechens nach Auschwitz
- Die Bedeutung des Schweigens in Celans Dichtung
- Die Suche nach Identität im Kontext von Sprachlosigkeit und Verlust
- Der Prozess des erneuten Sprechenlernens nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs
- Das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit in der Literatur des 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
I. Worüber nicht geschwiegen wird nach Auschwitz
Das erste Kapitel untersucht die Frage, ob nach Auschwitz noch Gedichte geschrieben werden können oder ob man schweigen muss. Es wird die Problematik der Sprachlosigkeit nach der Katastrophe angesprochen und die Frage gestellt, wie der Schrecken in einem Gedicht thematisiert werden kann, ohne ihn zu ästhetisieren. Der Begriff des Schweigens wird im Zusammenhang mit dem Verschweigen und dem Stummwerden an einer bestimmten Stelle im Gedicht definiert.
II. Sprich auch Du
Dieses Kapitel analysiert Celans Gedicht „Sprich auch du“ im Detail. Es wird die Bedeutung der Sprache und des Schweigens in diesem Gedicht beleuchtet und die Suche nach Identität im Kontext von Verlust und Sprachlosigkeit untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Seminararbeit sind: Schweigen, Sprache, Auschwitz, Identität, Verlust, Trauma, Dichtung, Literatur des 20. Jahrhunderts, Paul Celan. Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Möglichkeit des Sprechens und des Dichtens nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und untersucht, wie die Erfahrung des Schweigens in Celans Gedicht „Sprich auch du“ zum Ausdruck gebracht wird.
- Citation du texte
- Renate Enderlin (Auteur), 2004, Dichtung nach Auschwitz. Sprich auch du von Paul Celan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29374