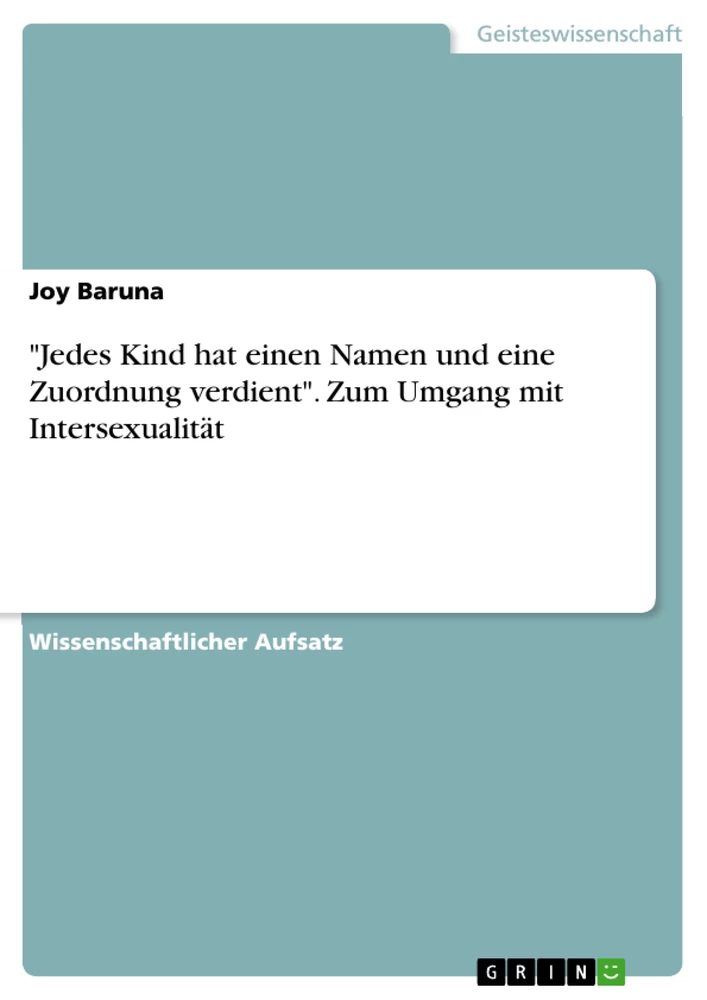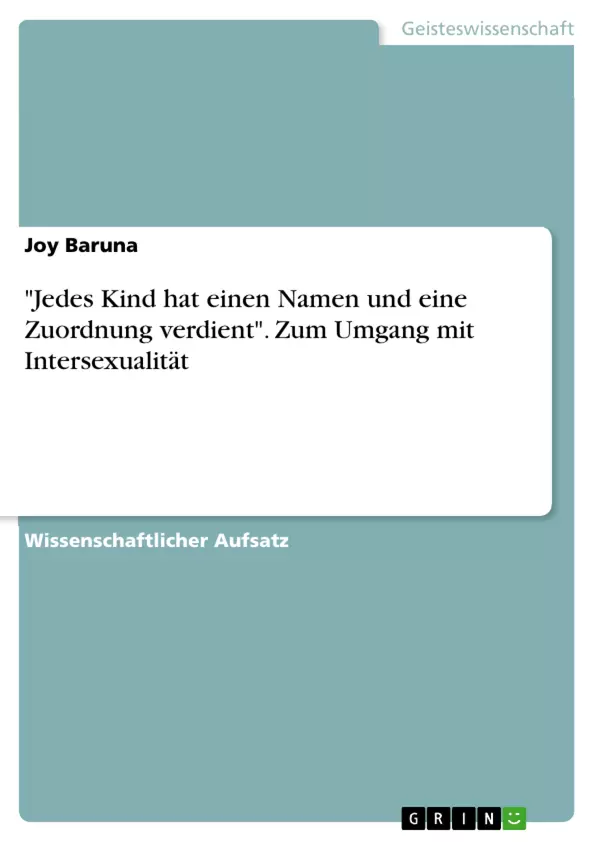Die durch eine Hebamme vorgenommene Geschlechtszuweisung aufgrund der äußeren Geschlechtsorgane „aktualisiert bei Mutter, Vater, Verwandten sogleich eine ganze Kaskade von Erwartungen und Vorstellungen darüber, wie das Kind sei, wie es sich entwickeln und verhalten werde“ (Bosinski, 2000, S.112). Was aber geschieht, wenn sich das Geschlecht des Säuglings nicht eindeutig bestimmen lässt? Prof. Hiort, Kinderarzt und Endokrinologe, plädiert in diesem Fall für eine eindeutige Zuweisung mittels geschlechtsangleichender Operation, denn: „Jedes Kind hat einen Namen und eine Zuordnung verdient“ (Dombrowe, 2010, Minute: 4:04).
Seit dem Inkrafttreten der Änderung des Personenstandgesetzes (PStG) am 1. November 2013, darf der Geschlechtseintrag im Geburtenregister zwar offen bleiben, womit zumindest ein kleiner Schritt in Richtung juristischer Öffnung hinsichtlich unseres zweigeschlechtlichen Systems erkennbar ist, doch nach wie vor stehen Mütter und / oder Väter vor der Frage: Wie gehen wir mit der Intersexualität unseres Kindes um? Sollte eine geschlechtsangleichende Operation stattfinden oder eine weitestgehend geschlechtsneutrale Erziehung angestrebt werden, um das Kind zu einem späteren Zeitpunkt selbst entscheiden zu lassen welchem Geschlecht es sich zugehörig fühlt? Die hier vorliegenden Ausführungen beziehen sich vorrangig auf die konkrete Situation nach der Geburt eines intersexuellen Kindes und den Umgang mit Intersexualität hinsichtlich der Herausforderungen, die sich bezüglich pädagogischer, gesellschaftlicher und entwicklungspsychologischer Aspekte für die Eltern und das Kind/die Kinder ergeben könnten. Es werden Handlungsansätze sowie Entscheidungsformen diskutiert, grundsätzlich im Hinblick auf das Wohl des Kindes.
1) Die Geburt eines Kindes
Die durch eine Hebamme vorgenommene Geschlechtszuweisung aufgrund der äußeren Geschlechtsorgane „aktualisiert bei Mutter, Vater, Verwandten sogleich eine ganze Kaskade von Erwartungen und Vorstellungen darüber, wie das Kind sei, wie es sich entwickeln und verhalten werde“ (Bosinski, 2000, S.112). Was aber geschieht, wenn sich das Geschlecht des Säuglings nicht eindeutig bestimmen lässt? Prof. Hiort, Kinderarzt und Endokrinologe, plädiert in diesem Fall für eine eindeutige Zuweisung mittels geschlechtsangleichender Operation, denn: „Jedes Kind hat einen Namen und eine Zuordnung verdient“ (Dombrowe, 2010, Minute: 4:04).
Seit dem Inkrafttreten der Änderung des Personenstandgesetzes (PStG) am 1. November 2013, darf der Geschlechtseintrag im Geburtenregister zwar offen bleiben, womit zumindest ein kleiner Schritt in Richtung juristischer Öffnung hinsichtlich unseres zweigeschlechtlichen Systems erkennbar ist, doch nach wie vor stehen Mütter und / oder Väter vor der Frage: Wie gehen wir mit der Intersexualität unseres Kindes um? Sollte eine geschlechtsangleichende Operation stattfinden oder eine weitestgehend geschlechtsneutrale Erziehung angestrebt werden, um das Kind zu einem späteren Zeitpunkt selbst entscheiden zu lassen welchem Geschlecht es sich zugehörig fühlt? Die hier vorliegenden Ausführungen beziehen sich vorrangig auf die konkrete Situation nach der Geburt eines intersexuellen Kindes und den Umgang mit Intersexualität hinsichtlich der Herausforderungen, die sich bezüglich pädagogischer, gesellschaftlicher und entwicklungspsychologischer Aspekte für die Eltern und das Kind/die Kinder ergeben könnten. Es werden Handlungsansätze sowie Entscheidungsformen diskutiert, grundsätzlich im Hinblick auf das Wohl des Kindes.
2) Was bedeutet Intersexualität?
Werner-Rosen (2006) beschreibt Intersexualität als „zunächst [...] rein biologisch determiniertes Phänomen“ (S.29). Wobei Intersexualität als „unspezifischer Sammelbegriff“ betrachtet werden sollte (ebd., S.29), welcher eine Homogenität vorgaukle, die in der Realität nicht existiere, denn: „Intersexualität als solche gibt es nicht“ (ebd., S.30). Berücksichtig man nur die klinisch vorstellig werdenden Betroffenen mit nicht eindeutigem Genitale, liegt die Häufigkeit von intersexuellen Personen zwischen 1:3000 (Sax 2002; zitiert nach Beier, Bosinski & Loewit, 2005, S.413) und 1:5000 Lebendgeborenen (Warne, 1998; Melton 2001; zitiert nach Beier et al., 2005, S.413).
Medizinisch betrachtet lassen sich diverse Syndrome und Störungen unterscheiden, beispielsweise das Adrenogenitale Syndrom, Fünf-Alpha-Reduktasemangel oder das Androgen-Insuffizienssyndrom, um nur einige zu nennen, die jeweils eine Form einer somatosexuellen Differenzierungsstörung darstellen. Demnach können pränatale Differenzierungsprozesse bezüglich aller vier bestehenden Ebenen, der chromosomalen, der gonadalen, der gonoduktalen und der genitalen – gestört verlaufen. (Anmerkung der Verfasserin: Diese Ebenen beziehen sich auf die genetische Information, die männlichen oder weiblichen Keimdrüsen, die inneren Geschlechtsorgane sowie die äußeren Geschlechtsorgane). Ist dies der Fall, so ergeben sich Diskrepanzen zwischen den Geschlechtsklassifizierungsebenen und ein Mensch gilt als intersexuell. Eine genaue „Störquelle“ lässt sich häufig nicht eindeutig identifizieren (für diesen Absatz vgl. Werner-Rosen, 2006, S.29-32).
Indifferente Genitale als klassisches und für den Laien offensichtliches Merkmal liegen nicht in jedem Fall vor und einige Betroffene erfahren von ihrer Intersexualität erst in der Pubertät oder im Laufe ihres weiteren Lebens (ebd., S.30). Im vorliegenden Text wird der Fokus auf den äußerlich sichtbaren Formen der Intersexualität, die bereits nach der Geburt festgestellt werden, liegen.
3) John Moneys Theorie zur Entwicklung der Geschlechtsidentität und die Folgen bezüglich des Umgangs mit Intersexualität
John Money stellte laut Beier, Bosinski und Loewit (2005) in den 50er Jahren eine Theorie auf, die wegweisend wurde für den zukünftigen Umgang mit intersexuellen Menschen. Money postulierte, Neugeborene seien bezüglich ihrer Geschlechtsidentität als „neutral“ zu betrachten und einzig die Erziehung sowie die Sozialisation wären entscheidend für die spätere Identifikation als Mädchen oder Junge. Bei intersexuellen Kindern müsste frühzeitig eine Geschlechtszuweisung, verbunden mit einer operativen Korrektur der äußeren Genitale sowie gegebenenfalls Entfernung der sich im Bauchraum befindenden männlichen Hoden vorgenommen werden, um eine konsistente, mit dem Erziehungsgeschlecht übereinstimmende Entwicklung zu gewährleisten. Bei Einsetzen der Pubertät sollten schließlich Sexualhormone verabreicht werden, die ebenfalls der Geschlechtszuweisung entsprechen (S.419).
Zehnder (2010) schreibt, dieses Vorgehen werde seit den 1990er Jahren zunehmend insbesondere von Betroffenen kritisiert. Zehnder zufolge argumentieren Intersexuelle, dass „verstümmelnde Geschlechtszuweisungen bei intersexuellen Kindern nicht legitimierbar seien. Es werde das Recht auf Selbstbestimmung missachtet (…). Intersexualität sei zudem keine Krankheit, sondern eine >Geschlechtsvariante< neben männlich und weiblich und dürfe nicht pathologisiert werden“ (S. 152).
4a) Die Perspektive der Eltern
Laut Werner-Rosen (2014) bestehe unter Experten der Konsens, dass Eltern ebenfalls Betroffene seien und psychologischer beziehungsweise psychosozialer Hilfen bedürfen, um nicht zuletzt zu Gunsten der Entwicklung ihres Kindes, die schwerwiegenden Konflikte bearbeiten zu können (S.12). Ohne Unterstützungsmaßnahmen von „außen“ bestünde die Gefahr, dass die Eltern „auf kurzem Weg“ versuchen ihre Probleme zu lösen „[...] durch Vermeidung, Verdrängung, Delegation an medizinisches und psychologisches Personal und durch Verschiebung ihrer Konflikte auf die (intersexuellen) Körper ihrer Kinder. Das Kind bietet sich als ein sie entlastender Symptomträger an“ (ebd., S.12).
Die Stärkung der Eltern in einer Situation, die von Unsicherheit und Verwirrung bestimmt ist, muss meines Erachtens oberste Priorität darstellen. Denn an diesem Punkt werden Weichen gestellt, die für das Kind von existentieller Bedeutung sind. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Akzeptanz einerseits sowie andererseits das Suchen nach möglichen Schemata zur Kategorisierung von Gegenständen, Sachverhalten und nicht zuletzt Menschen sind charakteristisch für uns, die wir in einer eurozentrischen Gesellschaft aufgewachsen sind und leben. Geschlecht gilt als dichotomes Merkmal mit den Ausprägungen „männlich“ und „weiblich“. Darüber hinaus existieren Abweichungen, die als „nicht normal“ wahrgenommen werden, weil sie nicht der Norm entsprechen (vgl. auch Werner-Rosen, 2014, S.9).
Die bereits erwähnte Änderung des Personenstandgesetzes bietet keine befriedigende Lösung und beweist die eher die offizielle Nicht-Existenz Intersexueller. Werner-Rosen (2014) formuliert es treffend wie folgt: „Die dritte Kategorie neben männlich/weiblich ist jetzt eine Leerstelle: “˽“.“ (S.13). Die Verwirrung betroffener Eltern bezüglich einer fehlenden, so scheinbar selbstverständlichen und normalen Kategorisierungsmöglichkeit, ist meines Erachtens dementsprechend nachvollziehbar und als „angeborenen Schutzreaktion“ zu verstehen. Die Eltern müssen laut Werner-Rosen (2014) „für sich und ihre Kinder grundsätzlich eine Normalität herstellen“, darin bestünde die Herausforderung. „Ziel der Beratung ist es, dass Eltern ihren Begriff von Mädchen oder Jungen entsprechend um das erweitern, was ihnen ihre Kinder „zeigen“, um ihr „So-sein“ annehmen zu können“ (Werner-Rosen, 2006, S.37). Doch was bedeutet das bezogen auf den Alltag und wie funktioniert es in der geschlechtlich binär geordneten eurozentrischen Umwelt? Jedes Elternteil freut sich darauf seinem Kind einen Namen geben zu dürfen und möchte der unangenehmen Frage bezüglich der nicht eindeutigen Genitalien ihres Kindes, die unweigerlich von Erziehern, Bekannten oder sogar von Fremden in der Kita oder während des Strandurlaubs gestellt werden wird, ausweichen (vgl. Hiort, in: Dombrowe, 2010, Minute: 4:25). Eine eindeutige Zuordnung, gegebenenfalls mittels einer Operation, wie Hiort empfiehlt, schafft eine Scheinruhe. Sie kann meiner Meinung nach nur als Ruhe vor dem Sturm bezeichnet werden. Verdrängung als „kurzer Weg“ ist allerdings effizient und funktional. Spätere Konflikte und Fragen, die sich bei dem Kind regen, können allerdings auf diese Weise lediglich innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens verschoben werden, denn die psychosexuelle Entwicklung lässt sich laut Hiort nicht vorhersagen, ebenso wenig, welchem Geschlecht sich das Kind zu einem späteren Zeitpunkt zugehörig fühlen wird (Dombrowe, 2010, Minute 4:35). Dies ist unter anderem anhand von Lebensläufen intersexueller Menschen deutlich geworden, die an Geschlechtsidentitätsstörung litten, sich also ihrem zugewiesenen Geschlecht nicht zugehörig fühlten, wie beispielsweise Christiane Völling (Dombrowe, 2010).
Doch auch wenn die Geschlechtszuweisung aufgeschoben wird kann es zu Problemen kommen. Werner-Rosen (2006) beschreibt, dass Eltern mit ambivalenter Einstellung zur Intersexualität ihres Kindes dazu neigten, ihren Sprössling unentwegt zu beobachten und ihr Verhalten hinsichtlich jungen- oder mädchentypischer Züge einzuordnen (S.37). Es ist zu vermuten, dass diese argwöhnische Haltung nicht förderlich ist für den Aufbau einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind und dass unbewusste Kategorisierungsversuche stattfinden, womit eine freie Entfaltung der Anlagen und Neigungen des Kindes unmöglich wird. Darüber hinaus könnte das Verhalten der Eltern einen Einfluss haben auf die Entstehung späterer psychischer Störungen des/der Betroffenen. Diese Vermutung wird bestätigt durch die Ergebnisse der Studie von Brinkmann, Richter-Appelt und Schützmann (2005), in der die Autoren den Zusammenhang zwischen dem erinnerten, elterlichen Bindungsverhalten und der psychischen Symptombelastung erwachsener Intersexueller untersuchten. Demnach würden intersexuelle Menschen bezüglich ihrer Repräsentanzen bestimmter Aspekte elterlicher Bindung Besonderheiten aufzeigen:
„Befragt nach erinnertem Erziehungsverhalten von Mutter und Vater berichten sie im Vergleich zu Frauen aus der Normalpopulation über ein geringeres Ausmaß an elterlicher Fürsorge. Sowohl Vater als auch Mutter werden von Menschen mit Intersexualität im stärkeren Ausmaß als strafend erlebt als von Frauen ohne Intersexualität“ (Brinkmann, Richter-Appelt & Schützmann, 2005).
Verzerrungen des erinnerten Erziehungsverhaltens in dieser retrospektiven Analyse wären zwar denkbar, doch es ist gut möglich, dass die Unsicherheit der Eltern und ihre Enttäuschung über die Geburt eines „kranken“ Kindes tatsächlich zu einer ablehnenden Haltung geführt hat. In der Beratung wäre es meiner Meinung nach sicher hilfreich und es könnte dazu beitragen, die von Werner-Rosen (2014) geforderte Normalität herzustellen, den Eltern eine andere Perspektive zu eröffnen: Unbestreitbar ist etwas „anders“ an ihrem Kind (sofern „anders definiert werden würde als eine statistisch betrachtet selten vorkommende Ausprägung eines Merkmals in einer bestimmten Population und die Norm gleichbedeutend wäre mit dem häufigsten Auftreten einer Ausprägung). Doch das rechtfertigt keine Pathologisierung und keine Zuschreibung als „krank“.
Die Eltern der intersexuellen Inge (Dombrowe, 2010) versuchen ihrem Kind gezielt das Bewusstsein für diese Andersartigkeit mit auf den Weg zu geben. Gleichzeitig ziehen sie ihr Kind so weit möglich geschlechtsneutral auf bis Inge sich selbst entscheiden kann, wie sie fortan leben möchte. So hat Inge beispielsweise die freie Wahl bezüglich Badehose oder Bikini. Ziel ist die Stärkung von Inges Selbstbewusstsein mittels der Botschaft, dass die Eltern ihr Kind als „normal empfinden“. Der aufgeklärte, offene Umgang von Inges Eltern mit der Thematik könnte einen grundsätzlichen Wandel ankündigen im Umgang mit Intersexualität oder aber es handelt sich um einen Einzelfall, denn Beier et al. (2005) geben zu bedenken, dass „Eltern in europäisch geprägten Kulturen es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht akzeptieren werden, ihr Kind solange „im Zwischenraum der Geschlechter“ aufwachsen zu lassen, bis diese sich selbst für oder gegen eine Zuordnung (und entsprechende medizinische Maßnahmen) entscheiden könnten“ (S.434)
Allerdings ergeben sich in Inges Fall Probleme. Bei dieser Form von Intersexualität, der Gonadendysgenesie, kann es in der Pubertät zu einer „Vermännlichung“ kommen, außerdem bestünde ein erhöhtes Krebsrisiko (Dombrowe, Min. 45:50). Die Eltern hoffen daher, dass Inge sich vor Einsetzen der Pubertät bereits entscheidet. Dieses Vorgehen entlastet die Eltern, da die Familie ihre Form von Normalität gefunden hat und weder Tatsachen vor dem Kind verheimlicht werden, noch die Eltern gegebenenfalls später den Vorwurf fürchten müssen über Inges Kopf hinweg entschieden zu haben, wie ihr Kind zu leben hat.
Andererseits muss Inge eine weitreichende Entscheidung treffen und bereits sehr früh einschätzen, wie ihr weiteres Leben verlaufen sollte. Eine große Herausforderung und gleichzeitig eine große Last.
4b) Die Perspektive des intersexuellen Kindes
Die Wahlfreiheit, die gekoppelt ist an die Forderung einer wie auch immer gearteten Entscheidung, könnte ein Kind enorm unter Druck setzen und verunsichern. Bosinski (2005) vergleicht Geschlechtsrollenvorstellungen, die im Laufe der Entwicklung aktiv vom Kind durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt angeeignet werden, mit einem „Kompass“. Sie würden wie ein „inneres Ordnungsystem“ wirken in einer „zunächst ungeordneten, chaotischen, fremden Welt“ (S.113). Bosinski (2005) erläutert weiterhin, dass die Voraussetzung zur Aneignung von Geschlechtsrollenvorstellungen, die Kenntnis der eigenen geschlechtlichen Zugehörigkeit darstellt. Inges Anders-Sein birgt grundsätzlich das Risiko einer Halt- und Irritierungslosigkeit, die, wie ich annehme, nur teilweise durch die Eltern und ein verständnisloses Umfeld ausgeglichen werden kann. Wie Zehnder (2010) schreibt, wird deutlich, dass „die Medizin gesellschaftliche und psychische Aspekte von Geschlecht mitdenkt, ja ihr diese zum Teil sogar fundamental wichtig sind (wichtiger nämlich als somatische Aspekte), wenn es um die Begründungen der Operationen intersexueller Kinder geht“ (S.143). Der Blick in die Zukunft, den Mediziner somit wagen, ist, wie bereits erwähnt, mit Gefahren verbunden. Dies wird umso deutlicher bei Beachtung der absoluten Einzigartigkeit jedes Menschen und der unendlichen Ausprägungsmöglichkeiten von Geschlechtsidentitäten. Zehnder (2010) gibt zu bedenken, dass „eigentlich jedem Individuum, bezogen auf seine Geschlechtsidentität, ein Expertentum zugestanden wird, wenn man davon ausgeht, dass es sich per definitionem um ein individuelles >Gefühl< handelt“ (S.146).
Solange allerdings diese Vielfalt nicht anerkannt und der Dualismus von Geschlecht gesellschaftlich gleichgesetzt wird mit Bewertungen wie „richtig“ oder „falsch“, besteht die Möglichkeit, dass Inge sich im Erwachsenenalter den Worten des intersexuellen Lupo anschließt:
„Man fühlt sich nicht im falschen Körper, es sei denn, man hatte das Pech und wurde einem Geschlecht zwangszugewiesen. Ich stelle mir sehr oft diese Frage: >Warum und wieso kann es nicht einfach akzeptiert werden dass es ein >drittes Geschlecht< gibt? < Es ist die unbeschreibliche Ohnmacht die einen überfällt wenn man einmal mehr als >NICHT EXISTENT< bezeichnet wird“ (zitiert nach Zehnder, 2010, S.301).
4) Fazit
Sowohl eindeutige Zuordnungen nach der Geburt, als auch ein Aufwachsen eines intersexuellen Kindes ohne Zuordnung bergen Risiken. Doch Chancen ergeben sich meines Erachtens ausschließlich, wenn letzteres der Fall ist und ein intersexuelles Kind die Möglichkeit erhält, sich zu entscheiden, wie es leben möchte. Belastungen und Unsicherheiten können wahrscheinlich nicht vermieden werden. Sowohl Eltern als auch das Kind selbst werden wahrscheinlich in unangenehme Situationen geraten. Ein Lösungsansatz könnte meines Erachtens darin bestehen, ein Kind, wie es bei Inge der Fall ist, so gut es geht in seinem Anders-Sein zu begleiten und zu unterstützen. Dieser Rückhalt und eine sichere Eltern-Kind-Bindung kann zwar keinen eindeutigen „Namen“ und keine „Zuordnung“ schaffen, doch zumindest kann er die Basis sein von der ausgehend das Kind sich sozusagen „neu erfinden“ kann. Es bedarf in jedem Fall gesellschaftlicher Aufklärung bezüglich Intersexualität, um Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Daran anschließend wäre es von größter Bedeutung die juristischen Lücken zu füllen, um Intersexuellen zumindest die bürokratische Last abzunehmen und ihnen Raum zu geben. Die Kategorien „männlich“ und „weiblich“ werden nicht ihre Gültigkeit verlieren und meiner Meinung nach ist es zweitrangig und hier nicht das Hauptanliegen der Ausführungen, ob es sich um zwei Pole entlang eines Kontinuums oder um eine dichotome Ausprägung handelt beziehungsweise handeln sollte. Von zentraler Bedeutung ist einerseits, dass Eltern fachlich kompetent und durch empathische Ärzte und/ oder Psychotherapeuten unterstützt werden sollten und andererseits, dass Anders-Sein nicht automatisch negativ bewertet werden muss. Anders-Sein kann ebenso für „besonders“ stehen und: Anders kann auch als Kategorie gelten, die Sicherheit spendet. Hier fände demnach eine Zuordnung statt, jedoch ohne Operationen, ohne Zwang. Kategorien beziehungsweise „Zuordnungen“ wird es wohl geben und auch geben müssen, solange es Menschen gibt. Entscheidend ist, wie flexibel wir mit ihnen umgehen und ob es uns gelingt vorurteilsfrei und mutig anzunehmen, was uns begegnet. Eltern intersexueller Kinder mögen es teilweise schwerer haben als das Kind selbst. Als Erwachsene sind sie bereits ein bestehendes Normsystem gewohnt und müssen erst lernen die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Wichtiger als Namen und Zuordnungen, die im ungünstigen Fall zu Oberflächlichkeit und Etikettierungen führen können, sind für ein Kind meiner Meinung nach grundsätzlich Beziehungs- und Bindungsqualität.
Literatur- und Quellenverzeichnis
Beier, K.M., Bosinski, H.A.G., Loewit, K. (2005). Sexualmedizin.2. Auflage. München: Elsevier Urban&Fischer.
Bosinski, H. A. G. (2000). Determinanten der Geschlechtsidentität. Neue Befunde zu einem alten Streit. Sexuologie 7(2/3), 96-140.
Brinkmann L., Richter-Appelt, H. & Schützmann, K. (2005). Elterliche Bindung in der Kindheit und psychische Symptombelastung in einer Stichprobe von Erwachsenen mit Intersexualität. Zugriff am: 23.12.2014. Verfügbar unter: http://www.intersex-forschung.de/bindung.pdf
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 23. (2013). Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften. (Personenstandsrechts-Änderungsgesetz – PStRÄndG). [elektronische Version] Zugriff am: 23.12.2014. Verfügbar unter: http://www.personenstandsrecht.de/SharedDocs/Downloads/PERS/Themen/Rechtsquellen/per%C3%A4nd_g.pdf?__blob=publicationFile
Dombrowe, B.J. (2010). Tabu Intersexualität – Menschen zwischen den Geschlechtern. (Dokumentation). Straßburg: arte. Zugriff am: 23.12.2014. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=rNg8NhVwb5s
Werner-Rosen, K. (2006). Was ist Intersexualität? In Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.), Zusammen leben in Berlin. Männlich – weiblich – menschlich? Trans- und Intergeschlechtlichkeit. (S. 29-41). Berlin: Veröffentlichungen des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen.
Werner-Rosen, K. (2014). Der subjektive Bedarf an psychologischer Beratung / Psychotherapie von Eltern von Kindern mit DSD / Intersexualität. Eine Auswertung der Klinischen Evaluationsstudie von Netzwerk DSD / Intersexualität. Unveröffentlichte Dissertation, Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin.
Häufig gestellte Fragen
1. Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text befasst sich mit Intersexualität, insbesondere mit den Herausforderungen, die sich nach der Geburt eines intersexuellen Kindes ergeben. Er untersucht die pädagogischen, gesellschaftlichen und entwicklungspsychologischen Aspekte für Eltern und Kind, diskutiert Handlungsansätze und Entscheidungsformen, wobei das Wohl des Kindes im Vordergrund steht.
2. Wie definiert der Text Intersexualität?
Intersexualität wird als ein biologisch determiniertes Phänomen beschrieben, das jedoch einen unspezifischen Sammelbegriff darstellt. Es wird betont, dass Intersexualität keine homogene Kategorie ist und die Häufigkeit intersexueller Personen variiert, wobei die Rede von 1:3000 bis 1:5000 Lebendgeborenen ist.
3. Welche medizinischen Aspekte der Intersexualität werden erwähnt?
Der Text erwähnt verschiedene Syndrome und Störungen wie das Adrenogenitale Syndrom, Fünf-Alpha-Reduktasemangel und das Androgen-Insuffizienssyndrom. Diese stellen Formen somatosexueller Differenzierungsstörungen dar, bei denen pränatale Differenzierungsprozesse auf chromosomaler, gonadaler, gonoduktaler und genitaler Ebene gestört verlaufen können.
4. Welche Kritik wird an John Moneys Theorie zur Geschlechtsidentität geäußert?
John Moneys Theorie, dass Neugeborene bezüglich ihrer Geschlechtsidentität neutral seien und Erziehung sowie Sozialisation entscheidend für die spätere Identifikation seien, wird kritisiert. Insbesondere wird die frühe Geschlechtszuweisung mit operativer Korrektur bei intersexuellen Kindern als "verstümmelnd" und als Missachtung des Rechts auf Selbstbestimmung kritisiert.
5. Welche Perspektive haben Eltern von intersexuellen Kindern?
Experten sind sich einig, dass Eltern ebenfalls Betroffene sind und psychologische Hilfe benötigen. Ohne Unterstützung besteht die Gefahr, dass Eltern ihre Probleme durch Vermeidungsstrategien lösen oder ihre Konflikte auf die Kinder verschieben. Die Stärkung der Eltern ist von höchster Priorität, um eine positive Entwicklung des Kindes zu fördern.
6. Welche Probleme ergeben sich bei der Geschlechtszuweisung oder -verschiebung aus Sicht des Kindes?
Die Wahlfreiheit, gekoppelt mit der Forderung einer Entscheidung, kann Kinder unter Druck setzen und verunsichern. Die Kenntnis der eigenen geschlechtlichen Zugehörigkeit ist Voraussetzung zur Aneignung von Geschlechtsrollenvorstellungen. Inges Anders-Sein birgt das Risiko einer Halt- und Irritierungslosigkeit, die nur teilweise durch die Eltern ausgeglichen werden kann.
7. Welche juristische Situation wird im Text angesprochen?
Der Text erwähnt die Änderung des Personenstandgesetzes (PStG) vom 1. November 2013, die es erlaubt, den Geschlechtseintrag im Geburtenregister offen zu lassen. Dies wird als kleiner Schritt in Richtung juristischer Öffnung des zweigeschlechtlichen Systems gesehen, jedoch wird kritisiert, dass die dritte Kategorie neben männlich/weiblich eine Leerstelle ist.
8. Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Sowohl eindeutige Zuordnungen nach der Geburt als auch ein Aufwachsen ohne Zuordnung bergen Risiken. Die Chance für das Kind besteht darin, die Möglichkeit zu erhalten, sich selbst zu entscheiden, wie es leben möchte. Gesellschaftliche Aufklärung, juristische Anpassungen und eine vorurteilsfreie Akzeptanz von Andersartigkeit sind notwendig, um intersexuellen Menschen Raum zu geben und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
- Quote paper
- Joy Baruna (Author), 2015, "Jedes Kind hat einen Namen und eine Zuordnung verdient". Zum Umgang mit Intersexualität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294003