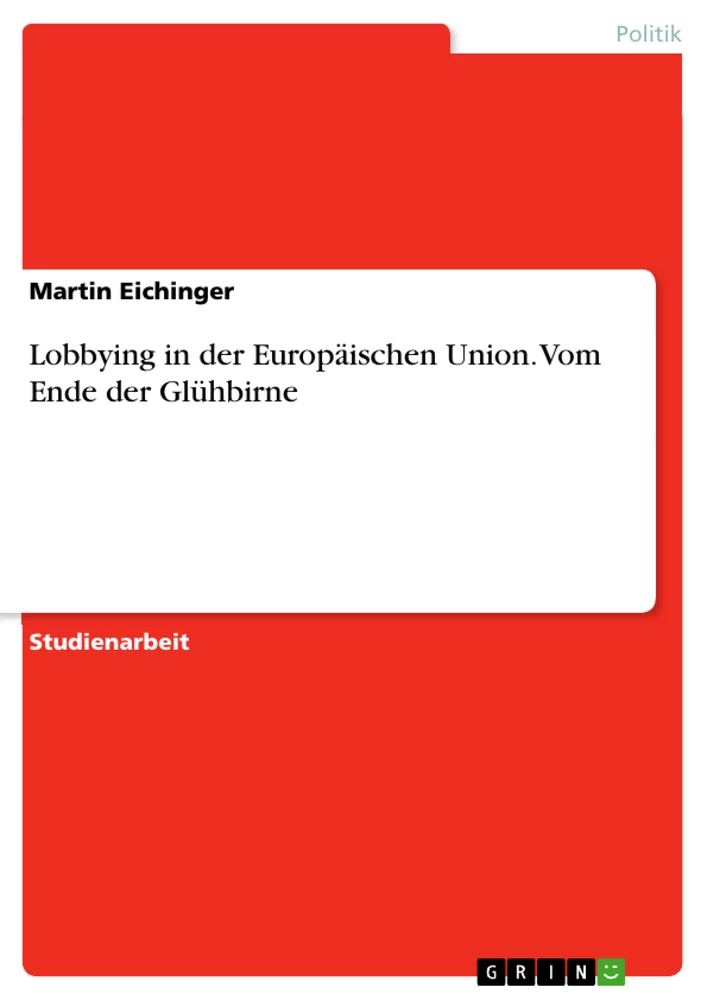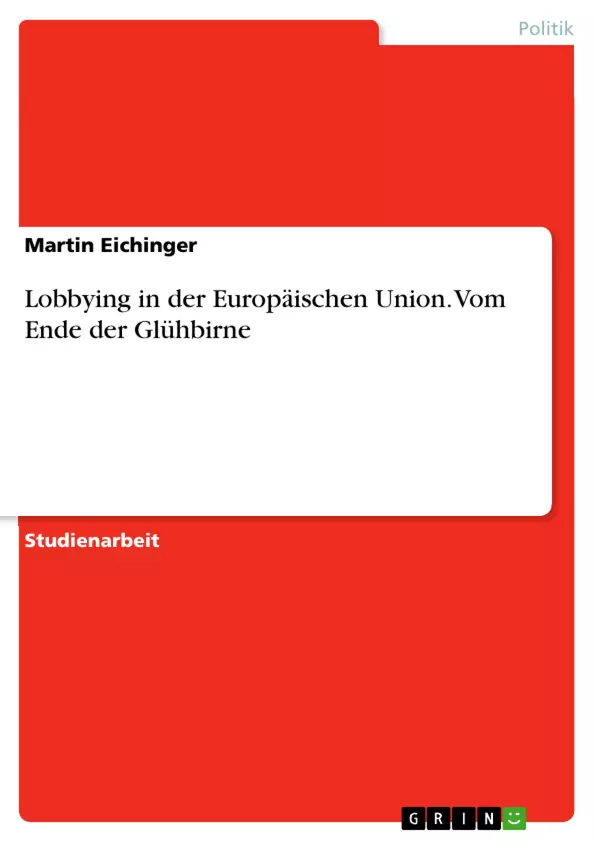Mit der Verordnung Nr. 244 einigten sich die Vertreter der Europäischen Union im Dezember 2008 darauf, die inzwischen in die Jahre gekommene Glühbirne vom Markt zu nehmen und durch neue und deutlich energieeffizientere Varianten zu ersetzen. Offiziell aus Verbrauchsgründen und dem Umweltschutz geschuldet.
Doch wurden schnell Meinungen laut, die Sinn und Zweckmäßigkeit des Unterfangens in Frage stellten. Viele Stimmen aus der Gesellschaft vertraten die Ansicht, dass weder Gemeinwohl noch die Natur im Vordergrund stünden - vielmehr hätten sich andere, namentlich wirtschaftliche Interessen durchgesetzt.
Wie viel Wahrheit steckt aber tatsächlich hinter solchen Behauptungen ?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Lobbying in der Europäischen Union
- Lobbying "Access Goods"
- Lobbying in der EU
- Normative Grundlage
- Kritik
- Transparenzregister
- Teil II: Vom Ende der Glühbirne
- Einleitung
- Die Glülampenverordnung
- Der Gesetzgebungsprozess im Hinblick auf Lobbying
- Einschränkungen
- Komitologieverfahren
- Folgenabschätzung
- Konsultationsforum
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Lobbying in der Europäischen Union und untersucht dies anhand des Beispiels des Glühbirnenverbots. Ziel ist es, die Rolle des Lobbying im Gesetzgebungsprozess zu beleuchten und zu analysieren, ob und inwiefern Lobbyaktivität im Fall der Glühlampenverordnung erkennbar ist.
- Definition und Bedeutung des Lobbying
- Lobbying in der EU: Normative Grundlagen, Kritik und Transparenz
- Der Gesetzgebungsprozess im Hinblick auf Lobbying
- Die Glühlampenverordnung als Fallbeispiel
- Die Rolle von "Access Goods" im Lobbyingprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Lobbying ein und erläutert den Ursprung des Begriffs sowie die Bedeutung des Lobbyismus in der heutigen Zeit. Sie stellt die Problematik des Lobbying in der EU dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Lobbying in der Europäischen Union. Er beleuchtet die normative Grundlage des Lobbying in der EU, die Kritik an diesem und das Transparenzregister als Antwort auf diese Kritik. Der Abschnitt "Access Goods" erklärt, warum eine Interaktion zwischen Politik und Wirtschaft überhaupt besteht und wie diese funktioniert.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Beispiel des Glühbirnenverbots. Er beschreibt die Glülampenverordnung und analysiert den Gesetzgebungsprozess im Hinblick auf Lobbyingaktivität. Dabei werden die Einschränkungen, das Komitologieverfahren, die Folgenabschätzung und das Konsultationsforum im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Lobbying, Europäische Union, Gesetzgebungsprozess, Glühbirnenverbot, Transparenz, "Access Goods", Interessenvertretung, Politik und Wirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert Lobbying in der Europäischen Union?
Lobbying in der EU ist der Versuch von Interessengruppen, Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess zu nehmen. Dies geschieht oft durch die Bereitstellung von Fachwissen, sogenannten „Access Goods“.
Was sind „Access Goods“?
Es handelt sich um Informationen, technisches Expertenwissen oder Einschätzungen zur politischen Umsetzbarkeit, die Lobbyisten politischen Entscheidungsträgern im Austausch für Zugang anbieten.
Warum wurde die Glühbirne in der EU verboten?
Offiziell wurde die Glühbirne durch die Verordnung Nr. 244 aus Gründen der Energieeffizienz und des Umweltschutzes vom Markt genommen.
Gab es Kritik am Lobbyeinfluss beim Glühbirnenverbot?
Ja, viele Kritiker vermuteten, dass wirtschaftliche Interessen der Industrie schwerer wogen als das Gemeinwohl oder der tatsächliche ökologische Nutzen der Ersatzprodukte.
Was ist das EU-Transparenzregister?
Das Transparenzregister ist ein Instrument der EU, in dem sich Organisationen eintragen müssen, die Einfluss auf die europäische Politik nehmen wollen, um die Lobbyarbeit sichtbarer zu machen.
Was ist das Komitologieverfahren?
Es ist ein Verfahren, bei dem die EU-Kommission bei der Umsetzung von Rechtsakten von Ausschüssen aus Vertretern der Mitgliedstaaten kontrolliert wird. Hier findet oft intensives Lobbying statt.
- Arbeit zitieren
- Martin Eichinger (Autor:in), 2015, Lobbying in der Europäischen Union. Vom Ende der Glühbirne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294028