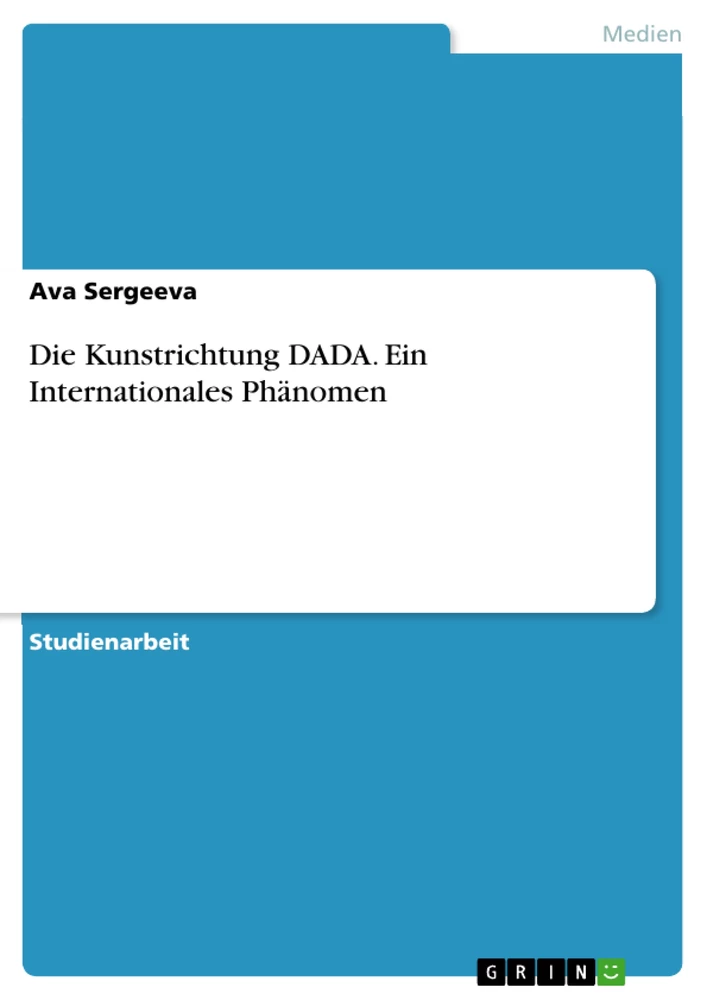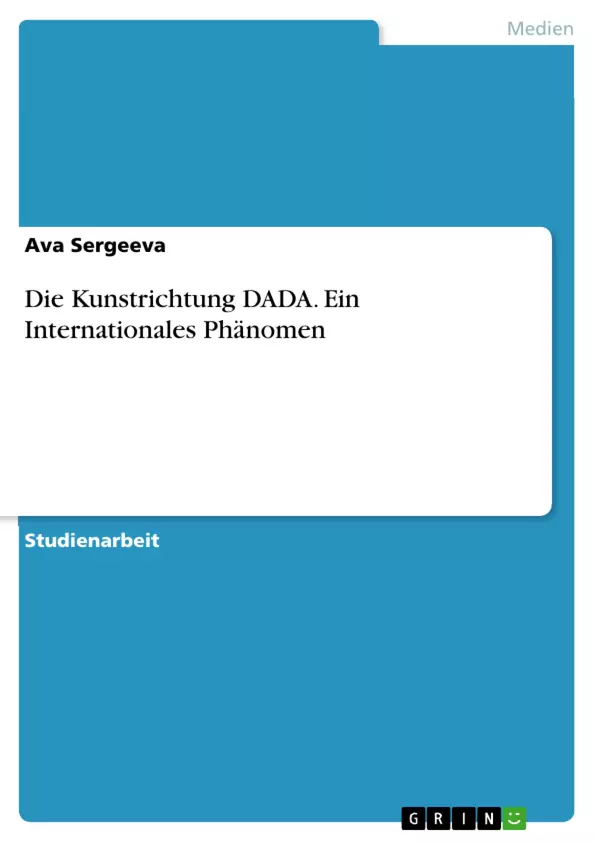Fragt man heute auf der Straße einen beliebigen Passanten, was Dadaismus sei, ist es wohl kaum zu erwarten, sofort eine korrekte Antwort zu bekommen. Einige werden sich Gedanken machen, die Meisten den Kopf schütteln und weggehen, die Wenigsten wohl werden sich erinnern und von einer Bewegung erzählen, die sich einst fast in der ganzen Welt verbreitet hatte wie ein Lauffeuer.
DADA nannte sich eine agitatorische, vielleicht gar als revolutionär zu bezeichnende Tendenz der linksorientierten Intelligenz, grob einzubetten in den unruhigen Zeitraum der 1915er - 1920er Jahre. Und so mühsam es scheint, für DADA eine allumfassende Definition zu liefern, soll das in den nächsten Zeilen versucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Dadaismus in seinen Ursprüngen.
- Die Zentren des Dadaismus
- DADA in der Schweiz
- DADA in Deutschland
- DADA in Frankreich
- DADA in den USA
- Rückblick: DADA heute?
- Bilderanhang
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Dadaismus als internationalem Phänomen und untersucht die Verbreitung dieser Bewegung in verschiedenen Ländern. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Dadaismus in seinen Zentren zu beleuchten und die Gründe für seine internationale Ausbreitung zu analysieren.
- Die Ursprünge des Dadaismus in Zürich
- Die Rolle der politischen und kulturellen Umstände in den verschiedenen Ländern
- Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Dada-Bewegungen in verschiedenen Ländern
- Die Bedeutung des Protests und der Rebellion gegen bestehende Normen
- Die Auswirkungen des Dadaismus auf die Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ursprünge des Dadaismus in Zürich, mit Fokus auf die Eröffnung des Cabaret Voltaire und die wichtigsten Akteure der Bewegung. Es werden die politischen und kulturellen Umstände in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs beleuchtet, die zur Entstehung des Dadaismus beitrugen.
Das zweite Kapitel widmet sich den Zentren des Dadaismus in verschiedenen Ländern, darunter die Schweiz, Deutschland, Frankreich und die USA. Es werden die wichtigsten Ereignisse und Akteure in jeder Region vorgestellt und die Gründe für die Verbreitung des Dadaismus in diesen Ländern analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Dadaismus, die internationale Ausbreitung, die Zentren des Dadaismus, die politischen und kulturellen Umstände, die Rolle des Protests und der Rebellion, die Bedeutung des Ersten Weltkriegs, die Auswirkungen auf Kunst und Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Ursprung der Dada-Bewegung?
Dada entstand während des Ersten Weltkriegs (ca. 1916) in Zürich, insbesondere durch die Gründung des Cabaret Voltaire.
In welchen Ländern war Dadaismus besonders verbreitet?
Die wichtigsten Zentren lagen in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und den USA.
Wogegen protestierten die Dadaisten?
Sie protestierten gegen die bestehenden gesellschaftlichen Normen, die bürgerliche Kunstwelt und die Sinnlosigkeit des Krieges.
Welche Bedeutung hat Dada für die heutige Kunst?
Dada legte den Grundstein für viele moderne Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts und brach radikal mit traditionellen Ästhetikvorstellungen.
War Dada eine rein künstlerische Bewegung?
Nein, Dada war auch eine agitatorische und politisch linksorientierte Bewegung der Intelligenz, die gesellschaftliche Umbrüche anstrebte.
- Quote paper
- Ava Sergeeva (Author), 2009, Die Kunstrichtung DADA. Ein Internationales Phänomen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294066