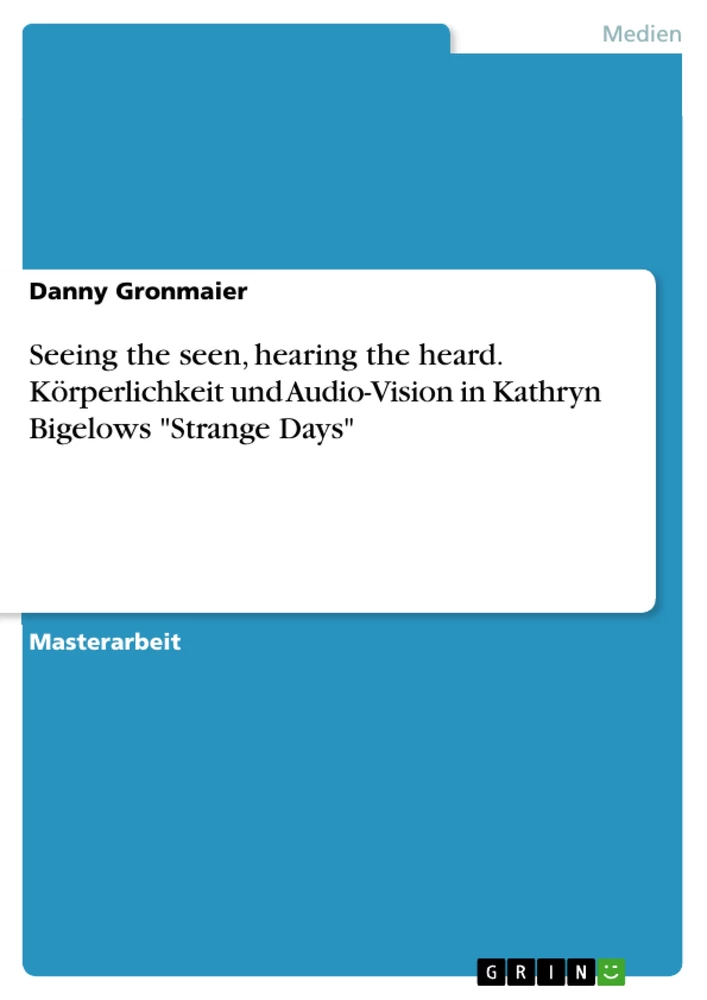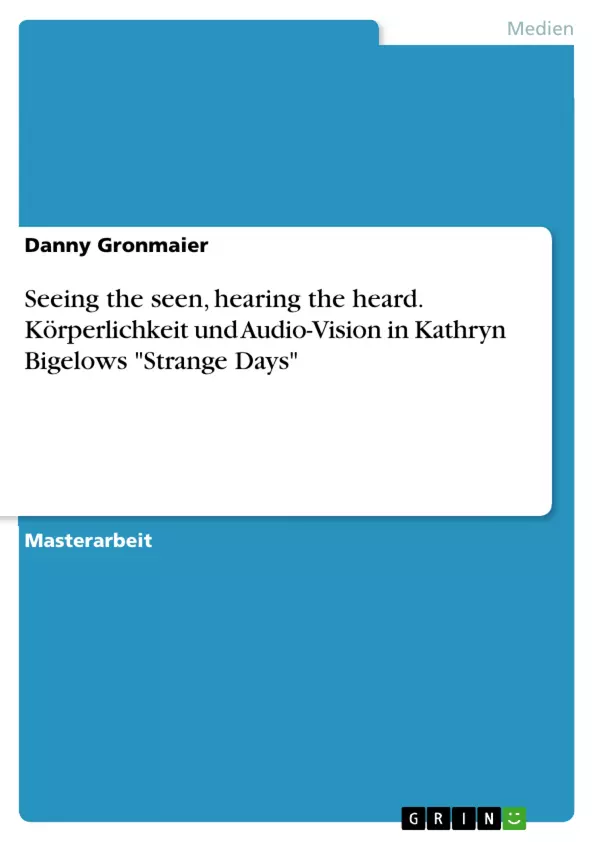Der Film Strange Days von Kathryn Bigelow setzt eine der zentralen Aussagen von Vivian Sobchack emblematisch ins eigene Bild: In einer dystopischen Diegese kurz vor der Jahrtausendwende ermöglicht eine Technik namens SQUID, individuelle Erfahrung (scheinbar) synästhetisch aufzunehmen, auf Discs zu speichern und erneut und intersubjektiv abzuspielen. Protagonisten ‚erleben‘ – sehen, hören, fühlen – was eine andere Figur erlebt hat. Mit der Thematisierung eines solchen zukunftstechnologischen Mediums, welches durch retroaktive Simulation eine ganzheitliche, körperliche Erfahrung ermöglicht, die wiederum ihren eigenen medialisierten Status selbst zu tilgen scheint, berührt der Film STRANGE DAYS bekannte und breit bearbeitete Diskurse seiner eigenen Form, vor allem jene der kinematographischen Illusion und Fiktion.
Die Tatsache, dass der Film dieses maximal somatische Erleben in filmische Bilder zu übersetzen versucht, sorgt für eine verdoppelte Rezeptionssituation in der Diegese und einer Film-im-Film-Konstellation: Äußerst pointierte point of view-Sequenzen durchziehen den gesamten Film und setzen das SQUID-Erleben der Protagonisten ins Bild. Gleichzeitig scheinen diese virtuos und intensiv gestalteten Szenen subjektiver Wahrnehmungsbilder aber auch eindeutig auf den tatsächlichen Zuschauer des Films abzuzielen und diesen in die Struktur verdoppelter Wahrnehmungsebenen einweben zu wollen.
Das thematisch verhandelte seeing-seen schreibt sich in der tatsächlichen rezeptionstheoretischen Situation (außerhalb der Leinwand) fort. Diesen Vorgang gilt es genauer in den Blick zu nehmen. Dafür sollen im ersten Teil dieser Arbeit die Überlegungen zu einer filmtheoretischen Körpertheorie von Vivian Sobchack und Christiane Voss, die in STRANGE DAYS bereits auf Handlungsebene eine äußerst anschauliche Repräsentation erfahren, rekapituliert werden.
Im Vergleich zur semiotischen und psychoanalytischen Filmtheorie werten diese die Rolle der Körperlichkeit beim Filmerleben deutlich auf und proklamieren eine konkrete Verbindung von Zuschauerkörper und Film, ohne diese jedoch wirklich anschaulich zu machen. Erstes Ziel dieser Arbeit ist es daher, diese Ins-Bild-Setzung für den speziellen Fall STRANGE DAYS analytisch zu konkretisieren. Dies soll im Analyseteil mit einer dichten Beschreibung der Inszenierungsstrategien einerseits und der dadurch im Zuschauer ausgelösten affektiven Reaktionen und modulierten Emotionen andererseits erreicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Körperlichkeit im Kino
- Rückbezug 1: Die leibgebundene Wahrnehmung (Merleau-Ponty)
- Rückbezug 2: Der Körper des Films (Sobchack)
- Der Illusionsbegriff und die Körperlichkeit der Immersion bei Voss
- Der Kinozuschauer als Resonanzkörper
- Die filmanalytische Methode: Audio-Vision und Zuschauergefühl
- Added Value
- Sound und Raum
- Temporalisierung und Modi des Hörens
- Das Zusammenspiel von Ton und Bild in der Zeit
- STRANGE DAYS – Eine audiovisuelle Analyse
- Eine Thriller-Dystopie mit verdoppelter Erlebnis-Struktur
- Der Beginn des Films und die (brüchige) Verflechtung von Film- und Zuschauerkörper
- Alternation und das Affektbild des maximal erfahrenden Gesichts
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Filmographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert den Film STRANGE DAYS (Kathryn Bigelow, 1995) im Hinblick auf die Rolle der Körperlichkeit im Kino und die Interaktion von Audio-Vision in der Konstruktion von Zuschauergefühl. Die Arbeit untersucht, wie der Film durch die Darstellung einer zukunftstechnologischen Simulation von Erfahrung, die den Zuschauer in die Diegese einbezieht, die Grenzen zwischen Film und Realität verschwimmen lässt.
- Körperlichkeit im Kino und die Rolle des Zuschauers
- Audio-Vision und die Konstruktion von Zuschauergefühl
- Die Interaktion von Ton und Bild in der Zeit
- Die Darstellung von Erfahrung und die Grenzen zwischen Film und Realität
- Die Affektpoetik des Films und die Verhandlung eines dystopischen und medienkonsumkritischen Standpunkts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Der Film STRANGE DAYS thematisiert die Verflechtung von Film- und Zuschauerkörper durch die Darstellung einer zukunftstechnologischen Simulation von Erfahrung, die den Zuschauer in die Diegese einbezieht. Die Arbeit untersucht, wie der Film durch die Darstellung einer zukunftstechnologischen Simulation von Erfahrung, die den Zuschauer in die Diegese einbezieht, die Grenzen zwischen Film und Realität verschwimmen lässt.
Das Kapitel "Körperlichkeit im Kino" rekapituliert die Überlegungen zu einer filmtheoretischen Körpertheorie von Vivian Sobchack und Christiane Voss, die in STRANGE DAYS bereits auf Handlungsebene eine äußerst anschauliche Repräsentation erfahren. Im Vergleich zur semiotischen und psychoanalytischen Filmtheorie werten diese die Rolle der Körperlichkeit beim Filmerleben deutlich auf und proklamieren eine konkrete Verbindung von Zuschauerkörper und Film, ohne diese jedoch wirklich anschaulich zu machen. Erstes Ziel dieser Arbeit ist es daher, diese Ins-Bild-Setzung für den speziellen Fall STRANGE DAYS analytisch zu konkretisieren.
Das Kapitel "Die filmanalytische Methode: Audio-Vision und Zuschauergefühl" stellt das Konzept der Audio-Vision von Michel Chion vor. Ausgehend von dem für Chion zentralen Begriff des added value soll dessen äußerst zeichentheoretische und kognitive Argumentation hinsichtlich der angestrebten, immer in Bezug zu einem Zuschauergefühl stehenden analytischen Vorgehensweise entsprechend kritisch hinterfragt und methodisch geformt werden.
Das Kapitel "STRANGE DAYS – Eine audiovisuelle Analyse" untersucht die Inszenierung der pov-Sequenzen im Sinne einer Interaktion von Ton und Bild und als Strategie der Erzeugung und Modulierung eines Zuschauergefühls. Neben dem auch im Hinblick auf STRANGE DAYS wichtigen Einfluss des Sounds auf das Wahrnehmen von Räumlichkeit (etwa bei der Frage nach einem tonalen Äquivalent zum point of view) soll es dabei vor allem um das Erkennen und Beschreiben von in der Zeit ablaufenden Ausdrucksbewegungen gehen, die sich im Zusammenspiel unterschiedlicher Gestaltungsebenen manifestieren und sich auf die Gemütsbewegung des Zuschauers und dessen emotionalen Zustand auswirken.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Körperlichkeit, Audio-Vision, Zuschauergefühl, Filmtheorie, STRANGE DAYS, Kathryn Bigelow, Dystopie, Simulation, Erfahrung, Realität, Medienkritik, Affektpoetik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kathryn Bigelows Film „Strange Days“?
Der Film handelt von einer dystopischen Zukunft, in der Menschen durch die SQUID-Technologie die Sinneserfahrungen anderer (Sehen, Hören, Fühlen) wie eine eigene Realität erleben können.
Welche Rolle spielt die Körperlichkeit in der Filmtheorie von Vivian Sobchack?
Sobchack betont, dass Filmerleben nicht nur kognitiv, sondern eine somatische (körperliche) Erfahrung ist, bei der der Zuschauer mit seinem Körper auf die Bilder und Töne reagiert.
Was bedeutet der Begriff „Audio-Vision“ nach Michel Chion?
Audio-Vision beschreibt das Zusammenspiel von Ton und Bild, bei dem der Ton dem Bild einen „Added Value“ (Mehrwert) verleiht und die Wahrnehmung von Raum und Zeit maßgeblich beeinflusst.
Wie nutzt „Strange Days“ Point-of-View (POV) Sequenzen?
Durch POV-Szenen wird der Zuschauer direkt in die Wahrnehmung der Protagonisten versetzt, was die Grenze zwischen Filmkörper und Zuschauerkörper verschwimmen lässt und Immersion erzeugt.
Welche Medienkritik übt der Film?
Der Film hinterfragt den Konsum von medialisierter Gewalt und die Sucht nach künstlichen Erfahrungen, die die reale, körperliche Präsenz ersetzen.
- Quote paper
- Danny Gronmaier (Author), 2013, Seeing the seen, hearing the heard. Körperlichkeit und Audio-Vision in Kathryn Bigelows "Strange Days", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294263