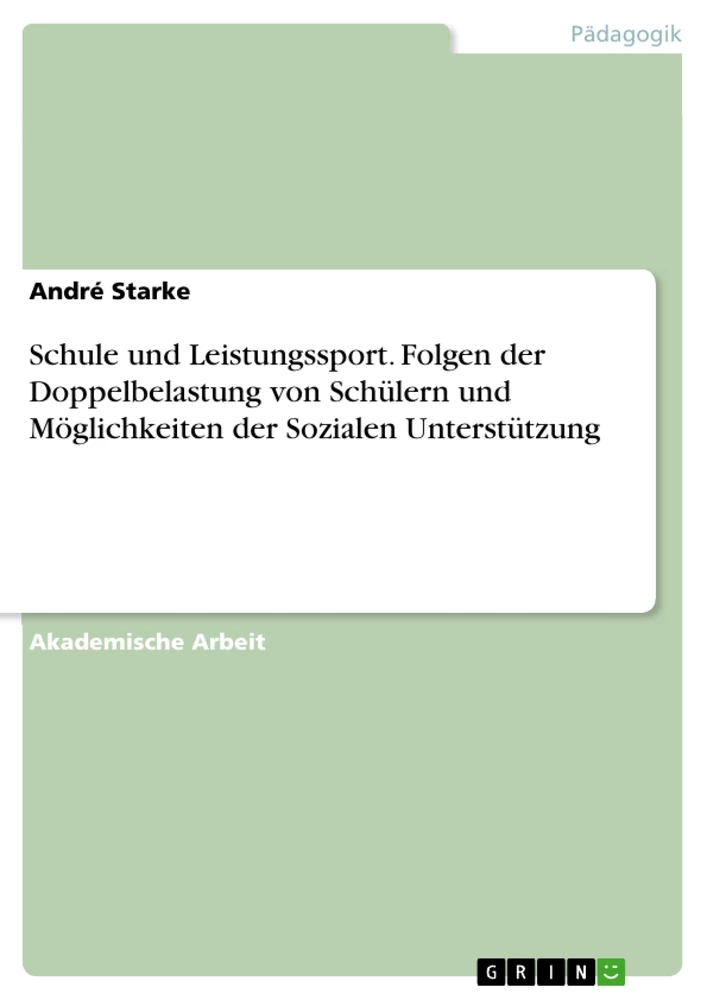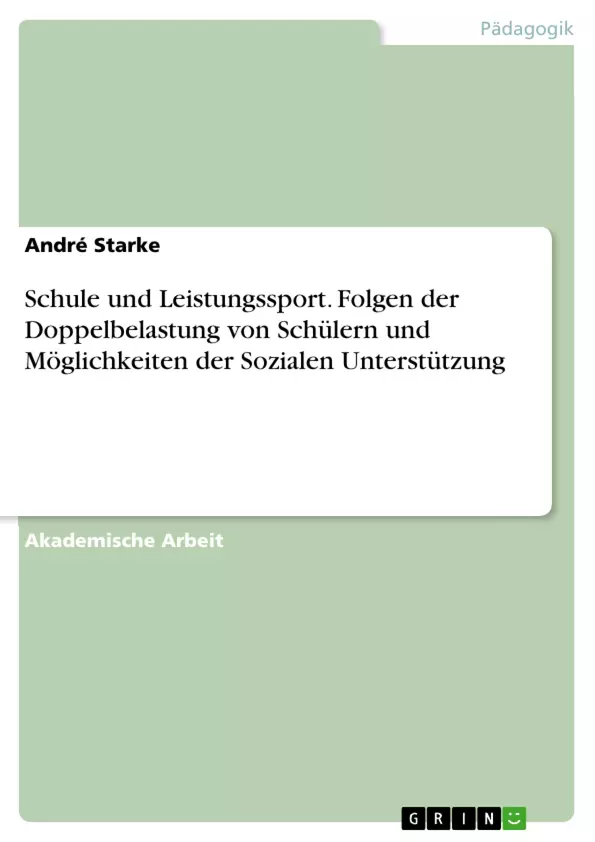Schüler, die eine Sportschule besuchen, sind täglich einer hohen Belastung von sportlichen und schulischen Anforderungen ausgesetzt. Es gilt sowohl der Schule als auch dem Leistungssport genügend Beachtung zu schenken und kein Ziel aus den Augen zu verlieren. In dieser Arbeit sollen Begriffe geklärt, die Literatur zur Doppelbelastung genannt, Aspekte der Schule und Gesichtspunkte sportlicher Anstrengungen beschrieben, Unterstützungsleistungen zur Bewältigung dokumentiert und die Auswirkungen der Doppelbelastung erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Doppelbelastung der Schüler von Schule und Leistungssport
- Die Doppelbelastung von Schule und Leistungssport
- Aspekte der Institution Schule
- Gesichtspunkte sportlicher Anstrengungen
- Die Bewältigung der Doppelbelastung durch Unterstützungsleistungen
- Begriffsklärung
- Soziale Unterstützung durch die Schule
- Soziale Unterstützung durch das Internat
- Soziale Unterstützung durch den Sport
- Soziale Unterstützung durch die Eltern
- Soziale Unterstützung durch die Freunde
- Auswirkungen der Doppelbelastung und Unterstützung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Doppelbelastung von Schülern, die gleichzeitig Leistungssport betreiben. Ziel ist es, die Herausforderungen und Auswirkungen dieser Doppelbelastung zu analysieren und Möglichkeiten der sozialen Unterstützung aufzuzeigen.
- Die Auswirkungen der Doppelbelastung von Schule und Leistungssport auf die Schüler
- Die Rolle der Schule, des Internats, des Sports, der Eltern und Freunde bei der Bewältigung der Doppelbelastung
- Die Bedeutung von sozialer Unterstützung für die Schüler
- Die Herausforderungen der Abstimmung von Schulkarriere und Sportkarriere
- Die Bedeutung der Zeitmanagement-Fähigkeiten für Schüler im Leistungssport
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der Doppelbelastung von Schule und Leistungssport dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 definiert den Begriff der Doppelbelastung und beleuchtet die Aspekte der Institution Schule sowie die Gesichtspunkte sportlicher Anstrengungen. Kapitel 3 widmet sich den verschiedenen Formen der sozialen Unterstützung, die Schülern bei der Bewältigung der Doppelbelastung helfen können. Es werden die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule, das Internat, den Sport, die Eltern und die Freunde analysiert. Kapitel 4 behandelt die Auswirkungen der Doppelbelastung und der sozialen Unterstützung auf die Schüler. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Doppelbelastung, Leistungssport, Schule, soziale Unterstützung, Internat, Eltern, Freunde, Zeitmanagement, Schulkarriere, Sportkarriere, Adoleszenz, biographische Höchstleistung, Zeitliche Gesamtbelastung, Trainingszeiten, Schulzeiten, Hobbys, Leistungsentwicklung, Wohlbefinden, Förderempfehlungen, Herausforderungen der Inklusion, Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
- Citation du texte
- André Starke (Auteur), 2011, Schule und Leistungssport. Folgen der Doppelbelastung von Schülern und Möglichkeiten der Sozialen Unterstützung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294296