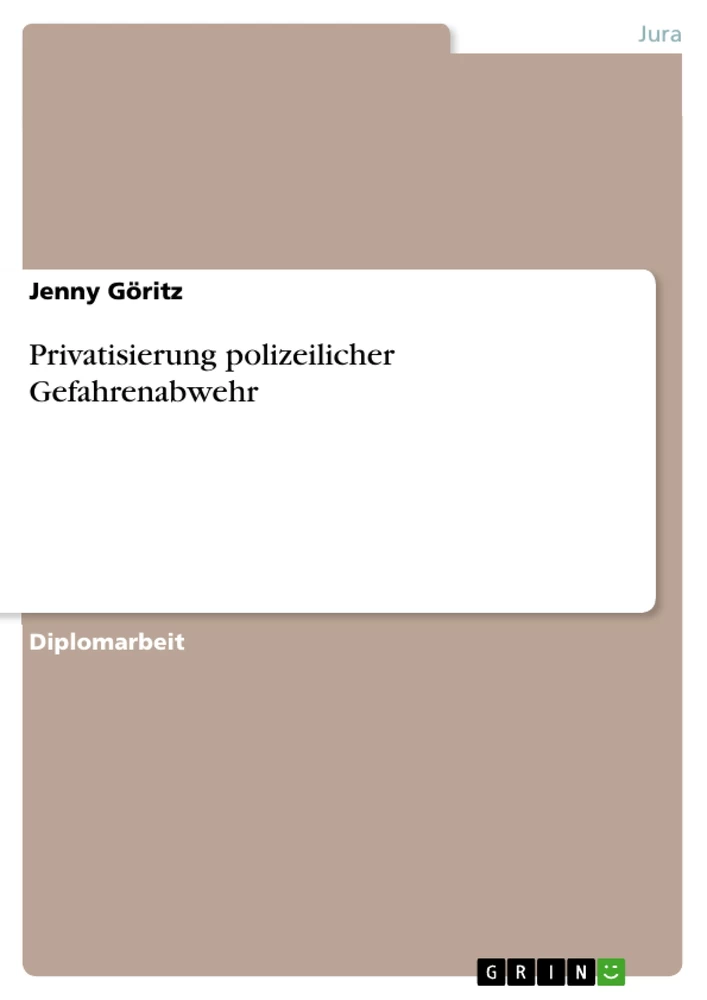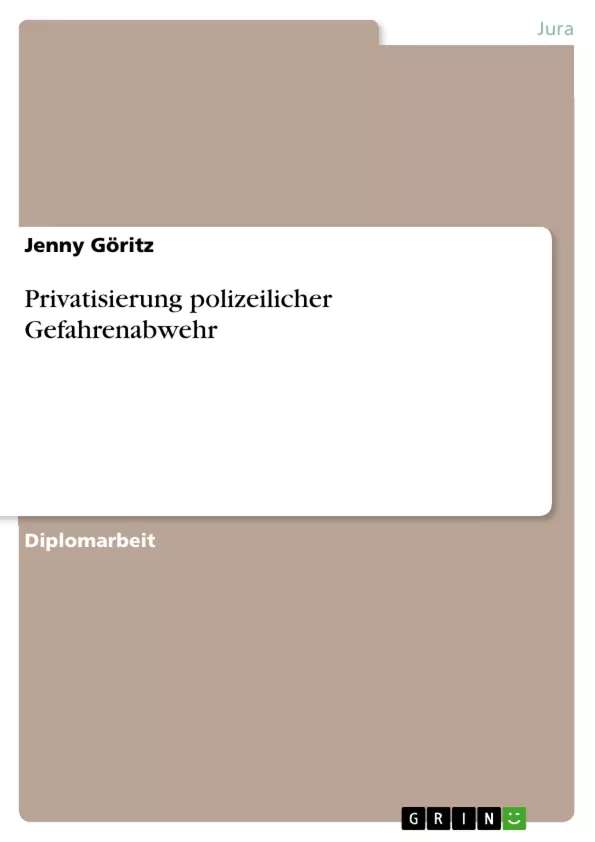Inhaltsangabe (Auszug)
§ 1 Einleitung
§ 2 Die Privatisierung in der aktuellen Debatte
I. Hintergrund der aktuellen Debatte
1. Die angespannte Lage der öffentlichen Haushalte
2. Die Internationalisierung und Globalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen
3. Das Europäische Gemeinschaftsrecht
II. Privatisierungsziele und -motive
1. Finanzpolitische Ziele und Motive
2. Ordnungspolitische Ziele und Motive
3. Wirtschaftspolitische Ziele und Motive
4. Betriebswirtschaftliche Ziele und Motive
§ 3 Begriffliche Grundlagen
I. Privatisierung
1. Vermögensprivatisierung
2. Organisationsprivatisierung
3. Aufgabenprivatisierung
4. Erfüllungsprivatisierung
II. Polizei
III. Gefahrenabwehr
§ 4 Aktuelle Situation der gewerblichen Sicherheit
I. Zum Begriff der gewerblichen Sicherheit
II. Geschichtliche Ursprünge
III. Entwicklung des privaten Sicherheitsgewerbes
1. Anteil am Sicherheitsmarkt
2. Wachstumsgründe
IV. Verhältnis zur Polizei (Wandel der Sicherheitsphilosophie)
§ 5 Erscheinungsformen Privater im Bereich der Gefahrenabwehr
I. Von Privaten selbst ausgehendes Tätigwerden
II. Vom Staat veranlasstes Tätigwerden
1. Beleihung
2. Verwaltungs- bzw. Polizeihilfe
3. Indienstnahme
§ 6 Gesetzliche Regelungen im Bereich der gewerblichen Sicherheit
I. Allgemeine gewerberechtliche Regeln
1. § 34a Gewerbeordnung (GewO)
2. Verordnung über das Bewachungsgewerbe (BewachV)
II. Zugang zum Bewachungsgewerbe
1. Tätigkeitsvoraussetzungen für Gewerbetreibende
2. Tätigkeitsvoraussetzungen für Arbeitnehmer
III. Handlungsgrundlagen
1. Jedermannsrechte
2. Vom Auftraggeber vertraglich übertragene
IV. Bewaffnung
V. Staatliche Kontrolle und Überwachung
§ 7 Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der privaten Sicherheitsdienstleistungen
I. Rechtsstaatsprinzip und Gewaltmonopol
1. Ursprung und Bedeutung des Gewaltmonopols
2. Verfassungsrechtliche Verankerung
3. Gewaltmonopol als Privatisierungsgrenze
a) Gefahrenabwehr ohne staatliche Veranlassung
b) Staatlich veranlasste Gefahrenabwehr ohne hoheitliche Befugnisse
c) Staatlich veranlasste Gefahrenabwehr mit hoheitlichen Befugnissen
II. Demokratieprinzip
1. Demokratische Legitimation und Kontrolle
2. Grenzen aus dem Demokratieprinzip
a) Demokratieprinzip und Gefahrenabwehr ohne staatliche Veranlassung
b) Demokratieprinzip und staatlich veranlasste Gefahrenabwehr
III. Sozialstaatsprinzip
1. Kommerzialisierung .....
....
Inhaltsverzeichnis
- § 1 Einleitung
- § 2 Die Privatisierung in der aktuellen Debatte
- I. Hintergrund der aktuellen Debatte
- II. Privatisierungsziele und -motive
- § 3 Begriffliche Grundlagen
- § 4 Aktuelle Situation der gewerblichen Sicherheit
- I. Zum Begriff der gewerblichen Sicherheit
- II. Geschichtliche Ursprünge
- III. Entwicklung des privaten Sicherheitsgewerbes
- IV. Verhältnis zur Polizei (Wandel der Sicherheitsphilosophie)
- § 5 Erscheinungsformen Privater im Bereich der Gefahrenabwehr
- I. Von Privaten selbst ausgehendes Tätigwerden
- II. Vom Staat veranlasstes Tätigwerden
- § 6 Gesetzliche Regelungen im Bereich der gewerblichen Sicherheit
- I. Allgemeine gewerberechtliche Regeln
- II. Zugang zum Bewachungsgewerbe
- III. Handlungsgrundlagen
- IV. Bewaffnung
- V. Staatliche Kontrolle und Überwachung
- § 7 Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der privaten Sicherheitsdienstleistungen
- I. Rechtsstaatsprinzip und Gewaltmonopol
- II. Demokratieprinzip
- III. Sozialstaatsprinzip
- IV. Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums
- § 8 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr. Ziel ist es, die aktuellen Debatten, rechtlichen Rahmenbedingungen und verfassungsrechtlichen Implikationen dieser Entwicklung zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Motive und Ziele der Privatisierung im Sicherheitssektor und untersucht die verschiedenen Erscheinungsformen privater Gefahrenabwehr.
- Motive und Ziele der Privatisierung im Sicherheitsbereich
- Rechtliche Rahmenbedingungen der gewerblichen Sicherheit
- Verfassungsrechtliche Aspekte des Gewaltmonopols und der privaten Gefahrenabwehr
- Entwicklung und aktuelle Situation des privaten Sicherheitsgewerbes
- Verhältnis zwischen staatlicher und privater Gefahrenabwehr
Zusammenfassung der Kapitel
§ 2 Die Privatisierung in der aktuellen Debatte: Dieses Kapitel analysiert den Hintergrund der aktuellen Debatte um die Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr. Es werden die angespannte Lage der öffentlichen Haushalte, die Internationalisierung und Globalisierung wirtschaftlicher Beziehungen sowie das europäische Gemeinschaftsrecht als wichtige Einflussfaktoren beleuchtet. Weiterhin werden die finanz-, ordnungs-, wirtschafts- und betriebswirtschaftlichen Ziele und Motive der Privatisierung detailliert untersucht und gegeneinander abgewogen. Der Fokus liegt auf der Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven und der Erarbeitung eines umfassenden Bildes der Triebkräfte hinter der Privatisierungstendenz.
§ 3 Begriffliche Grundlagen: Das Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Privatisierung“ und deren verschiedene Ausprägungen (Vermögensprivatisierung, Organisationsprivatisierung, Aufgabenprivatisierung, Erfüllungsprivatisierung) im Kontext der Gefahrenabwehr. Es definiert den Begriff „Polizei“ und „Gefahrenabwehr“ und schafft so eine fundierte Basis für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema. Die präzise Begriffsbestimmung ist essentiell für das Verständnis der nachfolgenden Analysen und dient der Vermeidung von Missverständnissen und Mehrdeutigkeiten.
§ 4 Aktuelle Situation der gewerblichen Sicherheit: Dieses Kapitel beschreibt den Begriff der gewerblichen Sicherheit, deren geschichtliche Entwicklung und das aktuelle Wachstum des privaten Sicherheitsgewerbes. Es analysiert den Anteil des privaten Sicherheitsmarktes und die Gründe für dessen Wachstum. Besonders hervorgehoben wird das veränderte Verhältnis zwischen Polizei und privaten Sicherheitsdiensten, welches im Wandel der Sicherheitsphilosophie begründet liegt. Die Analyse beleuchtet die zunehmende Interdependenz und die Herausforderungen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben.
§ 5 Erscheinungsformen Privater im Bereich der Gefahrenabwehr: Hier werden die verschiedenen Erscheinungsformen privaten Handelns im Bereich der Gefahrenabwehr unterschieden: selbst initiiertes Handeln von Privatpersonen und vom Staat veranlasstes Tätigwerden (Beleihung, Verwaltungs-/Polizeihilfe, Indienstnahme). Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten der Akteure und die rechtlichen Grundlagen ihres Handelns. Die Unterscheidung zwischen staatlich initiierter und privater Gefahrenabwehr bildet die Grundlage für die weiteren Kapitel.
§ 6 Gesetzliche Regelungen im Bereich der gewerblichen Sicherheit: Dieses Kapitel beleuchtet die gesetzlichen Regelungen für gewerbliche Sicherheitsdienste, einschließlich der Gewerbeordnung, der Bewachungsverordnung und der Zugangsvoraussetzungen für Gewerbetreibende und Arbeitnehmer. Es untersucht die Handlungsgrundlagen privater Sicherheitsdienste (Jedermannsrechte, vertraglich übertragene Handlungsgrundlagen) und die rechtlichen Bestimmungen zur Bewaffnung und staatlichen Kontrolle. Die Analyse fokussiert auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Praxis.
§ 7 Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der privaten Sicherheitsdienstleistungen: In diesem Kapitel werden die verfassungsrechtlichen Aspekte der Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip (Gewaltmonopol), das Demokratieprinzip und das Sozialstaatsprinzip untersucht. Der Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums und die Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf Private werden kritisch analysiert. Die Arbeit untersucht die Grenzen der Privatisierung im Lichte der Grundrechte und deren Auswirkung auf die Gestaltung des Sicherheitssektors.
Schlüsselwörter
Privatisierung, Gefahrenabwehr, Polizei, gewerbliche Sicherheit, Gewaltmonopol, Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip, Sozialstaatsprinzip, Verfassungsrecht, Gewerbeordnung, Bewachungsgewerbe, öffentliche Haushalte, Sicherheitsmarkt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr. Sie analysiert die aktuellen Debatten, rechtlichen Rahmenbedingungen und verfassungsrechtlichen Implikationen dieser Entwicklung, beleuchtet die Motive und Ziele der Privatisierung im Sicherheitssektor und untersucht die verschiedenen Erscheinungsformen privater Gefahrenabwehr.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Motive und Ziele der Privatisierung im Sicherheitsbereich, rechtliche Rahmenbedingungen der gewerblichen Sicherheit, verfassungsrechtliche Aspekte des Gewaltmonopols und der privaten Gefahrenabwehr, Entwicklung und aktuelle Situation des privaten Sicherheitsgewerbes sowie das Verhältnis zwischen staatlicher und privater Gefahrenabwehr.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Privatisierung in der aktuellen Debatte (inkl. Hintergrund und Motiven), Begriffliche Grundlagen (Privatisierung und Gefahrenabwehr), Aktuelle Situation der gewerblichen Sicherheit (inkl. Geschichte und Verhältnis zur Polizei), Erscheinungsformen Privater im Bereich der Gefahrenabwehr, Gesetzliche Regelungen im Bereich der gewerblichen Sicherheit, Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der privaten Sicherheitsdienstleistungen und Schlussbetrachtung.
Welche Begrifflichkeiten werden geklärt?
Die Arbeit klärt zentrale Begriffe wie „Privatisierung“ (mit ihren verschiedenen Ausprägungen: Vermögensprivatisierung, Organisationsprivatisierung, Aufgabenprivatisierung, Erfüllungsprivatisierung), „Polizei“ und „Gefahrenabwehr“. Dies dient der Vermeidung von Missverständnissen und Mehrdeutigkeiten.
Welche Aspekte der Privatisierung werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Motive und Ziele der Privatisierung (finanzielle, ordnungspolitische, wirtschafts- und betriebswirtschaftliche Aspekte), die rechtlichen Rahmenbedingungen (Gewerbeordnung, Bewachungsverordnung, Handlungsgrundlagen, Bewaffnung, staatliche Kontrolle), und die verfassungsrechtlichen Implikationen (Gewaltmonopol, Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip, Sozialstaatsprinzip, Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums).
Welche gesetzlichen Regelungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert allgemeine gewerberechtliche Regeln, den Zugang zum Bewachungsgewerbe, Handlungsgrundlagen privater Sicherheitsdienste (Jedermannsrechte, vertraglich übertragene Handlungsgrundlagen), rechtliche Bestimmungen zur Bewaffnung und staatliche Kontrolle im Bereich der gewerblichen Sicherheit.
Welche verfassungsrechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die verfassungsrechtlichen Aspekte umfassen die Prüfung der Vereinbarkeit der Privatisierung mit dem Rechtsstaatsprinzip (inkl. Gewaltmonopol), dem Demokratieprinzip und dem Sozialstaatsprinzip. Der Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums und die Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf Private werden kritisch beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Privatisierung, Gefahrenabwehr, Polizei, gewerbliche Sicherheit, Gewaltmonopol, Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip, Sozialstaatsprinzip, Verfassungsrecht, Gewerbeordnung, Bewachungsgewerbe, öffentliche Haushalte, Sicherheitsmarkt.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für jedes Kapitel, welche die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts zusammenfassen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Personen bestimmt, die sich akademisch mit der Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr auseinandersetzen möchten. Sie ist für den akademischen Gebrauch gedacht.
- Citation du texte
- Jenny Göritz (Auteur), 2008, Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294307