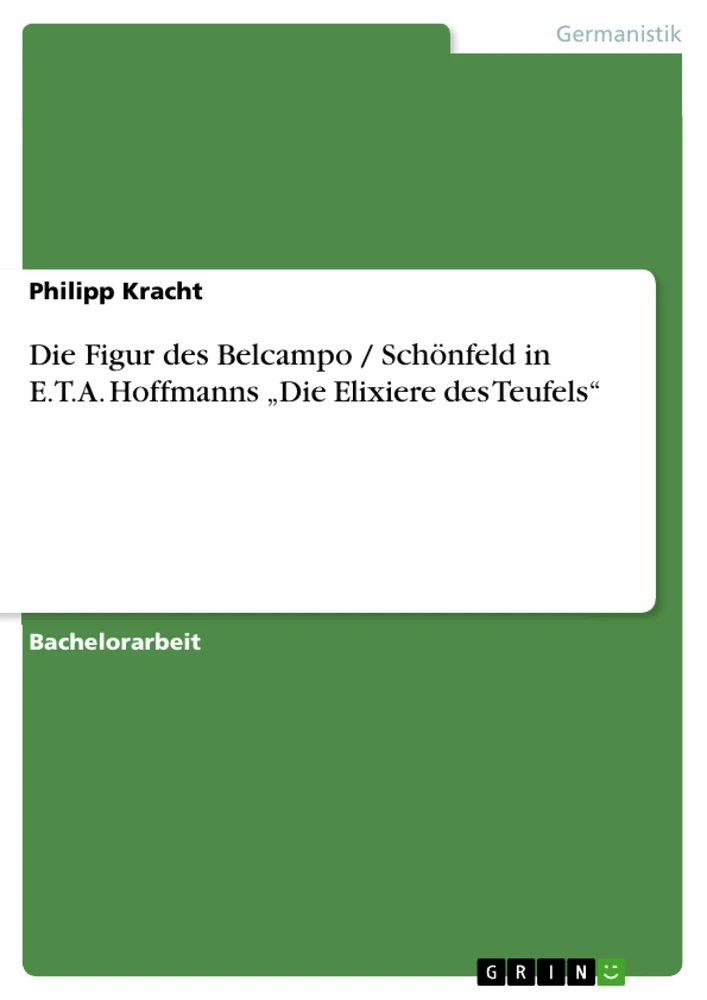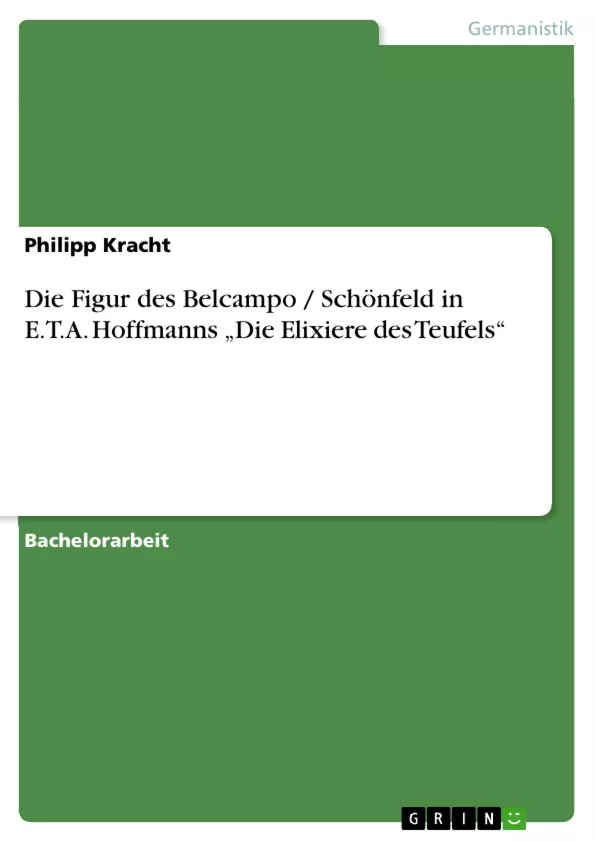Die Elixiere des Teufels , 1815 (erster Band) beziehungsweise 1816 (zweiter Band) im Erstdruck erschienen, ist Hoffmanns erster Roman – es folgt nur noch einer: Lebensansichten des Kater Murr -, sein längster zusammenhängender Text und vielschichtig und uneindeutig wie so viele seiner Werke. Er schreibt ihn direkt nach Beendigung von Der goldene Topf (1814) im Eiltempo, wenn auch mit einer Unterbrechung zwischen den Teilen, die einen gewissen Bruch im Text erklärt. Der Roman ist die fiktive Autobiographie von Medardus, einem Bamberger Mönch, der seine Reise von Deutschland nach Italien (Rom) und wieder zurück beschreibt, in deren Verlauf er die rätselhaften und weitläufigen Umstände eines Familienfluchs entdeckt, den sein Ur-Urgroßvater einst verschuldet hatte.
Neben der vielfach diskutierten Hauptfigur des Klosterbruders Medardus zeichnet Hoffmann feine Bilder anderer Charaktere. Manche werden ausführlich beschrieben, wie Medardus' große Liebe Aurelie, der Prior des Klosters zu B., oder der geheimnisvolle Maler. Andere erscheinen als Randfiguren, wie Euphemie, Hermogen, der Förster, die Äbtissin oder eben der Haarschneider Pietro Belcampo / Peter Schönfeld .
Diese Nebenfiguren mit vergleichsweise kleinen Textanteilen sind bei näherer Betrachtung offensichtlich nicht so unwichtig, wie es ihre proportionale Präsenz vermuten lässt: Entweder finden sich extrem wichtige, den Gesamttext kommentierende Äußerungen von ihnen, oder sie treten an Wendepunkten und in entscheidenden Szenen in Medardus' Leben auf.
Belcampo nimmt dabei eine Sonderstellung ein, da er Medardus vermutlich den gesamten Weg über begleitet und ziemlich genau über die Umstände, die Medardus entschlüsseln will, informiert zu sein scheint. Zudem wird die Arbeit zeigen, dass seine Aktionen und Worte bei einer Deutung des Romans von großem Nutzen sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Belcampo im Roman - Eine Einführung der Themen
- Stand der Forschung
- Einführung zur Figur des Belcampo
- Äußere Merkmale
- Sprachliche Besonderheiten
- Definition des Possenhaften / Possierlichen
- Der rothaarige Ire: Eine weitere Dimension des Pietro?
- Doppelgängermotiv
- Doppelgänger- und Spiegelungsmotiv bei Hoffmann
- Gedoppelte Persönlichkeit in der Figur
- Zitate und der Hinweis auf Bildung
- Der Künstler im Friseur
- Künstlermotiv bei Belcampo
- Bezug Maler - Bildhauer
- Wahnsinn im Künstler
- Belcampo in der Tradition des Narren
- Diskussion der Kompatibilität Belcampos mit dem klassischen Narren
- Rat Krespel als weiterer Verwandter?
- Belcampos Diskurse
- Bewusstsein
- Passivität und Initiative
- Glaube und Selbstbestimmung. Ein Widerspruch?
- Was will Hoffmann uns mit seiner Figur des Belcampo sagen? Eine Annäherung
- Belcampos Funktion
- Selbstbestimmung oder Schicksal - der Kommentar des Narren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Figur des Belcampo / Schönfeld in E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“. Sie soll die Rolle der Figur im Roman beleuchten, ihre Stellung in der Literaturgeschichte als Narr sowie die möglichen literarischen Vorbilder für ihre Darstellung analysieren. Außerdem wird ein Charakterprofil erstellt, das die Bedeutung Belcampos für den Roman verdeutlicht.
- Die Figur des Belcampo als Vertreter des literarischen Narren und seine Funktion im Roman
- Die Bedeutung von Belcampos Rede und seinen Diskursen zu Themen wie Bewusstsein, Selbstbestimmung und Schicksal
- Die widersprüchliche Natur der Figur als sowohl wahnsinniger Künstler als auch rationaler Beobachter
- Die Rolle von Belcampo als Kommentar zu Hoffmanns eigenen Ansichten über die Gesellschaft, den Glauben und die Kunst
- Die Analyse der Figur im Kontext des Doppelgängermotivs und der Spiegelungstheorie in Hoffmanns Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in die Figur des Belcampo, die seine äußeren Merkmale, seine sprachliche Besonderheiten und die Rolle des Possierlichen in seinem Charakter beleuchtet. Es folgt eine Analyse des Doppelgängermotivs bei Hoffmann und eine Diskussion über die doppelte Persönlichkeit Belcampos. Außerdem wird die Figur im Kontext des Künstlermotivs und ihrer möglichen Beziehung zu anderen wichtigen Figuren des Romans untersucht. Die Arbeit beleuchtet anschließend Belcampos Diskurse zu Bewusstsein, Passivität und Initiative und stellt die Frage nach seiner Beziehung zum Glauben und zur Selbstbestimmung. Schließlich wird eine Annäherung an die Bedeutung der Figur für den Roman unternommen, die ihre Funktion als Katalysator für verschiedene Interpretationsebenen und ihre Rolle als Kommentar zu Hoffmanns eigenen Ansichten diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Figur des Belcampo / Schönfeld in E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: literarischer Narr, Doppelgängermotiv, Künstlermotiv, Bewusstsein, Selbstbestimmung, Schicksal, Glaube, Kunst, Spiegelungstheorie, Romantik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Figur Belcampo in „Die Elixiere des Teufels“?
Belcampo (Peter Schönfeld) fungiert als eine Art literarischer Narr und Begleiter des Protagonisten Medardus. Er scheint über die Familiengeheimnisse besser informiert zu sein als Medardus selbst.
Wie ist Belcampos Charakter beschaffen?
Er ist eine widersprüchliche Figur: Einerseits wird er als „possierlicher“ Haarschneider und wahnsinniger Künstler dargestellt, andererseits äußert er tiefe Einsichten über Bewusstsein und Schicksal.
Welche Bedeutung hat das Doppelgängermotiv bei Belcampo?
Belcampo spiegelt Aspekte von Medardus' Persönlichkeit wider. Die Arbeit untersucht die gedoppelte Identität der Figur (Belcampo/Schönfeld) im Kontext von Hoffmanns Spiegelungstheorie.
Was sagt Belcampo über die Selbstbestimmung des Menschen?
In seinen Diskursen kommentiert er das Spannungsfeld zwischen freiem Willen (Initiative) und dem Schicksal, was eine zentrale philosophische Ebene des Romans darstellt.
Ist Belcampo ein typischer romantischer Künstler?
Ja, durch seine Verbindung von Genie und Wahnsinn sowie seine Auffassung vom Frisieren als bildhauerische Kunst verkörpert er Hoffmanns spezifisches Künstlermotiv.
- Quote paper
- Philipp Kracht (Author), 2011, Die Figur des Belcampo / Schönfeld in E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294451