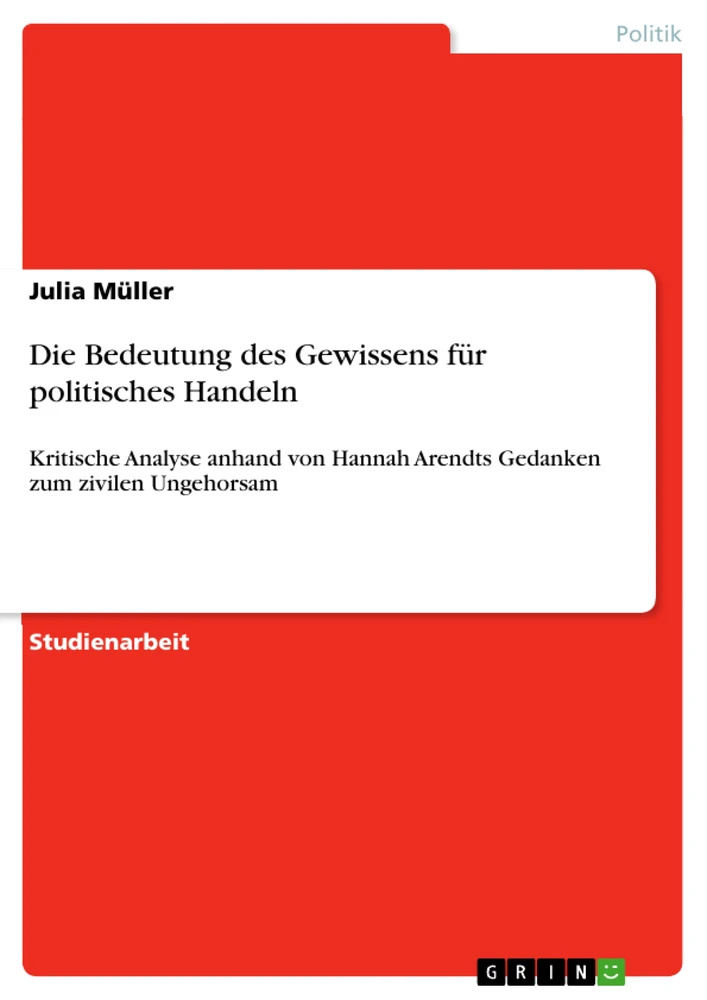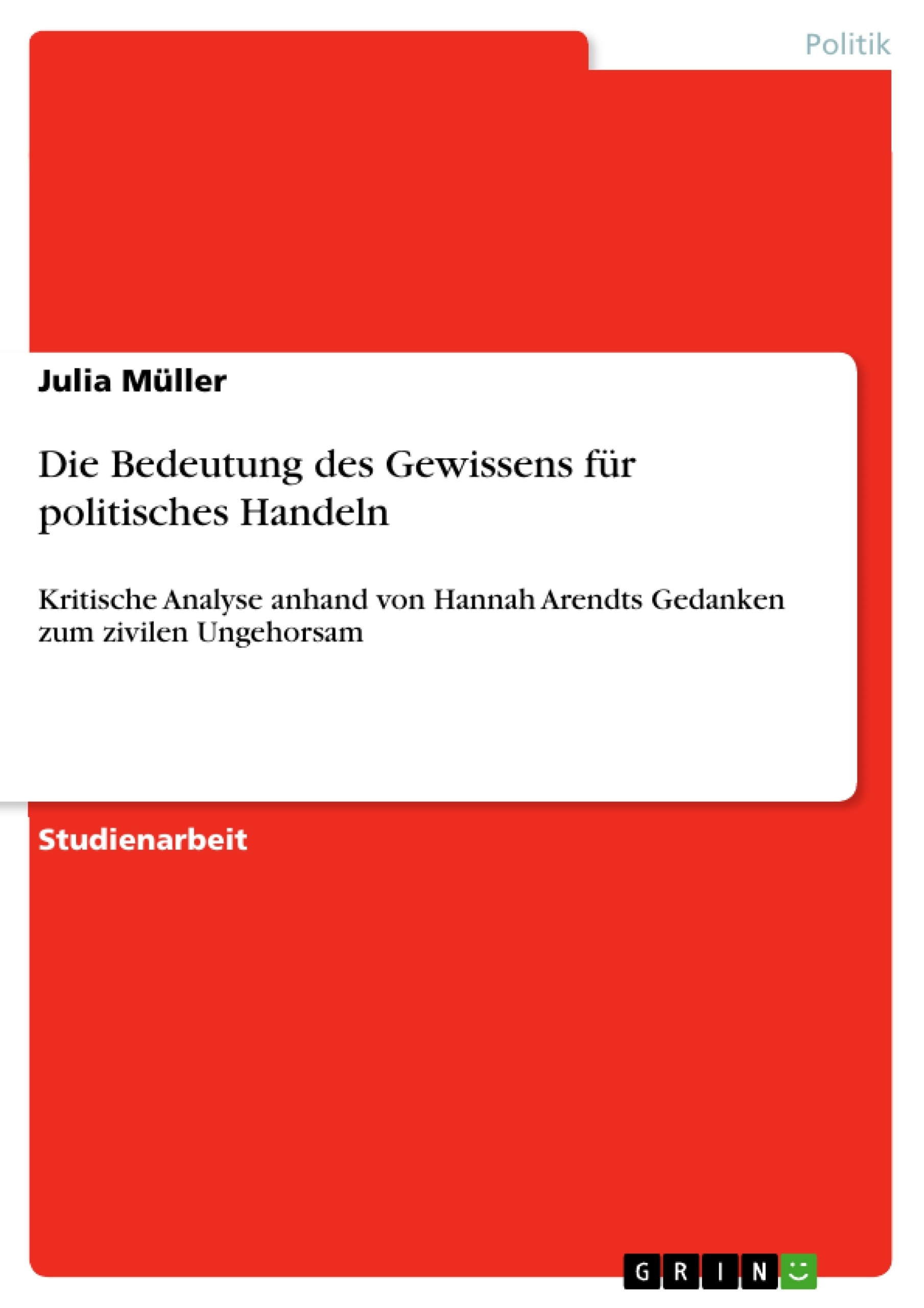Ziviler Ungehorsam ist gewissensgeleiteter, bewusster Rechtsbruch, um innerhalb einer verfassungsmäßigen Ordnung gegen bestehende Gesetze oder einzelnes Regierungshandeln zu pro-testieren. Spätestens seit Thoreau ist das Gewissen aus Definitionen des zivilen Ungehorsams nicht mehr wegzudenken. Im Zuge des Kampfes gegen die Rassentrennung und später der Proteste gegen den Vietnamkrieg wurde der Begriff des zivilen Ungehorsams auch außerhalb der wissenschaftlichen Betätigung aktuell. Doch der Begriff, der von verschiedensten Aktionsformen für sich in Anspruch genommen wird, bedarf einer theoretischen Basis, damit man das Phänomen als solches verstehen und von anderen Formen des Widerstandes trennen kann: „Widerstand kann sich gegen eine äußere wie eine innere Bedrohung richten, er kann gewaltsam oder gewaltlos/gewaltfrei, aktiv oder passiv, zivil oder militärisch sein“ (Münkler 1995: 691), schreibt Münkler über die verschiedenen Formen des Widerstandes. Einige Aspekte hiervon treffen auf den zivilen Ungehorsam zu, andere nicht. Verschiedene Theoretiker haben den zivilen Ungehorsam unterschiedlich definiert.
Auch Hannah Arendt hat sich im Zuge des Vietnamkrieges mit dem zivilen Ungehorsam auseinander gesetzt. Neben einer eigenen Definition geht es ihr vor allem darum, in ihren Augen falsche Annahmen über den zivilen Ungehorsam zu korrigieren und ihn als geeignetes Heilmittel darzustellen für eine Gesellschaft, in welcher der Geist der Verfassung nicht mehr im Vordergrund steht – konkret bezogen auf Amerika in der späten Mitte des 20. Jahrhunderts. Ihre Kritik an anderen Definitionen des zivilen Ungehorsams richtet sich dabei vor allem gegen das Gewissen als Grundlage.
Was bei anderen Autoren ein entscheidendes Merkmal ist, wird also bei Arendt abgelehnt. Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung das Gewissen für politisches Handeln hat. Diese leitende Fragestellung wird in dieser Arbeit in drei Schritten bearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Gewissen und ziviler Ungehorsam
- Theorien des zivilen Ungehorsams
- Thoreau
- Rawls
- Habermas
- Das Gewissen im Diskurs
- Klassische und post-klassische Gewissensdiskurse
- Ziviler Ungehorsam bei Hannah Arendt
- Politik ohne Gewissen? - Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert kritisch die Bedeutung des Gewissens für politisches Handeln, insbesondere im Kontext von zivilem Ungehorsam. Dabei werden Hannah Arendts Gedanken zum zivilen Ungehorsam in den Mittelpunkt gestellt und mit anderen Theorien des zivilen Ungehorsams verglichen.
- Die Rolle des Gewissens in der Definition von zivilem Ungehorsam
- Vergleich der Ansätze von Thoreau, Rawls und Habermas zum zivilen Ungehorsam
- Klassische und post-klassische Gewissensdiskurse
- Hannah Arendts Kritik am Gewissen als Grundlage für zivilen Ungehorsam
- Die Bedeutung des Gewissens im politischen Raum
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Bedeutung des Gewissens im Zusammenhang mit zivilem Ungehorsam. Es stellt die Definition des zivilen Ungehorsams als gewissensgeleiteten Rechtsbruch dar und verweist auf die Relevanz des Gewissens in der Diskussion über zivilen Ungehorsam, insbesondere seit Thoreau. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen des Widerstandes und hebt die Besonderheit des zivilen Ungehorsams hervor.
Das zweite Kapitel präsentiert die Theorien des zivilen Ungehorsams von Thoreau, Rawls und Habermas. Es beleuchtet die Gemeinsamkeiten dieser Theorien und die Rolle, die das Gewissen in ihren Definitionen spielt. Die Autoren sehen das Gewissen als Grundlage für zivilen Ungehorsam und bilden somit einen Gegenpunkt zu den späteren Analysen zu Hannah Arendt.
Das dritte Kapitel vergleicht den klassischen und den post-klassischen Ansatz der Gewissensdeutung. Hegel wird als Vertreter des klassischen Ansatzes dargestellt, der von einer Norm mit Allgemeinheitsanspruch ausgeht und das individuelle Gewissen aus dem Staat ausschließt. Luhmann wird als post-klassischer Vertreter vorgestellt, der das Gewissen als Funktion in seinem Konzept der Systeme und Umwelt einordnet.
Schlüsselwörter
Ziviler Ungehorsam, Gewissen, politisches Handeln, Hannah Arendt, Thoreau, Rawls, Habermas, klassischer Gewissensdiskurs, post-klassischer Gewissensdiskurs, Rechtsbruch, Widerstand, Verfassung, Gesellschaft, Amerika.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter zivilem Ungehorsam?
Ziviler Ungehorsam ist ein gewissensgeleiteter, bewusster Rechtsbruch, um gegen Gesetze oder Regierungshandeln innerhalb einer verfassungsmäßigen Ordnung zu protestieren.
Warum kritisiert Hannah Arendt das Gewissen als Grundlage für Protest?
Arendt sieht das Gewissen als zu subjektiv und privat an; politisches Handeln erfordert für sie eine gemeinschaftliche, öffentliche Basis.
Welche Rolle spielt Henry David Thoreau in dieser Debatte?
Thoreau gilt als Begründer des modernen Konzepts des zivilen Ungehorsams, bei dem das individuelle Gewissen über dem staatlichen Gesetz steht.
Wie unterscheiden sich Rawls und Habermas in ihren Ansätzen?
Beide sehen zivilen Ungehorsam als Mittel zur Korrektur von Gerechtigkeitsdefiziten in einer Demokratie, betonen aber unterschiedliche verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen.
Was ist der Unterschied zwischen Widerstand und zivilem Ungehorsam?
Während Widerstand oft den Umsturz des Systems anstrebt, erkennt ziviler Ungehorsam die grundsätzliche Legitimität der Verfassung an und will nur spezifische Gesetze ändern.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Julia Müller (Author), 2012, Die Bedeutung des Gewissens für politisches Handeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294499