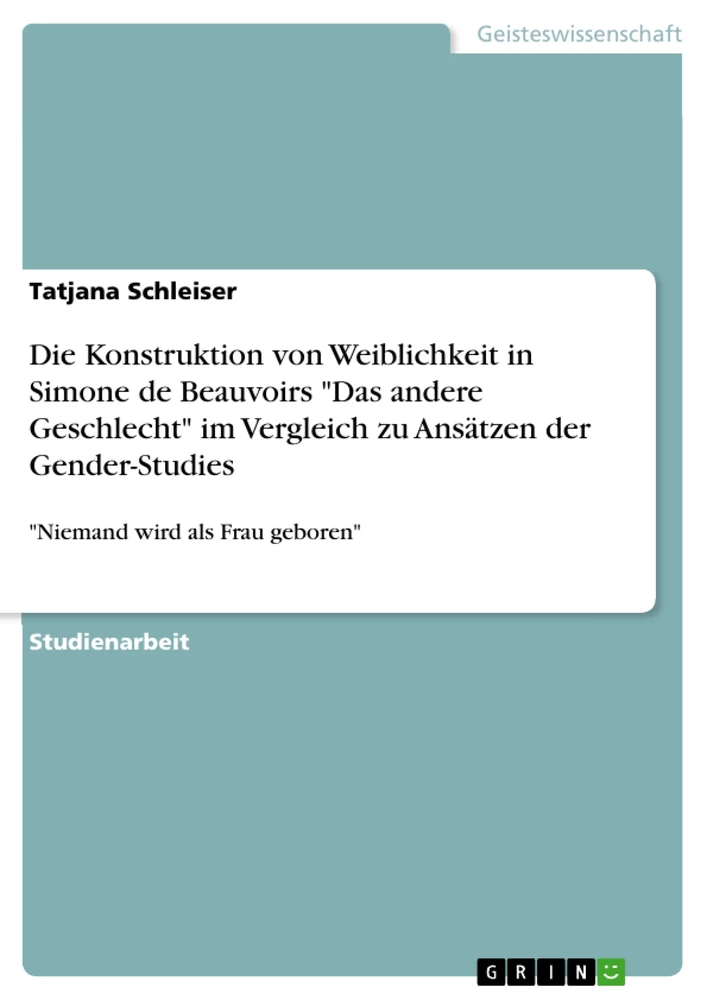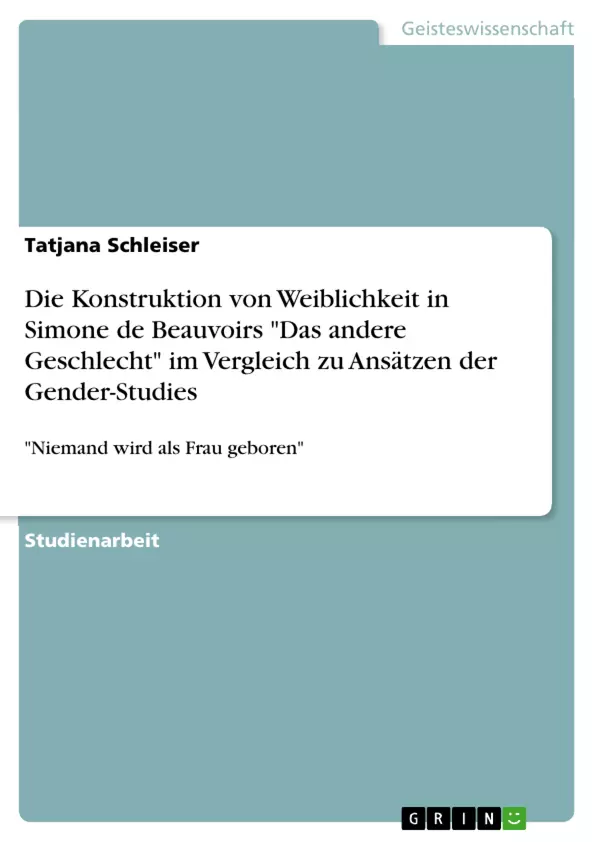Am Ende des Jahres 2012 weist in Deutschland u.a. die innerhalb der politischen Klasse und daher auch in den Medien geführte Diskussion um die Einrichtung von festen
Quoten für die Besetzung von Aufsichtsratsposten in Großunternehmen mit Frauen darauf hin, dass offensichtlich die Gleichberechtigung der Frau im Sinne einer paritätischen Repräsentanz von Frauen in Entscheidungspositionen noch längst nicht realisiert ist. Zeitgleich finden in Schweden Betreuungsangebote für Vorschulkinder großen Zulauf, die auf einem Konzept basieren, das auf jegliche Andeutung von
Geschlechterunterschieden in der Betreuungseinrichtung verzichtet, um die Kinder sexuell gleichberechtigt – oder besser: sexuell neutral – zu erziehen.
Beides sind Beispiele dafür, wie mit dem Gedanken der Gleichberechtigung der Geschlechter umgegangen wird. Beide basieren allerdings auf sehr unterschiedlichen
Auffassungen oder Wahrnehmungen des Themas. Während hinter den Initiativen deutscher Politikerinnen und Politiker ein eher traditionelles Verständnis von Gleichberechtigung steht, manifestiert sich in der Praxis...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“
- ,,Weiblichkeit“ als Reflexion und Ergänzung des männlichen Prinzips
- Historische Ableitung der Geschlechterrollen
- Weiblichkeit als sozio-kulturelle Bedingtheit
- Physische und psychische Aspekte von Weiblichkeit
- ,,Weiblichkeit“ als Reflexion und Ergänzung des männlichen Prinzips
- Die Theorie der Gender-Studies
- Die Trennung von „Sex“ und „Gender“
- ,,Weiblichkeit“ als sozio-kulturelles Stereotyp
- Vergleichende Betrachtung beider Ansätze
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung der wissenschaftlichen Debatte um die Geschlechterrollen und deren Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Sie analysiert die grundlegenden Gedanken aus Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“ und stellt diese den aktuellen Ansätzen der Gender Studies in einem kritischen Vergleich gegenüber.
- Die Konstruktion von Geschlechterrollen als gesellschaftliche Konstrukte
- Die Rolle der Biologie und der Kultur in der Geschlechtsidentität
- Die Bedeutung von Macht und Dominanz in der Geschlechterbeziehung
- Die Kritik an traditionellen Geschlechterrollen und die Forderung nach Gleichberechtigung
- Die Entwicklung der Gender Studies und ihre Bedeutung für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Geschlechterrollen und die aktuelle Debatte um Gleichberechtigung ein. Sie stellt die beiden unterschiedlichen Ansätze von Simone de Beauvoir und den Gender Studies vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
Das zweite Kapitel analysiert Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“. Es beleuchtet die Entstehung von Geschlechterrollen als gesellschaftliche Konstrukte und die Rolle des „Ewigweiblichen“ als Reflexion und Ergänzung des männlichen Prinzips. Beauvoirs Argumentation, dass Weiblichkeit nicht biologisch determiniert, sondern sozial konstruiert ist, wird im Detail dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Theorie der Gender Studies. Es erläutert die Trennung von „Sex“ und „Gender“ und die Bedeutung von sozio-kulturellen Stereotypen für die Geschlechtsidentität. Die Gender Studies kritisieren die traditionelle Geschlechterordnung und fordern eine Gleichberechtigung der Geschlechter.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Simone de Beauvoir, „Das andere Geschlecht“, Geschlechterrollen, Weiblichkeit, Gender Studies, Sex, Gender, Gleichberechtigung, gesellschaftliche Konstruktion, Macht, Dominanz, Tradition, Kritik, Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Simone de Beauvoirs "Das andere Geschlecht"?
Beauvoir argumentiert, dass Weiblichkeit nicht biologisch determiniert, sondern sozio-kulturell bedingt ist: "Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es."
Was unterscheidet "Sex" von "Gender" in den Gender Studies?
"Sex" bezeichnet das biologische Geschlecht, während "Gender" das soziale Geschlecht und die damit verbundenen Rollenerwartungen und Identitäten beschreibt.
Wie sieht Beauvoir das Verhältnis zwischen den Geschlechtern?
Sie beschreibt die Frau historisch als das "Andere", das als Reflexion und Ergänzung des männlichen Prinzips definiert wurde, was zu einer asymmetrischen Machtbeziehung führt.
Welche aktuellen Beispiele für Geschlechterdebatten nennt die Arbeit?
Genannt werden die Diskussion um Frauenquoten in Aufsichtsräten sowie schwedische Konzepte zur geschlechtsneutralen Erziehung in Vorschulen.
Warum fordern Gender Studies die Aufhebung traditioneller Rollen?
Weil diese Rollen als gesellschaftliche Konstrukte gesehen werden, die individuelle Freiheit einschränken und Machtungleichheiten zementieren.
- Quote paper
- Tatjana Schleiser (Author), 2013, Die Konstruktion von Weiblichkeit in Simone de Beauvoirs "Das andere Geschlecht" im Vergleich zu Ansätzen der Gender-Studies, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294510