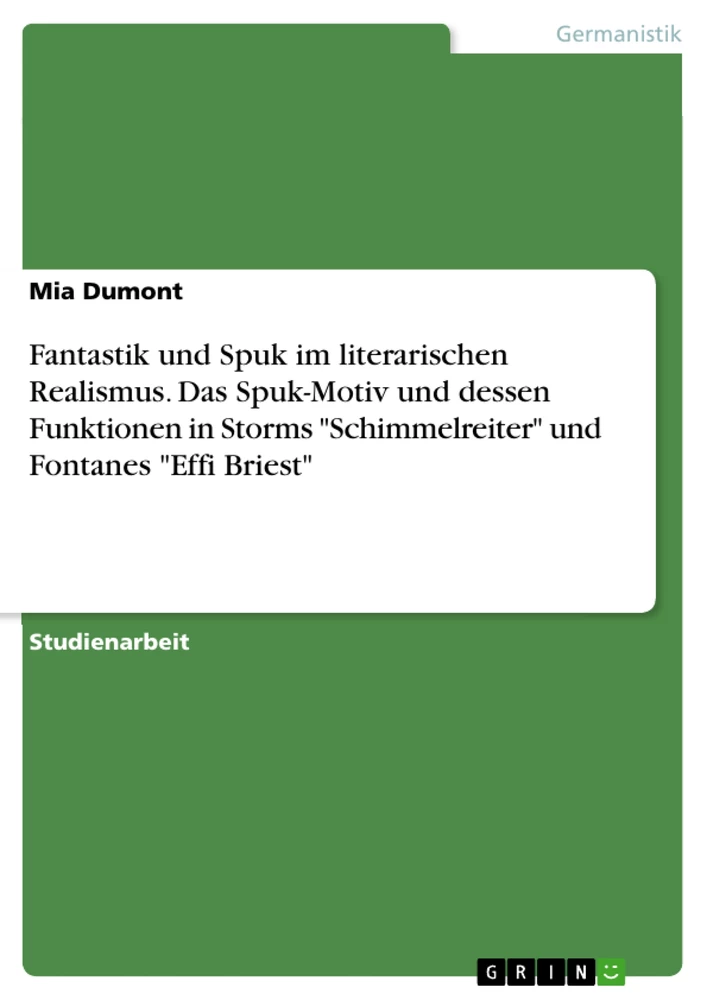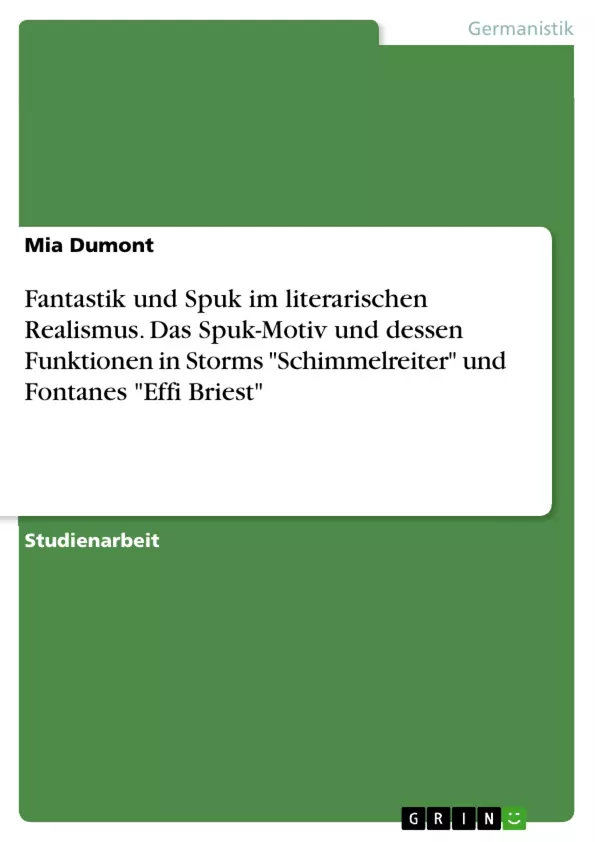Realismus und Fantastik – diese beiden Begrifflichkeiten bilden auf den ersten Blick ein Paradoxon, sie widersprechen sich. Inwiefern kann etwas Fantastisches zugleich realistisch sein? Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.
Im literarischen Realismus, einer Epoche, in welcher die möglichst genaue Wiedergabe der Wirklichkeit zur Programmatik gehört, tauchen unübersehbar immer wieder fantastische Elemente in der Literatur auf.
Auch wenn dieses Phänomen im Vergleich zur Romantik im Realismus stark marginalisiert ist und die fantastischen Elemente eher eine untergeordnete Rolle innerhalb der realistischen Literatur spielen, so ist die Fantastik im literarischen Realismus doch unbestreitbar präsent.
Diese Arbeit soll überprüfen, inwiefern Fantastik und Realismus vereinbar sind und noch einen Schritt weitergehen, indem sie speziell den Fragen nachgehen wird, inwiefern fantastische Elemente zu einer realistischen Erzählweise beitragen können und wie Übernatürliches funktionalisiert wird um realistisch zu erzählen.
Zur Beantwortung dieser beiden Fragen werden in der vorliegenden Arbeit zwei der prominentesten Beispiele realistischer Fantastik untersucht: Theodor Storms Novelle "Der Schimmelreiter" und Theodor Fontanes Gesellschaftsroman "Effi Briest".
In beiden Texten sind fantastische Elemente in Form von Spuk ausgeprägt, deshalb wird sich diese Arbeit präziser mit der Spuk-Motivik im literarischen Realismus auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Fontanes Effi Briest und Storms Schimmelreiter als Musterbeispiele für Fantastik und Spuk-Motivik im literarischen Realismus.
- Die Bedeutung von fantastischen Motiven für den literarischen Realismus
- Die fantastischen Elemente in Storms Schimmelreiter
- Der Chinesen-Spuk in Fontanes Effi Briest
- Übergreifende Thesen: Wie kann Fantastisches zu einer realistischen Erzählweise beitragen?
- Fantastische Elemente als Teil der programmatischen „ideellen Durchdringung“.
- Fantastische Elemente als „die Verklärung, das Poetische“.
- Fantastik als realistische „Moraldidaxe über die Verderblichkeit des Aberglaubens“
- Auslagerung und Historisierung der fantastischen Motive.
- Das Irreale als Bewusstseinsrealität: Traum, Wahnsinn oder Halluzination
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung von Fantastik und Realismus im literarischen Realismus, speziell anhand des Spuk-Motivs in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" und Theodor Fontanes "Effi Briest". Ziel ist es, zu analysieren, wie fantastische Elemente zu einer realistischen Erzählweise beitragen und funktionalisiert werden, um realistisch zu erzählen.
- Die Vereinbarkeit von Fantastik und Realismus im literarischen Kontext.
- Die Funktion von fantastischen Elementen (Spuk) in der realistischen Erzählweise.
- Interpretation und Vergleich der Spuk-Motivik in "Der Schimmelreiter" und "Effi Briest".
- Die unterschiedlichen Funktionen des Übernatürlichen in realistischen Texten.
- Die Bedeutung von Fantastik für den Realismus im Allgemeinen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fontanes Effi Briest und Storms Schimmelreiter als Musterbeispiele für Fantastik und Spuk-Motivik im literarischen Realismus: Diese Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit von Fantastik und Realismus im literarischen Realismus. Sie argumentiert, dass trotz der scheinbaren Widersprüchlichkeit fantastische Elemente im Realismus vorkommen und untersucht, wie diese zur realistischen Erzählweise beitragen. "Der Schimmelreiter" und "Effi Briest" werden als Fallstudien ausgewählt, da beide Texte ausgeprägte Spuk-Motivik aufweisen. Die Arbeit skizziert ihren weiteren Verlauf, der die Bedeutung von Fantastik für den Realismus beleuchtet, die Spuk-Motive in den ausgewählten Werken vorstellt, verschiedene Interpretationsansätze diskutiert und schließlich textübergreifende Thesen zur Funktionalisierung fantastischer Elemente aufstellt.
2. Die Bedeutung von fantastischen Motiven für den literarischen Realismus: Dieses Kapitel untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen der Programmatik des Realismus – der möglichst genauen Wiedergabe der Wirklichkeit – und dem Auftreten fantastischer Elemente in der Literatur dieser Epoche. Es wird herausgestellt, dass trotz der Marginalisierung durch die realistische Programmatik und die Forschung, fantastische Elemente im Realismus vorhanden sind. Storm wird als Hauptvertreter der realistischen Fantastik genannt, und Unterschiede zwischen romantischer und realistischer Fantastik werden beleuchtet. Während im Romantismus Fantastik im Zentrum steht, nimmt sie im Realismus eine untergeordnete, aber dennoch bedeutsame Rolle ein, die in Relation zu den natürlichen Themen und Motiven des Werkes steht.
3. Die fantastischen Elemente in Storms Schimmelreiter: Dieses Kapitel analysiert die fantastischen Elemente in Storms "Der Schimmelreiter". Der Titel selbst deutet schon auf das zentrale übernatürliche Element hin: den Schimmelreiter als Spukerscheinung, die vor Deichbrüchen warnt. Die Analyse würde hier detailliert auf die Darstellung des Schimmelreiters, seine Funktion innerhalb der Erzählung und seine Bedeutung für das Verständnis der Novelle eingehen. Die Analyse würde aufzeigen, wie das Übernatürliche in den realistischen Kontext der Erzählung eingebettet ist und welche Rolle es für die Handlung, die Charakterentwicklung und die Thematik spielt.
Schlüsselwörter
Literarischer Realismus, Fantastik, Spuk-Motivik, Theodor Storm, Der Schimmelreiter, Theodor Fontane, Effi Briest, Realistische Erzählweise, Übernatürliches, Funktionalisierung von Fantastik, Ideelle Durchdringung, mimetische Darstellung.
Häufig gestellte Fragen zu: Fontanes Effi Briest und Storms Schimmelreiter - Fantastik im literarischen Realismus
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verbindung von Fantastik und Realismus im literarischen Realismus, insbesondere anhand der Spuk-Motive in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" und Theodor Fontanes "Effi Briest". Das Hauptziel ist die Analyse, wie fantastische Elemente in eine realistische Erzählweise integriert und funktionalisiert werden.
Welche Werke werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Theodor Storms "Der Schimmelreiter" und Theodor Fontanes "Effi Briest". Diese Werke wurden aufgrund ihrer ausgeprägten Spuk-Motivik ausgewählt.
Wie werden Fantastik und Realismus in der Arbeit verbunden?
Die Arbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen der realistischen Programmatik der genauen Wiedergabe der Wirklichkeit und dem Auftreten fantastischer Elemente. Sie argumentiert, dass fantastische Elemente, obwohl marginal, im Realismus vorkommen und eine wichtige Rolle in der Erzählweise spielen.
Welche Aspekte der fantastischen Elemente werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Funktion der fantastischen Elemente (Spuk) in der realistischen Erzählweise, die Interpretation und den Vergleich der Spuk-Motivik in beiden Werken, die unterschiedlichen Funktionen des Übernatürlichen in realistischen Texten und die Bedeutung von Fantastik für den Realismus allgemein.
Welche übergreifenden Thesen werden aufgestellt?
Die Arbeit entwickelt Thesen zur Funktionalisierung fantastischer Elemente, unter anderem die Einordnung als Teil der „ideellen Durchdringung“, als „Verklärung, das Poetische“, als „Moraldidaxe über die Verderblichkeit des Aberglaubens“, die Auslagerung und Historisierung der fantastischen Motive sowie die Betrachtung des Irrealen als Bewusstseinsrealität (Traum, Wahnsinn, Halluzination).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die die Einleitung, die Bedeutung fantastischer Motive im Realismus, die Analyse der fantastischen Elemente in "Der Schimmelreiter" und "Effi Briest", sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse umfassen. Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literarischer Realismus, Fantastik, Spuk-Motivik, Theodor Storm, Der Schimmelreiter, Theodor Fontane, Effi Briest, Realistische Erzählweise, Übernatürliches, Funktionalisierung von Fantastik, Ideelle Durchdringung, mimetische Darstellung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Vereinbarkeit von Fantastik und Realismus im literarischen Realismus zu analysieren und die Funktion von fantastischen Elementen in der realistischen Erzählweise zu untersuchen. Sie möchte aufzeigen, wie das Übernatürliche zur realistischen Darstellung beiträgt.
- Quote paper
- Mia Dumont (Author), 2014, Fantastik und Spuk im literarischen Realismus. Das Spuk-Motiv und dessen Funktionen in Storms "Schimmelreiter" und Fontanes "Effi Briest", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294626