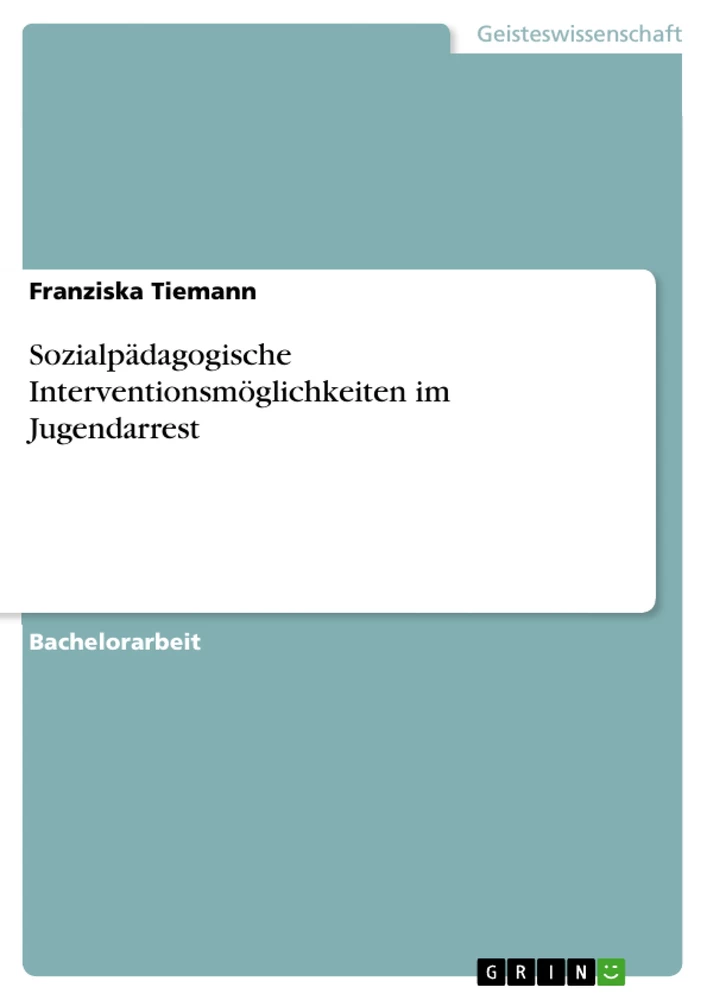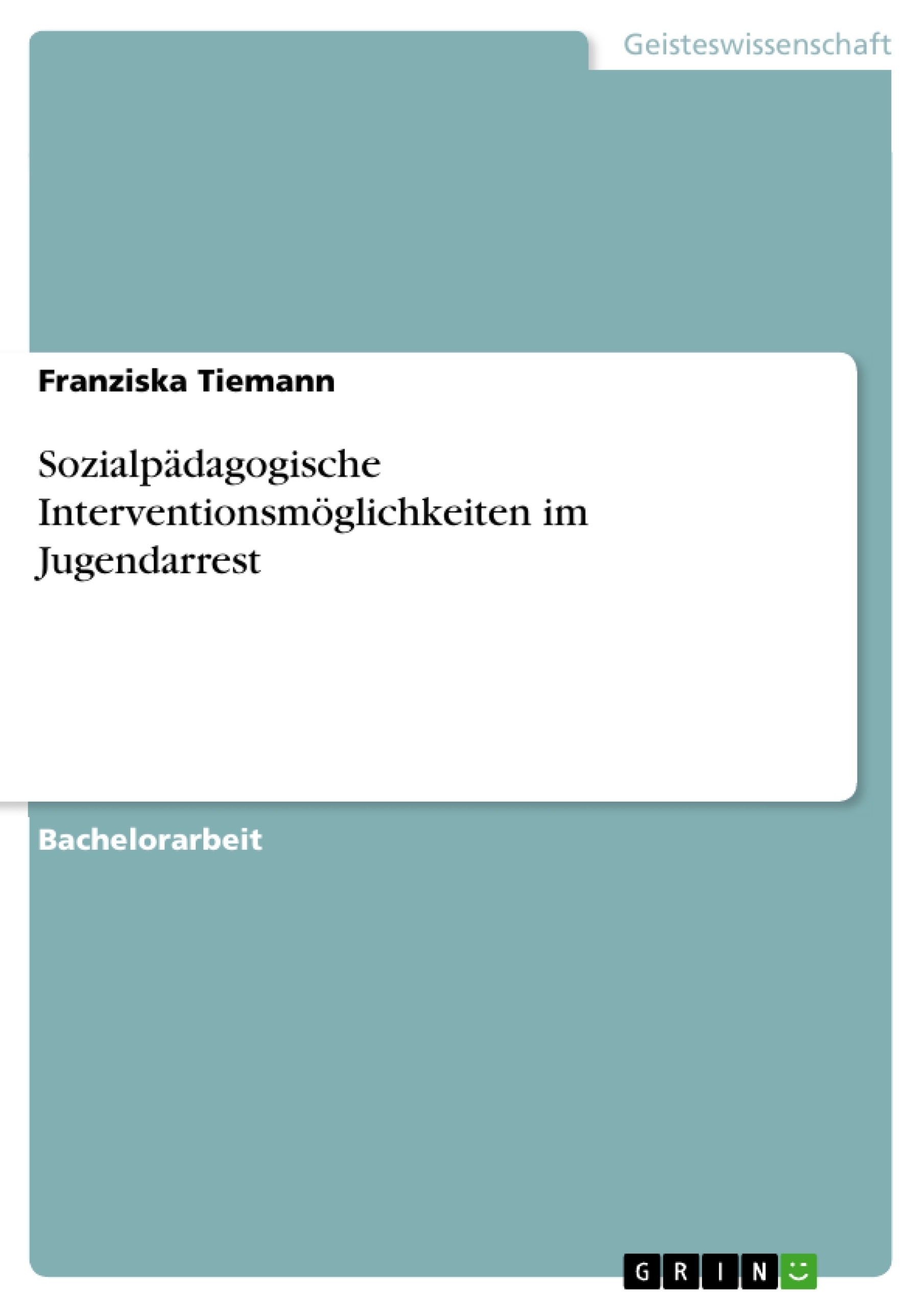Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den sozialpädagogischen Interventionsmöglichkeiten des Jugendarrestes.
Es wird der Frage nachgegangen, ob es Möglichkeiten gibt, den jugendlichen Arrestanten zu fördern und zu unterstützen und um welche es sich dabei handelt, so dass einer weiteren Straffälligkeit vorgebeugt werden kann.
Ziel ist es hierbei zu klären, ob der Jugendarrest in seiner aktuellen Form wirksam ist. Außerdem wird aufgezeigt in welchem Rahmen und unter der Berücksichtigung welcher Faktoren eine sozialpädagogische Intervention möglich ist. Hierfür wird ein Überblick über die Institution Jugendarrest sowie die relevanten gesetzlichen Grundlagen gegeben. Desweiteren werden spezifische sozialpädagogische Maßnahmen aufgezeigt bzw. ausgearbeitet.
Das Thema wird auf der Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen, Fachliteratur und Beiträgen in Fachzeitschriften dargestellt. Analysen bzw. Darstellungen von Experten sowie themenrelevante Dissertationen dienen ebenfalls als Informationsquelle.
Im Ergebnis wird deutlich, dass der Jugendarrest aufgrund seiner aktuellen ungenügenden Wirksamkeit dringend neu aus- und umgestaltet werden muss. Hierfür sind spezifische Standards notwendig, welche eine effektive Soziale Arbeit in den Jugendarrestanstalten gewährleisten. Anhand dieser Standards wird der Rahmen für eine sozialpädagogische Intervention ermöglicht, welcher sich an den Lebensphasen der Jugendlichen orientiert. Für eine effektive und wirksame Arbeit im Jugendarrest ist eine Umgestaltung des Tagesablaufes notwendig, so dass eine adäquate sozialpädagogische Arbeit möglich ist. Auch die Notwendigkeit einer Nachsorgemaßnahme scheint hierbei unabdingbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und zentrale These
- 1.1. Themenstellung und Gegenstandsbereich
- 1.2. Erkenntnisinteresse und Ziel
- 1.3. Lösungsmöglichkeiten
- 1.4. Zentrale These
- 1.5. Methodisches Vorgehen
- 2. Der Jugendarrest in Geschichte und Gesetz
- 2.1. Geschichtliche Entwicklung des Jugendarrestes
- 2.1.1. Ideen pädagogischer Neugestaltung
- 2.1.2. Festlegung des Jugendarrestes im Nationalsozialismus
- 2.1.3. Veränderungen und Entwicklungen bis heute
- 2.2. Jugendarrest im Jugendgerichtsgesetz
- 2.2.1. Definition des Jugendarrestes
- 2.2.2. Ziel und Zielgruppe des Jugendarrestes
- 2.2.3. Jugendarrest als Zuchtmittel
- 2.2.4. Formen des Jugendarrestes
- 2.2.5. Jugendarrest als Ungehorsamsarrest
- 2.2.6. Jugendarrest als Warnschussarrest
- 2.2.7. Verbindung von Jugendarrest mit anderen Maßnahmen
- 2.2.8. Der Vollzug des Jugendarrestes
- 2.3. Vorläufiges Fazit
- 3. Negative Wirkung des Jugendarrestes?
- 3.1. Rückfallstatistiken
- 3.2. Rückfallbegünstigende Faktoren
- 3.3. Vorläufiges Fazit
- 4. Mindeststandards zum Jugendarrestvollzug
- 4.1. Subsidiaritätsprinzip
- 4.2. Absehen von der Vollstreckung
- 4.3. Der Begriff Jugendarrest
- 4.4. Zielbestimmung
- 4.5. Gestaltung des Jugendarrestes
- 4.6. Mitwirkung und Motivation des Jugendlichen
- 4.7. Anstaltsform und Räumlichkeiten
- 4.8. Freie Formen des stationären sozialen Trainings
- 4.9. Klima im Jugendarrest
- 4.10. Unterkunft
- 4.11. Anteilige Öffnung des stationären sozialen Trainings
- 4.12. Qualifikation des Personals
- 4.13. Vernetzung und Kooperation
- 4.14. Nachsorgemaßnahmen
- 4.15. Zwang im Jugendarrest
- 4.16. Maßnahmen zur Disziplinierung
- 4.17. Rechtsmittel
- 4.18. Kostenerstattung
- 4.19. Wissenschaftliche Evaluation
- 5. Anwendung der Mindeststandards und deren Möglichkeiten in der Praxis
- 5.1. Bezeichnung Jugendarrest
- 5.2. Zielbestimmungen
- 5.3. Ausgestaltung des Jugendarrestes
- 5.3.1. Anpassung der Form der Unterbringung
- 5.3.2. Intensives und erzieherisches Förderprogramm
- 5.3.3. Erstellung einer sozialpädagogischen Diagnostik
- 5.3.4. Fallabhängige Nachsorgemaßnahmen
- 5.4. Stationäres Training statt Jugendarrest?
- 5.5. Vernetzung und Kooperation
- 5.6. Personal
- 5.7. Wissenschaftliche Evaluation
- 5.8. Vorläufiges Fazit
- 6. Jugendkriminalität und die Lebensphase Jugend
- 6.1. Jugendkriminalität
- 6.2. Die Lebensphase Jugend
- 6.2.1. Abhängigkeit und Autonomie
- 6.2.2. Körperliche Entwicklung
- 6.2.3. Kognitive Entwicklung
- 6.2.4. Identität
- 6.2.5. Aufbau von Peer-Kontakten
- 6.2.6. Freizeit und Freizeitorte
- 6.2.7. Umgang mit Schule
- 6.2.8. Berufswahl und Berufsausbildung
- 6.2.9. Werthaltung und Partizipation
- 6.3. Vorläufiges Fazit
- 7. Sozialpädagogische Ausgestaltung des Tagesablaufes im Jugendarrest
- 7.1. Chancen eines sozialpädagogischen Tagesplans
- 7.2. Bedeutung des Personals
- 7.3. Einladungsschreiben
- 7.4. Möglicher sozialpädagogischer Tagesablauf
- 7.5. Tag der Anreise
- 7.6. Tagesthemen
- 7.7. Beschreibung der Tageselemente
- 7.7.1. Mahlzeiten
- 7.7.2. Ruhezeiten
- 7.7.3. Einzelarbeiten zu den Tagesthemen
- 7.7.4. Die Reflexion des Tagesthemas in der Gruppe
- 7.7.5. Einzelgespräche
- 7.7.6. Freizeitgestaltung
- 7.8. Bedeutung der sozialpädagogischen Diagnose
- 7.9. Evaluation
- 7.10. Vorläufiges Fazit
- 8. Möglichkeiten der Nachsorge als sozialpädagogische Interventionsmaßnahme
- 8.1. Nachsorge als Forderung der Fachkommission
- 8.2. Bedeutung von Vernetzung und Kooperation
- 8.3. Rolle der Jugendgerichtshilfe
- 8.4. Bereiche der Nachsorge
- 8.4.1. Arbeit und Ausbildung
- 8.4.2. Wohnung
- 8.4.3. Soziale Kompetenzen und Lebenspraktische Fertigkeiten
- 8.4.4. Wirtschaftliche Situation
- 8.4.5. Familiäre und soziale Situation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die sozialpädagogischen Interventionsmöglichkeiten im Jugendarrest. Das Hauptziel besteht darin, die Wirksamkeit des Jugendarrests in seiner derzeitigen Form zu evaluieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie jugendliche Arrestanten gefördert und unterstützt werden können, um zukünftige Straftaten zu verhindern. Die Arbeit beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen und die institutionellen Rahmenbedingungen des Jugendarrests.
- Wirksamkeit des Jugendarrests
- Sozialpädagogische Intervention im Jugendarrest
- Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen
- Möglichkeiten der Nachsorge
- Gestaltung eines effektiven Tagesablaufs im Jugendarrest
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und zentrale These: Die Einleitung beschreibt die Problemstellung und das Erkenntnisinteresse der Arbeit. Sie stellt die zentrale These vor, dass der Jugendarrest in seiner aktuellen Form unzureichend ist und einer umfassenden Reform bedarf, um eine effektive sozialpädagogische Intervention zu ermöglichen. Das methodische Vorgehen wird skizziert, welches auf gesetzlichen Bestimmungen, Fachliteratur und Expertenmeinungen basiert.
2. Der Jugendarrest in Geschichte und Gesetz: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Jugendarrests, seine rechtliche Verankerung im Jugendgerichtsgesetz (JGG), sowie seine verschiedenen Formen und Zielsetzungen. Es analysiert den Jugendarrest als Zuchtmittel und diskutiert seine Anwendung im Kontext anderer Jugendstrafmaßnahmen. Der Fokus liegt auf der gesetzlichen Definition und den Vollzugsmodalitäten.
3. Negative Wirkung des Jugendarrestes?: Kapitel 3 untersucht kritisch die Effektivität des Jugendarrests. Es werden Rückfallstatistiken analysiert und Faktoren identifiziert, die Rückfälligkeit begünstigen. Die Diskussion konzentriert sich auf die Frage, ob der Jugendarrest in seiner aktuellen Form mehr schadet als nützt und welche negativen Auswirkungen er auf junge Menschen hat.
4. Mindeststandards zum Jugendarrestvollzug: Dieses Kapitel entwickelt Mindeststandards für einen effektiven und sozialpädagogisch ausgerichteten Jugendarrestvollzug. Es betont die Bedeutung von Subsidiarität, der Vermeidung von Vollstreckung, einer angepassten Anstaltsgestaltung, der Qualifikation des Personals und der Notwendigkeit von Nachsorgemaßnahmen. Es geht um die Schaffung eines positiven und förderlichen Umfelds.
5. Anwendung der Mindeststandards und deren Möglichkeiten in der Praxis: Kapitel 5 beschreibt die praktische Umsetzung der in Kapitel 4 entwickelten Mindeststandards. Es beleuchtet die Herausforderungen bei der Integration dieser Standards in den bestehenden Vollzug und zeigt Möglichkeiten der Anpassung der Unterbringung, der Entwicklung intensiver Förderprogramme und der Bedeutung von Vernetzung und Kooperation auf.
6. Jugendkriminalität und die Lebensphase Jugend: Kapitel 6 untersucht den Zusammenhang zwischen Jugendkriminalität und den Entwicklungsprozessen in der Jugendphase. Es analysiert die sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklungsaspekte Jugendlicher und ihren Einfluss auf das kriminelle Verhalten. Es werden Faktoren wie Abhängigkeit, Autonomie, Peer-Gruppen und der Umgang mit Schule beleuchtet.
7. Sozialpädagogische Ausgestaltung des Tagesablaufes im Jugendarrest: Dieses Kapitel entwickelt einen beispielhaften sozialpädagogischen Tagesablauf für den Jugendarrest. Es legt den Fokus auf die Bedeutung eines strukturierten Tagesablaufs, der individuellen Förderung und der Einbeziehung sozialpädagogischer Elemente wie Einzelgespräche und Gruppenreflexionen. Die Rolle des Personals und die Bedeutung einer sozialpädagogischen Diagnose werden hervorgehoben.
8. Möglichkeiten der Nachsorge als sozialpädagogische Interventionsmaßnahme: Das Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung von Nachsorgemaßnahmen nach dem Jugendarrest. Es betont die Notwendigkeit von Vernetzung und Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen und die Rolle der Jugendgerichtshilfe. Es werden verschiedene Bereiche der Nachsorge wie Arbeit, Wohnung, soziale Kompetenzen und die wirtschaftliche Situation beleuchtet.
Schlüsselwörter
Jugendarrest, Jugendkriminalität, Sozialpädagogische Intervention, Jugendgerichtsgesetz, Rückfall, Mindeststandards, Nachsorge, Tagesablauf, Vernetzung, Kooperation, Förderung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Sozialpädagogische Interventionsmöglichkeiten im Jugendarrest
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die sozialpädagogischen Interventionsmöglichkeiten im Jugendarrest. Das Hauptziel ist die Evaluierung der Wirksamkeit des Jugendarrests in seiner derzeitigen Form und die Aufzeigen von Möglichkeiten zur Förderung und Unterstützung jugendlicher Arrestanten zur Prävention zukünftiger Straftaten. Die Arbeit beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen und institutionellen Rahmenbedingungen des Jugendarrests.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Wirksamkeit des Jugendarrests, sozialpädagogische Intervention im Jugendarrest, gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen, Möglichkeiten der Nachsorge und die Gestaltung eines effektiven Tagesablaufs im Jugendarrest.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung mit zentraler These, historische und rechtliche Entwicklung des Jugendarrests, kritische Untersuchung der negativen Auswirkungen des Jugendarrests, Entwicklung von Mindeststandards für den Jugendarrestvollzug, praktische Umsetzung der Mindeststandards, Zusammenhang zwischen Jugendkriminalität und der Lebensphase Jugend, sozialpädagogische Ausgestaltung des Tagesablaufs im Jugendarrest und Möglichkeiten der Nachsorge als sozialpädagogische Interventionsmaßnahme.
Welche zentralen Thesen werden aufgestellt?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass der Jugendarrest in seiner aktuellen Form unzureichend ist und einer umfassenden Reform bedarf, um eine effektive sozialpädagogische Intervention zu ermöglichen.
Welche Methoden werden verwendet?
Das methodische Vorgehen basiert auf gesetzlichen Bestimmungen, Fachliteratur und Expertenmeinungen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Mindeststandards für einen effektiven und sozialpädagogisch ausgerichteten Jugendarrestvollzug, einen beispielhaften sozialpädagogischen Tagesablauf und zeigt Möglichkeiten der Nachsorge auf. Die Ergebnisse basieren auf der Analyse von Rückfallstatistiken, der gesetzlichen Bestimmungen und der Diskussion der Fachliteratur.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht die Schlussfolgerung, dass der Jugendarrest umfassend reformiert werden muss, um seine sozialpädagogischen Potenziale zu nutzen und die Rückfallquote zu senken. Dies beinhaltet die Implementierung der entwickelten Mindeststandards und eine verstärkte Fokussierung auf Nachsorgemaßnahmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendarrest, Jugendkriminalität, Sozialpädagogische Intervention, Jugendgerichtsgesetz, Rückfall, Mindeststandards, Nachsorge, Tagesablauf, Vernetzung, Kooperation, Förderung, Prävention.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Inhaltsverzeichnis am Anfang der Arbeit bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel mit ihren jeweiligen Inhalten. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine prägnante Übersicht der einzelnen Kapitel.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Jugendhilfesystem, Juristen, Pädagogen, sowie für alle, die sich mit dem Thema Jugendkriminalität und dem Jugendarrest auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Franziska Tiemann (Auteur), 2014, Sozialpädagogische Interventionsmöglichkeiten im Jugendarrest, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294642