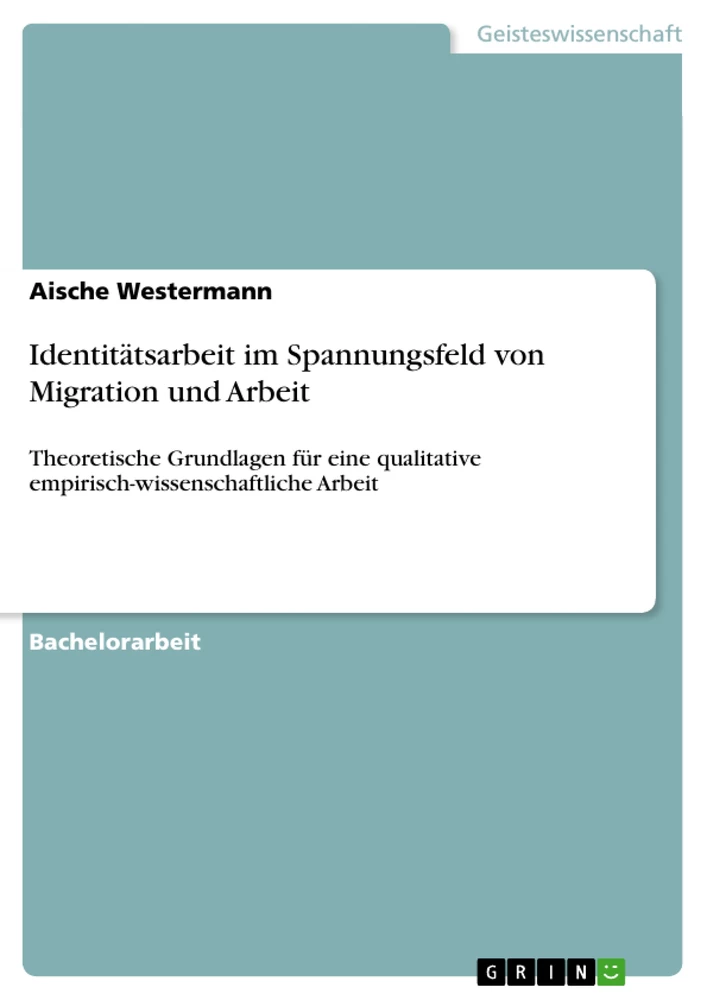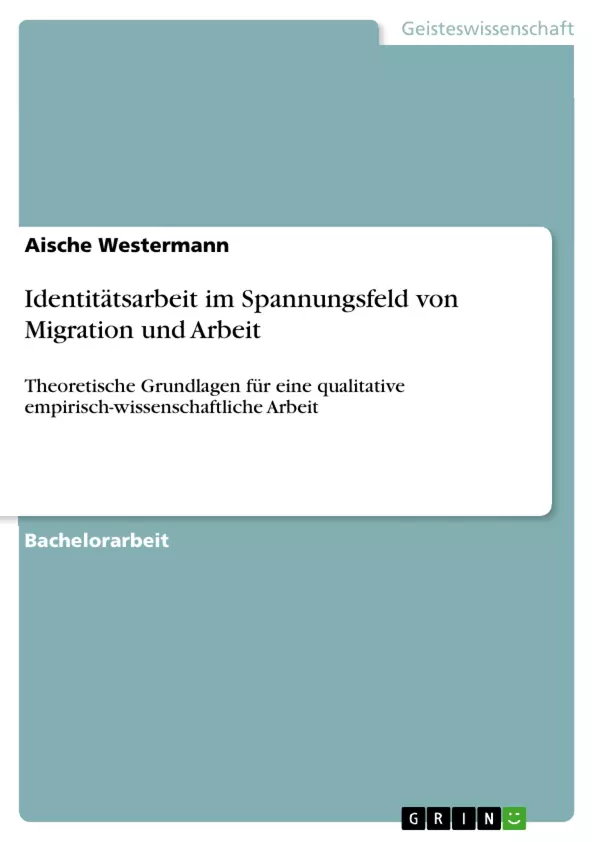Menschen mit Migrationshintergrund machen 19 % der deutschen Bevölkerung aus. Für den Großteil ist ihre Zugehörigkeit zu Deutschland selbstverständlich und sie haben einen offenen und leistungsorientierten Lebensstil. Nur ein geringer Teil lebt völlig abgewandt von der Mehrheitsgesellschaft. Die Motivation, Teil der deutschen Gesellschaft sein zu wollen und sich als ein solches zu sehen steht im starken Widerspruch zu statistisch eindeutigen
Ungleichheiten im Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsbereich. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben im Verhältnis zu jenen ohne Migrationshintergrund
durchschnittlich schlechtere Schulabschlüsse oder gar keinen Schulabschluss. Im Berufsleben arbeiten sie häufiger in schlecht bezahlten oder von Stellenabbau bedrohten Jobs und sie sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich in der Regel im Berufsleben belasteter als Menschen ohne Migrationshintergrund.
Inklusion in Sinne von gleichberechtigten Teilhabechancen wie Menschen ohne Migrationshintergrund ist so für viele Menschen mit Migrationshintergrund nicht gegeben. Ein Teil
der Menschen mit Migrationshintergrund erlebt hierdurch herkunftsbezogenen Akkulturationsstress, der auf Ablehnung durch die Gesellschaft begründet ist und ihre
Kompensationsressourcen überfordert, ein anderer Teil lernt mit der Situation aufgrund des Migrationshintergrundes eine schlechtere Ausgangsposition zu besitzen umzugehen und ein
anderer Teil fühlt sich von den Benachteiligungen nicht betroffen. Menschen mit Migrationshintergrund scheinen daher einerseits unterschiedliche Erfahrungen zu machen
und andererseits unterschiedliche Wege der Verarbeitung ihrer Erfahrungen zu haben. Die Art der Verarbeitung von Erfahrungen, die Identitätsarbeit, im Berufsleben und deren
Auswirkung auf das Individuum und dessen weitere Lebensbereiche hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Hierzu gehören die Kapitalien nach Bourdieu,
Staatsbürgerlichen Rechte, die verschiedenen Wahrnehmungsebenen des Menschen, Akkulturationsstress und wie sie im Laufe des Lebens auf den Menschen wirken. Sie können mittels qualitativer Interviews erhoben und anhand Narrativer Analysen, der Analyse Narrativer Identität und Konstrukten aus der Identitätsarbeit ausgewertet werden, sodass ein Bild der „Identitätsarbeit im Spannungsfeld von Migration und Arbeit“ entstehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Erster Teil: Definitionen migrationspolitischer und rechtlicher Begrifflichkeiten sowie soziostrukturelle Positionierungen von Menschen mit Migrationshintergrund
- Begriffsbestimmungen
- Migration und Menschen mit Migrationshintergrund
- Ausländer
- Arbeit
- Arbeitslosigkeit
- Bildung
- Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland
- Vergesellschaftung und Chancen auf Teilhabe
- Die Kapitalien des Menschen nach Bourdieu
- Wie kann ein „Ausländer" ein „Inländer" werden? Assimilation, Integration und Inklusion
- Vom sichtbar und unsichtbar sein - Assimilation
- ,,Irgendwie“ dabei sein – Integration
- Ich-Sein in allen Bezügen – Inklusion
- Zusammenfassende Diskussion
- Der Einfluss von Kultur und Struktur als Einfluss auf gesellschaftliche Positionierungen in Deutschland
- Die SINUS-Sociovision-Studie – Migranten-Milieus in Deutschland und das Dossier der „Heymat"-Arbeitsgruppe Foroutan, Schäfer, Canan und Schwarze
- Zusammenfassung
- Begriffsbestimmungen
- Zweiter Teil: Die Bedeutung von Arbeit für die Teilhabe an der Gesellschaft unter Einbezug des Migrationshintergrundes
- Arbeit und Bildung in unserer Gesellschaft
- Arbeit als Voraussetzung zur Teilhabe an der Gesellschaft
- Bildungsverläufe bei Menschen mit Migrationshintergrund
- Schulbildung
- Ausbildung und berufliche Entwicklung
- Zusammenfassende Diskussion.
- Arbeit und Bildung in unserer Gesellschaft
- Dritter Teil: Wissenschaftliche Konzeptionen von Identität und Identitätsarbeit
- Möglichkeiten wissenschaftlicher Konzeption von Identität und Identitätsarbeit
- Das Forschungsprojekt „Identitätskonstruktionen - Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne“ von Keupp, Ahbe, Gmür, Höfer, Mitzscherlich, Kraus und Straus
- Identität ein theoretisches Konzept
- Die Kapitalarten nach Bourdieu als Moderatoren der Identitätsarbeit
- Identitätsarbeit als narrativer Aushandlungsprozess
- Hybride Identitäten und Dritter Stuhl – Konzepte zur Beschreibung von multikultureller Zugehörigkeiten und Identitätsarbeit
- Diskussion und Umgang mit den Theorien zur Identitätsarbeit
- Möglichkeiten wissenschaftlicher Konzeption von Identität und Identitätsarbeit
- Vierter Teil: Forschungsmethodischer Zugang
- Methodischer Zugang
- Paradigmen Qualitativer Forschung
- Wissenschaftliche Forschungskriterien in der Qualitativen Forschung
- Diskussion
- Narrative Analysen
- Auswertung von narrativem Interviewmaterial
- Analyse Narrativer Identität
- Zusammenfassende Diskussion
- Methodischer Zugang
- Fünfter Teil: Zusammenführung der drei Themengebiete und erarbeiten Forschungsansätze
- Abschließende Zusammenführung forschungsmethodischer Zugänge zu Identitätsarbeit, Arbeit und Migration
- Tabellarischer Überblick der zusammengeführten Forschungszugänge
- Fazit
- Persönliche Schlussfolgerungen
- Danksagung
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Literatur
- Abschließende Zusammenführung forschungsmethodischer Zugänge zu Identitätsarbeit, Arbeit und Migration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit der Identitätsarbeit von Menschen mit Migrationshintergrund im Spannungsfeld von Arbeit und Migration. Ziel der Arbeit ist es, theoretische Grundlagen für qualitative empirisch-wissenschaftliche Arbeiten zu schaffen, die sich mit der Thematik der Identitätsarbeit im Kontext von Migration und Arbeit auseinandersetzen. Die Arbeit analysiert die relevanten migrationspolitischen und rechtlichen Begrifflichkeiten sowie die soziostrukturelle Positionierung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Darüber hinaus werden die Bedeutung von Arbeit für die Teilhabe an der Gesellschaft und die wissenschaftlichen Konzeptionen von Identität und Identitätsarbeit beleuchtet.
- Migrationspolitische und rechtliche Begrifflichkeiten
- Soziostrukturelle Positionierung von Menschen mit Migrationshintergrund
- Bedeutung von Arbeit für die Teilhabe an der Gesellschaft
- Wissenschaftliche Konzeptionen von Identität und Identitätsarbeit
- Forschungsmethodischer Zugang zur Identitätsarbeit im Kontext von Migration und Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätsarbeit im Spannungsfeld von Arbeit und Migration ein und erläutert die Relevanz des Themas. Der Aufbau der Arbeit wird vorgestellt und die einzelnen Kapitel werden kurz zusammengefasst. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Definition migrationspolitischer und rechtlicher Begrifflichkeiten sowie der soziostrukturellen Positionierung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Es werden die Begriffe Migration, Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer, Arbeit, Arbeitslosigkeit und Bildung definiert und die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland beleuchtet. Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Bedeutung von Arbeit für die Teilhabe an der Gesellschaft unter Einbezug des Migrationshintergrundes. Es wird die Rolle von Arbeit als Voraussetzung zur Teilhabe an der Gesellschaft analysiert und die Bildungsverläufe von Menschen mit Migrationshintergrund werden betrachtet. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich den wissenschaftlichen Konzeptionen von Identität und Identitätsarbeit. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zur Beschreibung von Identität und Identitätsarbeit vorgestellt, darunter das Forschungsprojekt „Identitätskonstruktionen - Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne“ von Keupp, Ahbe, Gmür, Höfer, Mitzscherlich, Kraus und Straus. Der vierte Teil der Arbeit befasst sich mit dem forschungsmethodischen Zugang zur Identitätsarbeit im Kontext von Migration und Arbeit. Es werden die Paradigmen der qualitativen Forschung, die wissenschaftlichen Forschungskriterien in der qualitativen Forschung und die narrative Analyse vorgestellt. Der fünfte Teil der Arbeit führt die drei Themengebiete zusammen und erarbeitet Forschungsansätze. Es wird ein tabellarischer Überblick der zusammengeführten Forschungszugänge gegeben und ein Fazit gezogen. Abschließend werden persönliche Schlussfolgerungen gezogen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Identitätsarbeit, Migration, Arbeit, Menschen mit Migrationshintergrund, Integration, Inklusion, Assimilation, Bildung, Teilhabe, Gesellschaft, Soziostrukturelle Positionierung, Qualitative Forschung, Narrative Analyse, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Bachelor-Thesis?
Die Arbeit schafft theoretische Grundlagen zur Untersuchung der Identitätsarbeit von Menschen mit Migrationshintergrund im Spannungsfeld von Arbeit und Migration.
Welche Rolle spielen die "Kapitalien nach Bourdieu"?
Sie dienen als Moderatoren der Identitätsarbeit und erklären, wie soziale, kulturelle und ökonomische Ressourcen die Teilhabechancen beeinflussen.
Was wird unter "Akkulturationsstress" verstanden?
Es beschreibt die psychische Belastung, die durch Ablehnung der Gesellschaft oder Schwierigkeiten bei der Anpassung an eine neue Kultur entsteht.
Wie unterscheiden sich Assimilation, Integration und Inklusion?
Die Arbeit diskutiert diese Konzepte: von der völligen Anpassung (Assimilation) über die Teilhabe (Integration) bis hin zur gleichberechtigten Einbeziehung (Inklusion).
Was ist "Narrative Identität"?
Ein Konzept, bei dem Identität als ein fortlaufender Prozess des Geschichtenerzählens und Aushandelns der eigenen Biografie verstanden wird.
- Citation du texte
- Aische Westermann (Auteur), 2011, Identitätsarbeit im Spannungsfeld von Migration und Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294673