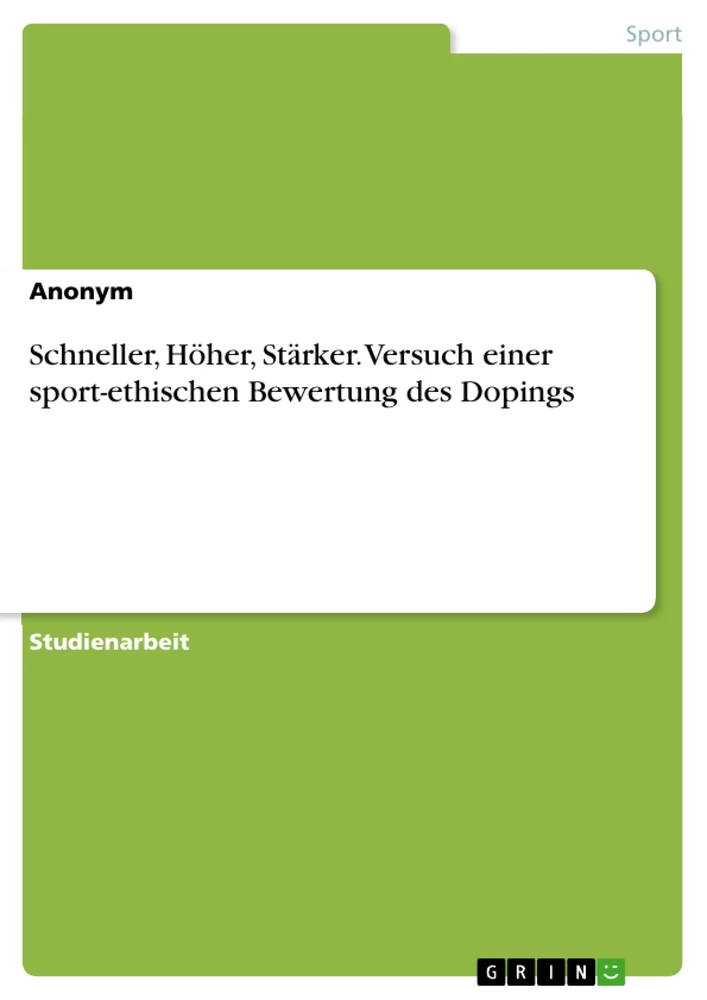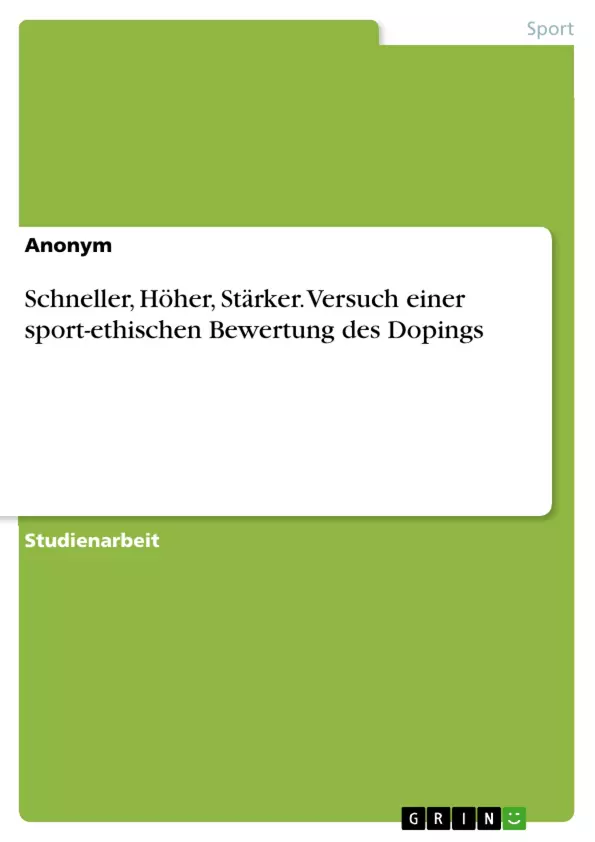Kaum ein sportliches Großereignis der letzten Jahre kam ohne Doping-Fälle aus, neben der Euphorie über neue Rekorde und Bestzeiten kommt zumeist unmittelbar der Verdacht von Manipulation auf. Geradezu überrascht sind Publikum und Presse, wenn der Doping-Test eines Olympia- oder Tour de France-Siegers negativ ausfällt. Sämtliche Olympiasieger im 100m-Sprint seit 1984 wurden (mit Ausnahme von Donovan Bailey und Usain Bolt) früher oder später mit Doping in Verbindung gebracht. Doping - so scheint es - ist in den meisten Sportarten trotz Verboten eher die Regel als die Ausnahme.
Vor dem Hintergrund von Doping-Verboten und der Tatsache, dass Doping in der öffentlichen Wahrnehmung als „unfair“, „unsportlich“ oder schlicht als „falsch“ empfunden wird, stellt sich die Frage, wie der Sachverhalt ethisch zu bewerten ist. Als Teilbereich der Angewandten Ethik ist es die Aufgabe der Sportethik die ethisch relevanten Dimensionen des Sports, sowie seine Moral zu reflektieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Zusatz „angewandt“: Es geht in den verschiedenen Bereichsethiken der Angewandten Ethik nicht allein um eine Betrachtung vorhanderer Situationen und deren ethische Bewertung „von außen“. Vielmehr ist Angewandte Ethik „wesensmäßig praxis- oder anwendungsbezogen“. „Ethik wird nach dem teleologischen Verständnis von »angewandt« folglich danach bemessen, inwiefern es ihr gelingt, moralische Normen in der Praxis fruchtbar zu machen und darin zu implementieren.“
In Bezug auf die die sportethische Reflexion des Dopings stellt sich also die Frage, inwieweit die Ergebnisse in eine praktische Anwendung überführt werden können und damit zur Verhinderung unerwünschter ethischer Konsequenzen im sportlichen Wettstreit beitragen.
So banal es zunächst klingen mag, halte ich es für notwendig zunächst zu klären, was unter den Begriffen Sport und Doping zu verstehen ist. Abhängig davon, was man unter dem Begriff Sport fasst, knüpfen sich an diese Vorstellung auch unterschiedliche Auffassungen der Ethik. In einem ersten Schritt meiner Arbeit werde ich daher den Versuch anstellen eine möglichst umfassende Definition von Sport zu finden. Anschließend halte ich einen kurzen sportphilosophischen Exkurs für sinnvoll. Die Frage nach der ethischen Bewertung des Sports knüpft sich nicht zuletzt auch an die Frage welchen gesellschaftlichen Stellenwert man dem Sport insgesamt zuschreibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sport
- Begriffsdefinition
- Exkurs Sportphilosophie
- Doping
- Begriffsdefinition
- Ethische Bewertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der ethischen Bewertung des Dopings im Sport. Ziel ist es, die ethischen Dimensionen des Dopings im Kontext des Sports zu beleuchten und die Frage zu beantworten, inwieweit die Ergebnisse der ethischen Reflexion in die Praxis überführt werden können, um einen dopingfreien Sport zu fördern.
- Begriffsdefinition von Sport und Doping
- Ethische Argumente für und gegen Doping
- Die Rolle der Sportphilosophie in der ethischen Bewertung des Sports
- Die Bedeutung der Angewandten Ethik für die Praxis des Sports
- Möglichkeiten und Grenzen der ethischen Reflexion im Kampf gegen Doping
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Dopings im Sport ein und stellt die Relevanz der ethischen Bewertung des Dopings heraus. Sie beleuchtet die Problematik des Dopings im Kontext von sportlichen Großereignissen und stellt die Frage nach der ethischen Bewertung des Dopings im Rahmen der Angewandten Ethik.
Das Kapitel „Sport“ befasst sich mit der Begriffsdefinition von Sport und untersucht verschiedene Definitionen von Sport im Hinblick auf ihre Relevanz für die ethische Bewertung des Dopings. Es wird die Frage nach der Zweckfreiheit des Sports im Kontext des Leistungssports diskutiert und die Bedeutung des Sports als Wirtschaftszweig beleuchtet.
Das Kapitel „Doping“ widmet sich der Begriffsdefinition von Doping und stellt verschiedene ethische Argumente für und gegen Doping vor. Es werden die ethischen Implikationen des Dopings im Hinblick auf Fairness, Gesundheit und die Integrität des Sports diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sport, Doping, Sportethik, Angewandte Ethik, Fairness, Gesundheit, Integrität, Leistungssport, Zweckfreiheit, Wirtschaftszweig, ethische Bewertung, praktische Anwendung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Schneller, Höher, Stärker. Versuch einer sport-ethischen Bewertung des Dopings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294824