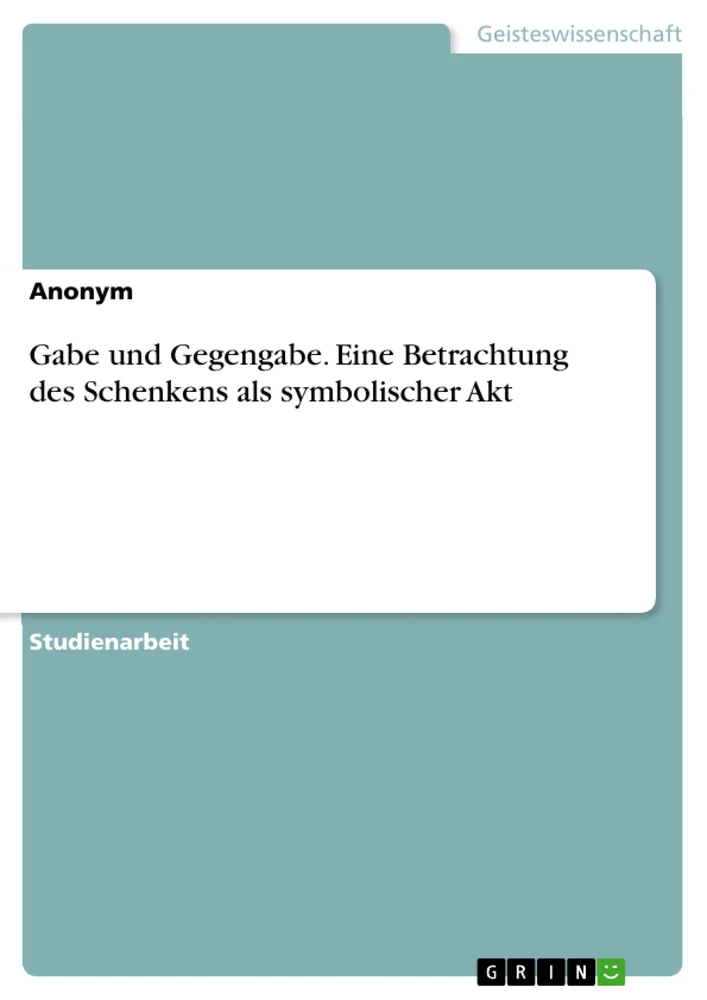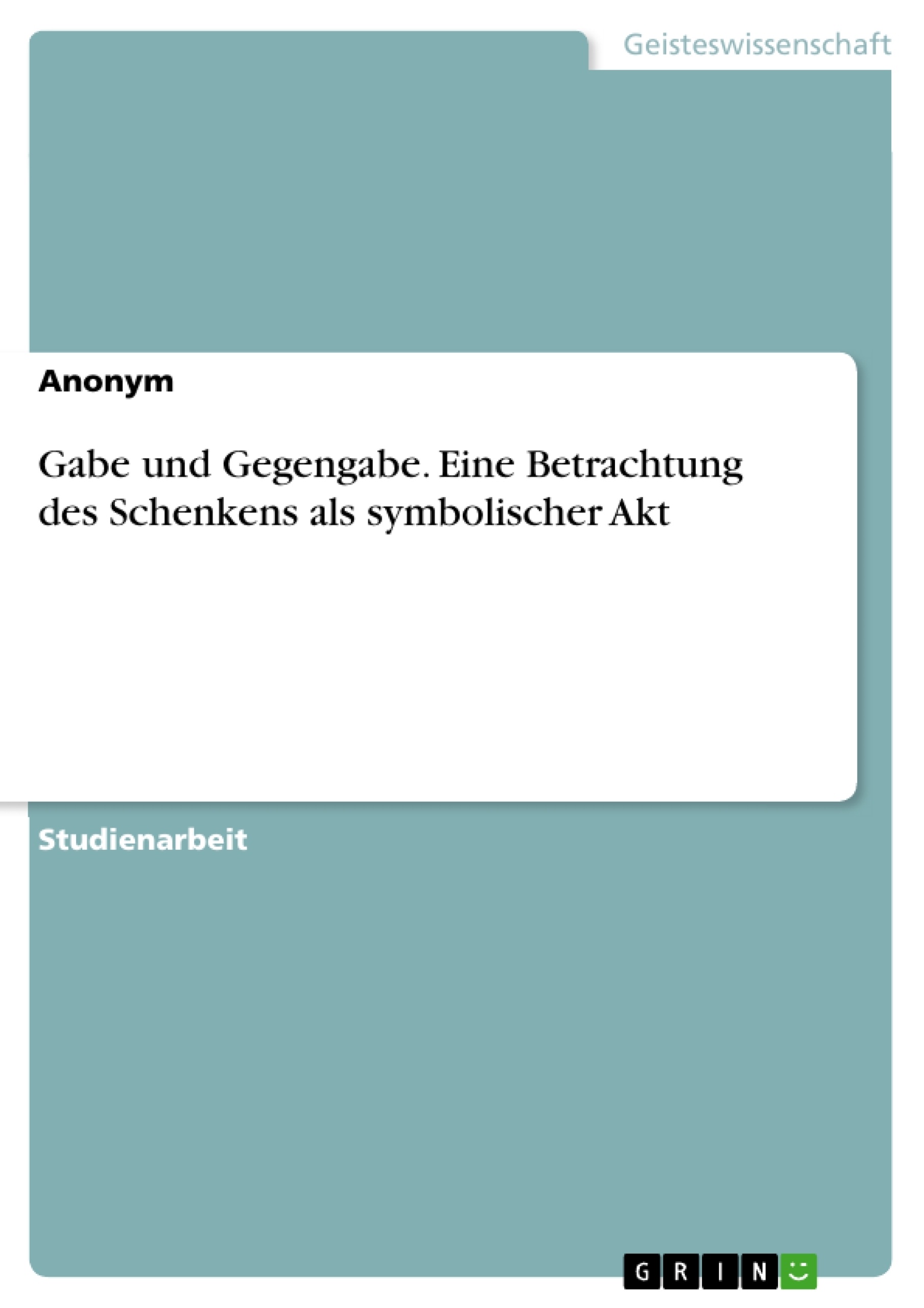Gaben und Geschenke sind im gesamten menschlichen Leben gegenwärtig. Der Alltag ist durchzogen von Anlässen, zu denen geschenkt wird oder man Geschenke erhält. In nahezu allen Nationen und Kulturen existieren derlei Anlässe. Dabei denken die Akteure zumeist weniger darüber nach, ob sie schenken, das erscheint obligatorisch, sondern sie überlegen, was sie schenken sollen. Die Entscheidung darüber knüpft sich an das Verhältnis, welches die jeweiligen Personen verbindet und den Anlass, zu welchem das Geschenk überreicht werden soll.
Durch den offenbar teils verpflichtenden Charakter des Schenkvorgangs, wird die Auswahl des Geschenkes dabei erschwert - ein Problem, welchem verschiedene Anbieter und Internetshops zu begegnen versuchen: „Findige Akteure schaffen mittels moderner Technologie Abhilfe - (zum Beispiel: www.schenken.net 15.07.2011) - indem sie den Verzweifelten ihre Hilfe bei der Geschenkauswahl anbieten. Interessierte können nicht nur Geschenkideen einholen, sondern das passende Geschenk zum jeweiligen Anlass für eine bestimmte Person (Ehemann/-frau, Freund_in, Mutter, Chef et al) auswählen, käuflich erwerben und den Adressaten zusenden lassen.“
In seiner Minima Moralia bezeichnet Theodor Adorno die Erfindung solcher Geschenkartikel als Indiz für den „Verfall des Schenkens“: „Der Verfall des Schenkens spiegelt sich in der peinlichen Erfindung der Geschenkartikel, die bereits darauf angelegt sind, daß man nicht weiß, was man schenken soll, weil man es eigentlich garnicht will.“
Es stellt sich also die Frage, wie ein Ritual wie das Schenken - welches zunächst eher unscheinbar und zwanglos wirkt - eine derartige Zwangssituation schaffen kann, in der sich Menschen dazu verpflichtet fühlen Geschenke zu machen, auch wenn ihnen nicht der Sinn danach steht. Gleichzeitig zeigt sich in dem zuletzt genannten Zitat, dass offenbar eine bestimmte Vorstellung davon herrscht, wie „wahrhaftes“ - also noch nicht dem „Verfall“ anheim gefallenes - Schenken auszusehen hätte.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich daher den Versuch unternehmen, die gesellschaftliche Bedeutung von Geschenken und Gaben zu beleuchten. Vor dem Hintergrund des Seminarthemas werde ich dabei versuchen einen besonderen Fokus auf Geschenke und Gaben als Symbole bzw. das Schenken als symbolischen Akt zu legen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Symbole
- 2.1 Ein Definitionsversuch
- 2.2 Gaben als Symbole
- 3. Die Gabe
- 3.1 Die Herrschaft des Ceremoniells - Herbert Spencer
- 3.2 Die Gabe als totale soziale Tatsache
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftliche Bedeutung von Geschenken und Gaben, insbesondere unter dem Aspekt des Schenkens als symbolischen Akt. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Symbolbegriff und der Praxis des Schenkens, wobei die Theorie von Marcel Mauss als zentrale Schnittstelle dient. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Schenkens und untersucht das Spannungsverhältnis zwischen dem Idealbild der Gabe und der alltäglichen Praxis des Schenkens.
- Der Symbolbegriff und seine Anwendung auf das Schenken
- Die Theorie der Gabe nach Marcel Mauss
- Historische Entwicklung des Schenkens
- Das Idealbild der Gabe im Vergleich zur alltäglichen Praxis
- Der „Verfall des Schenkens“ im Kontext moderner Konsumgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die allgegenwärtige Präsenz von Gaben und Geschenken im menschlichen Leben. Sie hebt die scheinbar obligatorische Natur des Schenkens hervor und stellt die Problematik der Geschenkauswahl in den Vordergrund. Mittels des Zitats von Theodor Adorno wird der „Verfall des Schenkens“ in der modernen Gesellschaft thematisiert und die Notwendigkeit einer soziologischen Untersuchung des Schenkens als symbolischen Akts begründet. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die gesellschaftliche Bedeutung von Gaben und Geschenken zu beleuchten, wobei ein besonderer Fokus auf den symbolischen Aspekt gelegt wird. Die Verwendung der Theorie von Marcel Mauss als Brücke zwischen Symbolbegriff und Gabe wird angekündigt, ebenso wie eine kurze Betrachtung der historischen Entwicklung des Schenkens.
2. Symbole: Dieses Kapitel befasst sich mit dem vielschichtigen Begriff des Symbols. Es wird die Schwierigkeit einer präzisen Definition herausgestellt, unter Verweis auf Klaus F. Röhl, der die „Unbegrifflichkeit“ des Symbols betont. Anschließend wird die Definition von Ernst Cassirer herangezogen, der das Symbol als Verbindung von geistigem Bedeutungsgehalt und sinnlichem Zeichen versteht. Cassirers Konzept des „Symbolnetzes“ als grundlegenden Unterschied zwischen Mensch und Tier wird erläutert, wobei das Reiz-Reaktions-Schema der Tiere dem menschlichen Symbolgebrauch gegenübergestellt wird. Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse des Schenkens als symbolischer Akt.
3. Die Gabe: Das Kapitel widmet sich der Gabe selbst. Es beginnt mit einer kurzen Betrachtung der historischen Entwicklung des Schenkens, um ein Verständnis für den Mechanismus von Gabe und Gegengabe zu schaffen. Dabei werden die Theorien von Herbert Spencer und Marcel Mauss in Bezug auf die Gabe als soziale Tatsache einbezogen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Gabe als komplexes soziales Phänomen mit weitreichenden symbolischen Implikationen. Der begrenzte Umfang der Arbeit erfordert eine knappe Darstellung der historischen Aspekte. Das Kapitel analysiert das Spannungsfeld zwischen dem Idealbild der "wahren" Gabe und den alltäglichen Praktiken des Schenkens.
Schlüsselwörter
Gabe, Gegengabe, Schenken, Symbol, Symbolischer Akt, Marcel Mauss, Herbert Spencer, Theodor Adorno, Gesellschaftliche Bedeutung, Soziologie, Konsumgesellschaft, Geschenk, Ritual.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Arbeit einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftliche Bedeutung von Gaben und Geschenken, insbesondere ihre symbolische Funktion. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen dem Symbolbegriff und der Praxis des Schenkens, wobei die Theorie von Marcel Mauss zentral ist. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Schenkens und das Spannungsverhältnis zwischen dem Ideal der Gabe und der alltäglichen Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Symbolbegriff und seine Anwendung auf das Schenken, die Theorie der Gabe nach Marcel Mauss, die historische Entwicklung des Schenkens, das Idealbild der Gabe im Vergleich zur alltäglichen Praxis und den „Verfall des Schenkens“ im Kontext der modernen Konsumgesellschaft.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Marcel Mauss, Herbert Spencer, Theodor Adorno, Klaus F. Röhl und Ernst Cassirer, um den Symbolbegriff und die soziale Funktion von Gaben zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Symbole (mit Unterkapiteln zu Definition und Gaben als Symbole), Die Gabe (mit Unterkapiteln zu Spencer und Mauss), und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass das Schenken ein komplexer symbolischer Akt ist, der in seiner Bedeutung sowohl historisch als auch gesellschaftlich kontextualisiert werden muss. Sie zeigt auf, wie das Idealbild der Gabe von der Realität des Schenkens in der modernen Konsumgesellschaft abweicht.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Gabe, Gegengabe, Schenken, Symbol, symbolischer Akt, Marcel Mauss, Herbert Spencer, Theodor Adorno, gesellschaftliche Bedeutung, Soziologie, Konsumgesellschaft, Geschenk und Ritual.
Wie wird der Symbolbegriff in der Arbeit behandelt?
Der Symbolbegriff wird anhand der Theorien von Klaus F. Röhl und Ernst Cassirer erläutert. Cassirers Konzept des „Symbolnetzes“ als grundlegenden Unterschied zwischen Mensch und Tier wird verwendet, um den menschlichen Symbolgebrauch zu verstehen und auf das Schenken anzuwenden.
Welche Rolle spielt Marcel Mauss in der Arbeit?
Die Theorie von Marcel Mauss dient als zentrale Schnittstelle, um den Zusammenhang zwischen dem Symbolbegriff und der Praxis des Schenkens zu analysieren. Seine Konzepte zum Thema Gabe und Gegengabe bilden die Grundlage für die Analyse der sozialen Funktion von Gaben.
Wie wird der „Verfall des Schenkens“ beschrieben?
Der „Verfall des Schenkens“ wird im Kontext der modernen Konsumgesellschaft und unter Bezugnahme auf Theodor Adorno beschrieben. Er bezieht sich auf die zunehmende Kommerzialisierung und die Verwässerung der ursprünglichen Bedeutung des Schenkens als symbolischer Akt.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Punkte und Argumentationslinien des jeweiligen Abschnitts erläutert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Gabe und Gegengabe. Eine Betrachtung des Schenkens als symbolischer Akt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294825