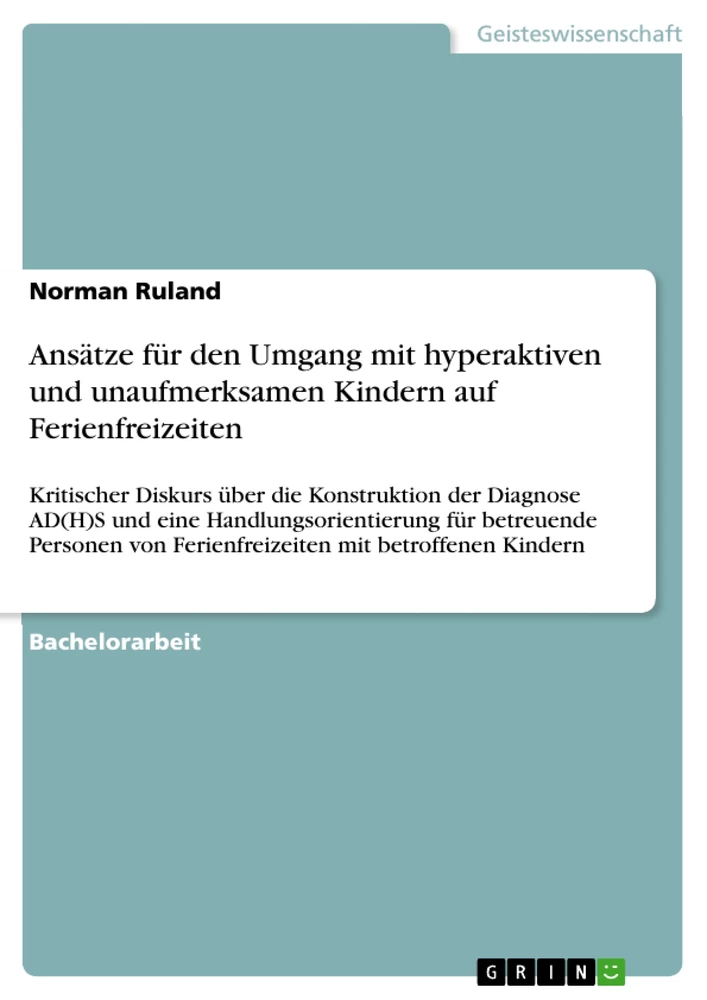Immer wieder fallen Kinder durch spezifische Verhaltensweisen auf, die als aufmerksamkeitsgestört und hyperaktiv bezeichnet werden. Sie scheinen durch einen unbändigen Bewegungsdrang und eine impulsive Triebfeder gezogen zu werden, die sich negativ auf ihre Aufmerksamkeit auswirken (vgl. Amft et al. 2004, S. 7). Viele Kinder sind häufig unkonzentriert, vergesslich, hören nicht auf ihre Bezugspersonen, lassen sich leicht ablenken, können nicht still sitzen und zappeln ständig herum (vgl. Gawrilow 2012, S. 21 f.). Diese Verhaltensweisen sind beispielhafte Erscheinungsmerkmale, die unter der heutigen Diagnose der Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts-)störung, kurz, AD(H)S, kategorisiert werden. AD(H)S ist aktuell die am häufigsten diagnostizierte psychische Störung im Schulalter. Weltweit wurde eine Prävalenzrate (Häufigkeit einer bestimmten Gruppe) von 5,3% bei Kindern berechnet. Bundesweit wird nach Elternur-teilen von 5% nach DSM-IV Kriterien ausgegangen (vgl. Döpfner et al. 2013, S. 5). In den internationalen Klassifikationssystemen für psychische Störungen, der ICD-10 und dem DSM-IV, werden diese als auffällig bezeichneten Verhaltensweisen unter drei Hauptsymptomen definiert: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität (vgl. ebd. S. 5).
Die Konstruktion der Diagnose AD(H)S gilt als einer der größten Kontroversen im Be-reich der Kinderpsychiatrie (vgl. Leuzinger-Bohleber 2006, S. 22). Die Grenzziehung zwischen Verhaltensweisen, die als normal, schwierig oder krank bewertet werden, führt zu einem großen Diskurs in Wissenschaft sowie in der Gesellschaft und ist kritisch zu betrachten. Störmer macht deutlich, dass die Begriffe Verhalten und Störung immer von der individuellen Wahrnehmung des Betrachters gedeutet werden (vgl. Störmer 2013, S. 48).
Gegen eine übergroße medizinisch-biologischen Forschung, die die Ursachen als Folge von vermuteten Störungen im Gehirn vermutet, stellt sich eine sozialwissenschaftliche Sichtweise. Diese konzentriert sich auf psychosoziale Faktoren, zeichnet sich durch einen diagnosekritischen Blick sowie einen lösungs- und ressourcenorientierten Ansatz aus (vgl. Becker 2014, S. 13). Ebenso muss eine Perspektive in Betracht gezogen wer-den, die die Veränderung des Verhaltens im Zuge aktueller Bedingungsfaktoren in der Gesellschaft sieht (vgl. Bonney 2012, S. 83).
Diese Arbeit hilft Jugendgruppenleitern/innen auffälliges Verhalten von Kindern zu verstehen und damit umzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand und Forschungsgeschichte von unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen
- Die Diagnose AD(H)S aus medizinisch-biologischer Perspektive
- Symptomkriterien der AD(H)S in den Diagnosesystemen
- Prävalenzzahlen bei Kindern mit der Diagnose AD(H)S
- Komorbide Störungen in Verbindung mit der Diagnose AD(H)S
- Ätiologische Faktoren der Diagnose AD(H)S aus medizinisch-biologischer Perspektive
- Therapie von Kindern mit der Diagnose AD(H)S
- Kritischer Diskurs um die medizinisch-biologische Perspektive des Phänomens der AD(H)S
- Kritikpunkte an der medizinisch-biologischen Ursachenerklärung der Diagnose AD(H)S
- Kritikpunkte an der Psychopharmakatherapie bei Kindern mit der Diagnose AD(H)S
- Weitere Forschungsperspektiven zu unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen
- Mangel an Sicherheit und Vertrauen als Faktor zur Entstehung von unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen
- Psychoanalytische Positionen zu den Ursachen einer Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung
- Eine philosophische Perspektive zum Phänomen der AD(H)S
- Auswirkungen veränderter gesellschaftlicher Bedingungen für die Entwicklung von unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen
- Die Diagnose AD(H)S aus medizinisch-biologischer Perspektive
- AD(H)S, eine soziale Konstruktion
- Devianz - ein Problem der Grenzziehung bei abweichendem Verhalten
- Prozess der Kategorisierung und Zuschreibung von Verhaltensweisen
- Ressourcen bei Kindern mit unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen erkennen und Handlungsspielräume erweitern…
- Den Teufelskreis von negativen Beziehungserfahrungen bei Kindern mit unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen durchbrechen
- Die Unbestimmtheit der Diagnose AD(H)S als Ressource nutzen
- Ausbildung und Teamvorbereitung der ehrenamtlichen Betreuer/innen für Ferienfreizeiten am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e. V.
- Träger der Ferien- und Ausbildungsmaßnahmen
- Ausbildung der ehrenamtlichen Freizeitbetreuer/innen beim Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e.V.
- Gruppendynamik auf Kinderfreizeiten
- Aspekte der Aufsichtspflicht auf Kinderfreizeiten
- Bedeutung des Teams auf Kinderfreizeiten
- Aspekte der Organisation und Vorbereitung einer Kinderfreizeit bei der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e. V.
- Umgang mit Konflikten auf einer Kinderfreizeit
- Bedürfnisse auf Kinderfreizeiten
- Einblick in eine Ferienmaßnahme der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e. V.
- Aspekte der Teamvorbereitung des Konzeptes der Kinderfreizeit auf Sylt der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e. V. 2014
- Pädagogisches Aspekte des Konzeptes der Kinderfreizeit auf Sylt der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e. V. 2014
- Organisatorische Aspekte des Konzeptes der Kinderfreizeit auf Sylt der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e. V. 2014
- Handlungsansätze für den Umgang mit hyperaktiven und unaufmerksamen Kindern auf Ferienfreizeiten
- Beziehungsgestaltung als Voraussetzung für mögliche Handlungsansätze im Umgang mit hyperaktiven und unaufmerksamen Kindern
- Bedeutung von Anerkennung für die Beziehungsgestaltung zu Kindern denen eine AD(H)S zugeschrieben wird
- Prinzipien für die Erziehung eines Kindes mit der Diagnose AD(H)S
- Verantwortung übergeben
- Aufmerksamkeit gewinnen - Umgebung reduzieren - Signale setzen
- Verwendung von Wenn-dann-Strategien
- Bedeutung des Freispiels
- Sport als Möglichkeit zur Selbstregulation
- Bedeutung von Ritualen
- Resümee der Handlungsansätze
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der AD(H)S-Diagnose und deren Auswirkungen auf den Umgang mit hyperaktiven und unaufmerksamen Kindern im Kontext von Ferienfreizeiten. Die Arbeit analysiert kritisch die Konstruktion der Diagnose AD(H)S und beleuchtet verschiedene Forschungsperspektiven, die über die rein medizinisch-biologische Sichtweise hinausgehen. Ziel ist es, Handlungsansätze für ehrenamtliche Betreuer/innen auf Ferienfreizeiten zu entwickeln, die einen ressourcenorientierten und respektvollen Umgang mit Kindern mit AD(H)S ermöglichen.
- Kritischer Diskurs um die Diagnose AD(H)S und deren Konstruktion
- Alternative Forschungsperspektiven zu AD(H)S, die psychosoziale Faktoren und gesellschaftliche Bedingungen berücksichtigen
- Ressourcenorientierter Ansatz im Umgang mit Kindern mit AD(H)S
- Entwicklung von Handlungsansätzen für ehrenamtliche Betreuer/innen auf Ferienfreizeiten
- Bedeutung von Beziehungsgestaltung und Anerkennung für den Umgang mit Kindern mit AD(H)S
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der hyperaktiven und unaufmerksamen Verhaltensweisen bei Kindern ein und stellt die Relevanz der AD(H)S-Diagnose im Kontext von Ferienfreizeiten dar. Sie beleuchtet die Kontroversen um die Diagnose und die Notwendigkeit einer kritischen Betrachtung.
Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand und die Forschungsgeschichte von unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen. Es werden die medizinisch-biologische Perspektive der AD(H)S-Diagnose, die Kritikpunkte an dieser Sichtweise sowie alternative Forschungsperspektiven, die psychosoziale Faktoren und gesellschaftliche Bedingungen berücksichtigen, dargestellt.
Kapitel 3 untersucht die AD(H)S-Diagnose als soziale Konstruktion und beleuchtet die Prozesse der Kategorisierung und Zuschreibung von Verhaltensweisen. Es wird die Bedeutung der Grenzziehung zwischen normalem und abweichendem Verhalten im Kontext der AD(H)S-Diagnose diskutiert.
Kapitel 4 widmet sich der Frage, wie Ressourcen bei Kindern mit unaufmerksamen und hyperaktiven Verhaltensweisen erkannt und Handlungsspielräume erweitert werden können. Es werden Strategien zur Durchbrechung des Teufelskreises negativer Beziehungserfahrungen und die Nutzung der Unbestimmtheit der Diagnose AD(H)S als Ressource vorgestellt.
Kapitel 5 beleuchtet die Ausbildung und Teamvorbereitung von ehrenamtlichen Betreuer/innen für Ferienfreizeiten am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar e. V. Es werden die Ausbildungsinhalte, die Bedeutung des Teams und die organisatorischen Aspekte von Ferienfreizeiten dargestellt.
Kapitel 6 präsentiert Handlungsansätze für den Umgang mit hyperaktiven und unaufmerksamen Kindern auf Ferienfreizeiten. Es werden die Bedeutung von Beziehungsgestaltung, Anerkennung und verschiedenen pädagogischen Strategien für den Umgang mit Kindern mit AD(H)S hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Diagnose AD(H)S, hyperaktive und unaufmerksame Verhaltensweisen, Ferienfreizeiten, ehrenamtliche Betreuer/innen, Beziehungsgestaltung, Anerkennung, Ressourcenorientierung, Handlungsansätze, soziale Konstruktion, Kritik an der medizinisch-biologischen Perspektive, psychosoziale Faktoren, gesellschaftliche Bedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernsymptome von AD(H)S?
Die Hauptsymptome sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, die in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV definiert sind.
Warum wird die Diagnose AD(H)S kritisch hinterfragt?
Kritiker sehen sie oft als soziale Konstruktion und bemängeln die schnelle Verschreibung von Psychopharmaka sowie die Vernachlässigung psychosozialer Faktoren.
Wie sollten Betreuer auf Ferienfreizeiten mit AD(H)S-Kindern umgehen?
Wichtig sind klare Strukturen, Rituale, eine reizarme Umgebung sowie eine wertschätzende Beziehungsgestaltung.
Welche Rolle spielt Sport für Kinder mit AD(H)S?
Sport bietet eine wichtige Möglichkeit zur Selbstregulation und zum Abbau des unbändigen Bewegungsdrangs.
Was bedeutet Ressourcenorientierung in diesem Zusammenhang?
Statt nur auf die Störung zu blicken, werden die Stärken des Kindes (z.B. Kreativität, Begeisterungsfähigkeit) genutzt, um Handlungsspielräume zu erweitern.
- Citar trabajo
- Norman Ruland (Autor), 2014, Ansätze für den Umgang mit hyperaktiven und unaufmerksamen Kindern auf Ferienfreizeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294943