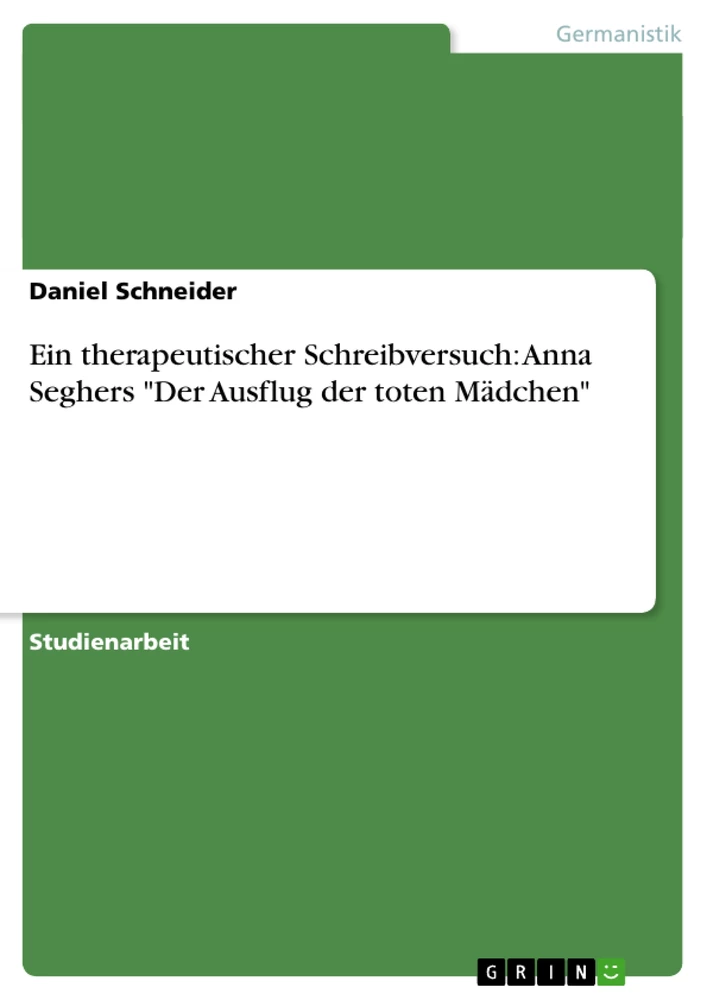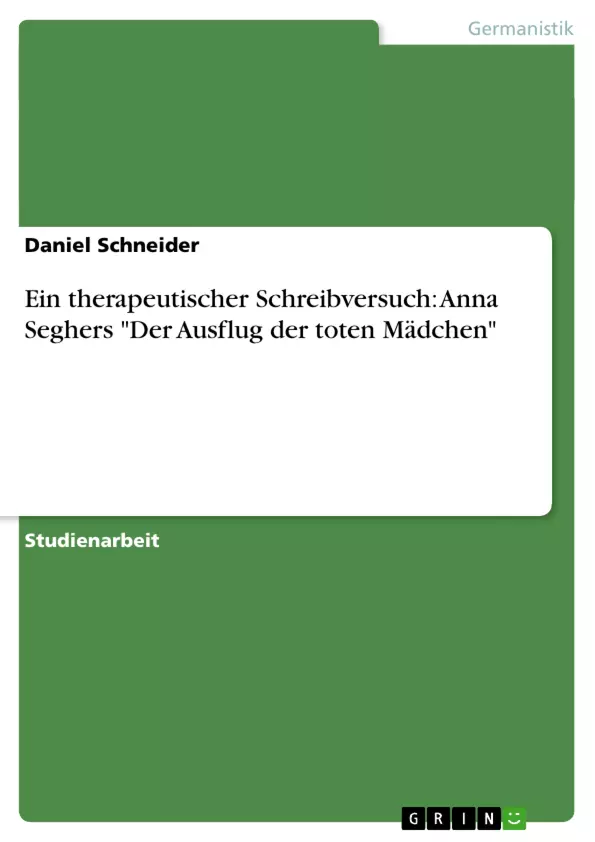Im Juni 1943 kündigt die Schriftstellerin Anna Seghers, die als einzige Tochter eines jüdischen Antiquitätenhändlers am 19. November 1900 in Mainz geboren wurde, in einem Brief an Wieland Herzfelde „etwas ganz Neues, Unvorhergesehenes“1 an. Die sich im mexikanischen Exil befindende und damit vor der Verfolgung in der Heimat flüchtende Seghers deutete mit diesem Ausspruch auf ihre geplante Erzählung „Der Ausflug der toten Mädchen“ hin, die allerdings erst 1946 in New York veröffentlich werden sollte. Ein Unfall, in Folge dessen die Autorin für mehrere Wochen zwischen Leben und Tod schwankte, unterbrach für einige Zeit ihr Arbeiten an dem Werk. „Der Ausflug der toten Mädchen“ gehört heute auch wegen des für Seghers ungewöhnlichen autobiographischen Ansatzes zu den wohl meist beachteten und den am häufigsten interpretierten Geschichten. Es ist das einzige Werk, in dem sich Seghers gönnt, von sich selbst, ihrer Familie und ihrem Umfeld zu sprechen.
Die Ich-Erzählerin unternimmt in der Mittagsglut einen Ausflug in den mexikanischen Bergen. In einem Zustand von Müdigkeit verwandelt sich die kahle Gebirgswelt in eine üppige Rheinlandschaft und es überwältigt sie eine Kindheitserinnerung: die Dampferfahrt ihrer Schulklasse zu einem Ausflugsort bei Mainz kurz vor dem ersten Weltkrieg. Die Ich-Erzählerin ist mit ihren Freundinnen Marianne und Leni an der Schaukel, später mit den anderen Mitschülerinnen und den Lehrerinnen an der Kaffeetafel. Des Weiteren erlebt sie die Begegnung mit einer Jungenklasse und deren Lehrern, anschließend die Heimfahrt und den Gang durch Mainz nach Hause. Das Traumbild verschwindet erst, als sie in die eigene Wohnung eilen will. In der folgenden Arbeit soll nun versucht werden, die strukturelle Einteilung des Werkes in eine Rahmen- und Binnengeschichte aufzuzeigen und zu beleuchten. Des Weiteren soll die gewählte Überschrift „Ein therapeutischer Schreibversuch“ sowohl anhand der beispielhaften Charaktere der Marianne auf eine deutsche Schuld an den Vorkommnissen des Dritten Reiches bezogen werden als auch in einem abschließenden Teil unter Berücksichtigung des autobiographischen Bezuges auf das Leben der Autorin.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmen- und Binnengeschichte
- Mexiko in der Rahmengeschichte
- Übergang in die Jugendzeit
- Schicksale von Nettys Klassenkameradinnen
- Beispielhaftes Schicksal Mariannes
- Individuelle deutsche Schuld
- Autobiographische Aspekte
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von Anna Seghers' Novelle „Der Ausflug der toten Mädchen“. Die Arbeit zielt darauf ab, die strukturelle Einteilung des Werkes in eine Rahmen- und Binnengeschichte aufzuzeigen und zu beleuchten. Darüber hinaus soll die gewählte Überschrift „Ein therapeutischer Schreibversuch“ sowohl anhand der beispielhaften Charaktere der Marianne auf eine deutsche Schuld an den Vorkommnissen des Dritten Reiches bezogen werden als auch unter Berücksichtigung des autobiographischen Bezugs auf das Leben der Autorin.
- Die strukturelle Einteilung des Werkes in Rahmen- und Binnengeschichte
- Der autobiographische Bezug auf das Leben der Autorin
- Die Frage der deutschen Schuld am Dritten Reich
- Die Bedeutung der mexikanischen Exilsituation für die Autorin
- Die Charakterisierung der Figuren und deren Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Novelle beginnt mit der Ich-Erzählerin Netty im mexikanischen Exil während des Zweiten Weltkriegs. Die aktuelle Situation bildet den Rahmen für eine chronikhafte Binnengeschichte über einen Schulausflug vor dem Ersten Weltkrieg. Die Erzählerin verbindet ihre Erinnerungen mit dem späteren Schicksal der Beteiligten. Die Rahmengeschichte zeigt die persönlichen Erfahrungen der Autorin mit dem Land und der Kultur Mexikos, wobei deutlich wird, dass sie sich nicht freiwillig im Exil befindet.
Die Binnengeschichte schildert den Ausflug der Schulklasse und die Begegnungen der Schülerinnen mit den Lehrern und den Jungenklasse. Der Ausflug wird von der Erzählerin als eine Art Trauma dargestellt, das sie auch im Exil noch verfolgt. Durch die Einbeziehung des späteren Schicksals der Beteiligten wird die deutsche Schuld am Dritten Reich thematisiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Novelle sind: Rahmen- und Binnengeschichte, autobiographische Aspekte, deutsche Schuld, Exil, Mexiko, Trauma, Kindheitserinnerung.
Worum geht es in der Erzählung "Der Ausflug der toten Mädchen"?
Anna Seghers verarbeitet darin ihre Kindheitserinnerungen an einen Schulausflug vor dem Ersten Weltkrieg und kontrastiert diese mit den späteren Schicksalen ihrer Mitschülerinnen im Nationalsozialismus.
Warum wird das Werk als "therapeutischer Schreibversuch" bezeichnet?
Die Autorin schrieb das Werk im mexikanischen Exil nach einem schweren Unfall, um ihre eigene Identität, ihre Familie und das Trauma der Vertreibung zu verarbeiten.
Welche Rolle spielt die Figur Marianne?
Marianne steht beispielhaft für die individuelle deutsche Schuld, da sie sich von ihrer ehemals besten Freundin Leni abwendet, als diese von den Nazis verfolgt wird.
Wie ist die Novelle strukturell aufgebaut?
Das Werk ist in eine Rahmengeschichte (Exil in Mexiko) und eine Binnengeschichte (Schulausflug in Deutschland) unterteilt.
Was ist das Besondere an diesem Werk im Schaffen von Anna Seghers?
Es ist ihr einziges Werk mit einem stark autobiographischen Ansatz, in dem sie direkt über ihre eigene Herkunft und ihr Umfeld spricht.